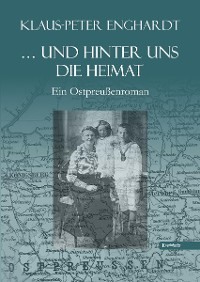Kitabı oku: «... und hinter uns die Heimat», sayfa 6
Ganz besonders erschüttert war sie vom Tod des Nachbarsohnes. Sie hatten als Kinder miteinander gespielt und als Heranwachsende lernten sie auf demselben Gymnasium. Sie war sehr froh, dass es ihren Eltern gut ging, aber ihr wäre wohler zumute, wenn sie Köln verlassen würden.
Das Pflichtbewusstsein ihres Vaters, der auch in schwersten Zeiten nie seiner Arbeit fern blieb, würde eines Tages noch zu einem Unglück führen.
Die junge Frau schwebte zwischen Angst, wenn sie an ihre Eltern, Verwandte und Freunde dachte, und Erleichterung, dass sie selbst, fernab von Bombenbedrohungen im ostpreußischen Loditten in Sicherheit war.
Tante Ida schrieb, dass sie inzwischen ab und zu Besuch von ihrem Mann Herbert bekam, und stellte die Aussicht in den Raum, sich angesichts der schweren Zeit wieder mit ihm zu versöhnen. Das freute Katharina, die ja ihren Onkel öfters heimlich besucht hatte und somit künftig eventuell auf diese Art Heimlichkeiten verzichten konnte.
Mutter Kleinschmidt schrieb in ihrer unverwechselbaren Art genauso wie sie sprach und Katharina musste beim Lesen der Zeilen ein paarmal lachen. Die Frau beklagte sich über das Berliner »Mistwetter«, über die Rationierung der meisten Dinge des täglichen Bedarfs, über den Engpass an Kohlen, Brennholz und Kartoffeln, über das Ausbleiben von Gästen und auch darüber, dass ihre Tochter sie wohl vergessen hatte, da sie sich gar nicht mehr meldete.
Doch bei allem Schimpfen klang aber auch immer wieder der unverbrüchliche Optimismus der Frau durch.
Katharina wollte die Briefe so schnell wie möglich beantworten.
Inzwischen wehte der berüchtigte kalte Ostwind über das Memelland nach Ostpreußen. Das Herbstlaub wurde von den Ästen geweht, und tanzte im Spiel des Windes. Regenschauer jagten Mensch und Tier in sicheren Unterschlupf und aus den Schornsteinen der Häuser stiegen dicke Rauchwolken.
Die junge Lehrerin bekam einen ersten Eindruck, wie unwirtlich es in ihrer neuen Heimat sein konnte, dabei hatte der Winter noch nicht einmal begonnen.
Mit dem Beginn der kalten Jahreszeit wurde im Haus von Marie Schimkus eine liebgewonnene Tradition wiederbelebt, an der Katharina nun ebenfalls teilhaben durfte.
Die Noaberschen trafen sich zum Kadreiern, da kam manchmal sogar eine größere Plachanderrunde zum Schabbern zusammen. Bei Kaffee und Plinsen wurden all die Ereignisse besprochen, die sich ab dem Frühling zugetragen hatten. Hochzeiten, Todesfälle, Kindergeburten und all den Frauenklatsch, über den es sich herzuziehen lohnte, jedoch ohne Bosheit und Arglist.
Die Menschen in Ostpreußen waren geradlinig, manchmal wortkarg, zuweilen auch störrisch, aber immer ehrlich.
Wortkarg waren die Nachbarinnen von Marie Schimkus zum Glück nicht, deshalb waren die Abende, an denen sie sich im Wechsel trafen, für die Frauen immer sehr unterhaltsam.
Meist brachten sie Strickzeug mit und strickten Socken, Handschuhe oder Schals oder stopften ihren Männern die löchrigen »Mauken«. Die Hände der Frauen konnten auch nach dem Feierabend einfach nicht ruhen.
Die Männer nahmen es den Frauen nicht übel, dass die sich zum Plaudern trafen. Sie selbst setzten sich dann im Wirtshaus zusammen, kippten sich ein paar Bierchen und ein paar Bärenfang oder Machandel hinter die Schlorren, und auch sie unterhielten sich oder spielten Karten. Der Winter war für die Bauern die Zeit, auch einmal ein wenig an sich zu denken.
In den vergangenen Tagen hatte die junge Lehrerin die geplanten Elternbesuche begonnen, und das nicht nur bei den Eltern schwieriger Schüler. Es war zugleich ein Anlass, sich bei den Eltern im Dorf bekannt zu machen. Meist waren ohnehin nur die Mütter der Kinder und die Großeltern anwesend, weil ja fast alle wehrfähigen Männer des Dorfes zu den Soldaten eingezogen waren. Als Ersatz für die fehlenden deutschen Bauern und Handwerker dienten russische, polnische, französische und belgische Arbeitskräfte. Besonders Gefangene aus dem französischen Elsass-Lothringen, die zumeist deutsch sprachen, wurden auf den Feldern und in den Werkstätten des Gutes der Familie von Lübzow eingesetzt.
Die sowjetischen Kriegsgefangenen beherrschten die deutsche Sprache nicht und auch die Polen sprachen nur ein paar deutsche Brocken.
War die Lehrerin zunächst etwas befangen, lernte sie doch sehr schnell die Liebenswürdigkeit und Gastfreundschaft der Menschen im Dorf kennen und wurde von ihnen sofort in ihre Gemeinschaft aufgenommen.
Ursprünglich hatte sich Katharina vorgenommen pro Abend mindestens vier Familien zu besuchen, doch meist wurde sie bereits bei der ersten Familie zu einem Tee oder gar zum Abendbrot eingeladen. Oft gingen die Gespräche über die Schulprobleme hinaus, so dass für die Lehrerin absehbar war, dass sie es nicht schaffen würde, noch vor den Weihnachtsferien alle Eltern aufzusuchen.
Eines erstaunte die Lehrerin immer wieder. Anders als in Köln, wo die Eltern auch ihre größten Rüpel vehement verteidigten und auch verredeten, gingen die Ostpreußen mit ihrem Nachwuchs weniger nachsichtig um. Rüpel war Rüpel, Faulpelz, Faulpelz und wer Strafe verdient hatte, der sollte sie auch bekommen. Wenn nötig, sogar mit dem Rohrstock.
Katharina musste sich an manchem Abend einen Ruck geben, das gemütlich beheizte Haus zu verlassen und in die nasse Kälte hinaus zu gehen. Zu den entlegenen Höfen fuhr sie mit dem Fahrrad.
Ihre Hände steckten in dicken Handschuhen, den Jackenkragen hatte sie hoch geschlossen, vor dem Mund einen Schal gebunden und auf dem Kopf trug sie eine Mütze. So versuchte sie dem Wetter zu trotzen. Dennoch peitschte ihr der Regen oft ins Gesicht und sie kam bei den Leuten oft nass wie ein Pudel an und war dann dankbar für einen heißen Tee. Manchmal gab es sogar einen Grog oder einen heißen Bärenfang, das weckte die Lebensgeister und wärmte von innen. Es war dann für die Lehrerin immer schwer, am selben Abend noch eine zweite Familie aufzusuchen.
Manchmal verfehlte nach so einem üblen Wetter ihr Besuch jedoch sogar den eigentlichen Grund. Dann nämlich, wenn sie völlig durchnässt bei einer Familie eintraf und erst einmal »trocken gelegt« und aufgewärmt werden musste.
Nach zwei oder gar drei heißen Bärenfang war selbst der engagiertesten Lehrerin die Lust auf ernsthafte Schulgespräche vergangen. Viel lieber hörte sie sich dann die Erzählungen der alten Leute an, die endlich auf jemanden trafen, mit dem sie noch nicht über die Geschichten aus der alten Zeit plachandert hatten. Diese Gesprächsabende verschafften der jungen Frau jedoch schon bald Sympathien im Ort, denn es sprach sich herum, dass diese tüchtige Lehrerin nicht nur über die Probleme in der Schule sprechen wollte, sondern sich ihrerseits auch für die Belange der Menschen im Dorf interessierte und zuhören konnte.
Dass man die Dorfschullehrerin mitunter mittels zwei oder drei Gläschen Grog oder Bärenfang von den eigentlichen Themen abbringen konnte, blieb selbstverständlich unerwähnt.
An einem jener Abende, an dem die Schulprobleme eine untergeordnete Rolle spielten und Katharina sich wieder einmal die Geschichten und Erlebnisse aus alter Zeit anhören musste, trat die alte Frau Penschat mit einer Frage an die Lehrerin heran.
»Sajen Se mal Frollejn, man hat Se sonntachs noch nie nich in unsere Kirche jesehen, sind Se etwa nich jläubig? Es spricht sich schnell herum, wenn ejns nich in die Kirche jeht.«
»Liebe Frau Penschat, natürlich bin ich gläubig, in Köln bin ich mit meinen Eltern regelmäßig zum Gottesdienst gegangen. Es war ja sogar ein Einstellungskriterium, dass ich meine Glaubenszugehörigkeit nachweisen kann, aber ich hatte in den letzten Wochen so viel für die Schule zu tun, da blieben die Kirchenbesuche leider auf der Strecke. Meine Wirtin hat mich aber bereits zum Gottesdienst am nächsten Sonntag eingeladen.«
Die Antwort schien Frau Penschat zufrieden gestellt zu haben, denn sie schabberte nun über den allgemeinen Dorftratsch. Herr Penschat hatte auf seinem Stuhl am Ofen gesessen und stand missmutig brummelnd auf, um sich einen Knösel zu stopfen. Ihm missfiel es, wenn seine Frau den Dorftratsch weitergab, da paffte er aus Protest dicke Qualmwolken an die Decke.
Am Donnerstag fuhr Katharina zum Vorwerk Eichgraben, um sich den Müttern einiger ihrer Schüler vorzustellen und mit ihnen über ihre Sprösslinge zu sprechen.
Die Vorwerke Eichgraben, Karlshof und Buchwäldchen waren nur auf unbefestigten Wegen zu erreichen, die vorbei an hügeligen Feldern durch einen dichten Wald führten.
Der Regen der letzten Tage hatte die grundlosen Wege aufgeweicht und die Lehrerin sank auf freier Strecke mit ihren Rädern im Schlamm ein, sodass sie mit einem beherzten Sprung von den Pedalen direkt in den Schlamm hopsen musste. Leise fluchend schob sie ihr Fahrrad durch den Morast auf festen Weg und stieg schließlich wieder auf.
Ihre Schuhe waren bis zu den Knöcheln beschmutzt, doch die Lehrerin setzte ihren Weg unbeirrt nach Eichgraben fort, denn was sie sich einmal vorgenommen hatte, das führte sie auch zu Ende.
Bereits wenige Tage später waren auf dem Weg nach Buchwäldchen die tiefen Fahrspuren der eisenbeschlagenen Räder der Pferdefuhrwerke gefroren.
Die junge Frau zog es nun vor, ihr Fahrrad zu schieben, ehe sie womöglich in eine der gefrorenen Rillen geriet und stürzte.
Von einer Anhöhe aus konnte sie das Vorwerk Buchwäldchen sehen und war froh, dass sie den beschwerlichen Weg fast geschafft hatte, doch gänzlich aufatmen würde sie erst, wenn sie wieder wohlbehalten in ihrer Wohnung angekommen war. Ihr schoss plötzlich der Gedanke durch den Kopf, dass dies der tägliche Schulweg einiger ihrer Schüler war, egal ob bei Sonne, Regen oder Schnee, doch gerade die Schüler aus diesen abgelegenen Vorwerken waren fast immer pünktlich, und vor allem, sie schwänzten nie.
Als Katharina eines Tages nach der Schule nach Hause kam, lächelte ihre Wirtin sie geheimnisvoll an und deutete mit einer Kopfbewegung zum Küchentisch. Dort lehnte an ihrer Kaffeetasse ein Brief. Sie erkannte die Schrift sofort.
Den Brief hatte Wolfgang geschrieben und Katharinas Freude war riesengroß. Auch Marie hatte einen Brief von ihrem Sohn bekommen. Es schien ihm gut zu gehen, das zumindest verriet Maries Lächeln.
ZU WEIHNACHTEN IN KÖLN
Überhaupt hatte sich Marie in den vergangenen Wochen verändert. War sie bei der ersten Begegnung mit Katharina noch gezeichnet von der Trauer um ihren Mann, der an der Front gefallen war und lebte still und in sich gekehrt, voller Sorge um ihre Söhne, so hatte sie inzwischen ihre Lebensfreude wiedergefunden. Sie war eine wunderschöne Frau im besten Alter und hatte sogar wieder die Freude am Singen entdeckt. Seit kurzer Zeit besuchte sie wieder regelmäßig den Kirchenchor, in dem sie vor dem Tod ihres Mannes viele Jahre Mitglied war.
Katharina nahm den Brief an sich und lief eilig die Treppe zu ihrem Zimmer hinauf. Sie schlüpfte aus Mantel und Schuhen, warf sich auf ihr Bett und öffnete den Brief. Als sie ihn las, konnte sie es nicht verhindern, dass sie weinte.
Wolfgang schrieb ihr mit zärtlichen Worten, dass er sie liebte, obwohl sie nur wenige Tage miteinander verbracht hatten. Von der Situation an der Front stand nicht viel im Brief, aber mit dem feinen Gespür einer Frau las Katharina zwischen den Zeilen die Befürchtung Wolfgangs, dass ihm in den kommenden Wochen wohl schwere Tage bevorstehen würden. An einen Urlaub zu Weihnachten war momentan nicht zu denken.
Das war sehr schade für Wolfgangs Mutter, denn Katharina würde über die Weihnachtsfeiertage auch nicht in Loditten sein, denn natürlich wollte sie das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel bei ihren Eltern verbringen.
Bereits zwei Tage später musste sich Katharina keine Sorgen mehr darum machen, dass Marie Schimkus das Weihnachtsfest allein verbringen muss, denn endlich, nach wochenlanger Sorge, kam ein Brief ihres zweiten Sohnes Georg, in dem er nicht nur mitteilte, dass es ihm gut ging, sondern auch, dass er einen Tag vor dem Heiligen Abend auf Weihnachtsurlaub kommt.
Nur wenige Tage dauerte es noch bis zum Heiligen Abend. Die Vorweihnachtszeit hatten beide Frauen gemütlich bei Kerzenschein in der Küche verbracht, doch an den Adventssonntagen saßen sie im Wohnzimmer bei leckerem Weihnachtsgebäck, das sie gemeinsam nach Rezepten ihrer Regionen gebacken hatten.
Es roch nach Plätzchen, Zimtsternen und Pfeffernüssen und im Kachelofen knisterte Tannenreisig, das einen würzigen Duft im Haus verströmte. In der »Röhre« des Kachelofens bereitete Marie Schimkus nebenher zwei leckere Bratäpfel, die ihren Duft bereits in der Stube verbreiteten. Am Abend gab es Glühwein, Grog oder heißen Bärenfang.
Katharina hätte nie gedacht, dass sie so weit von zu Hause eine so schöne Adventszeit erleben würde.
Inzwischen hatte es längst geschneit und noch nie hatte die Lehrerin solche Schneemassen erlebt.
Das Thermometer zeigte Temperaturen von minus elf Grad Celsius an, die in Köln nicht oft erreicht wurden. Zum Glück hatte sich die junge Frau rechtzeitig auf diese Temperaturen vorbereitet und von zu Hause wärmende Wintersachen und dicke, gestrickte Wollhandschuhe schicken lassen.
Der Schnee lag wie ein riesiger Watteteppich über dem Land. Die Eiskristalle funkelten wie Diamanten und der Vollmond strahlte so hell am Himmel, dass man selbst in der Nacht ohne Beleuchtung wunderbar sehen konnte.
Noch nie hatte Katharina so einen grandiosen Sternenhimmel erlebt. Von einem Horizont zum anderen tummelten sich abertausende Sterne am Himmel, die nirgendwo klarer strahlten. Man könnte fast vergessen, dass Krieg war.
In der Schule bastelte die Lehrerin mit den Kindern kleine Geschenke für ihre Familien. Kerzenständer aus Baumrinde und Walnussschalen, Weihnachtskarten, Untersetzer, Scherenschnitte und manches Mädchen stickte sogar ein Deckchen. Sogar eine richtige Weihnachtsfeier mit Plätzchen, Kuchen und Süßigkeiten organisierte sie für ihre Schüler. Marie Schimkus half ihr beim Backen und Ausschmücken des Klassenraumes.
Vom Gut des Barons von Lübzow hatte sie Milch für den Kakao bekommen und das Kakaopulver dazu hatte der Kolonialwarenhändler spendiert.
Als die Kinder dann am Nachmittag den Raum betraten, duftete es nach Tannengrün und Räucherkerzen.
Nachdem die Kinder den Kuchen und die Plätzchen gegessen und heißen Kakao getrunken hatten, wurde von einigen Schülern ein kleines Weihnachtsprogramm gestaltet. Katharina hatte mit ihnen die Weihnachtsgeschichte eingeübt, die von den zuschauenden Mitschülern begeistert aufgenommen wurde. Anschließend sang sie mit allen Kindern noch einige Weihnachtslieder und entließ die Kinder nach zwei festlichen Stunden nach Hause. Sie war glücklich, dass sie in so viele strahlende Gesichter schauen durfte, das war der Lohn für ihre Mühe. Diese Weihnachtsfeier würde den Kindern sicher lange in Erinnerung bleiben.
Drei Tage vor dem Heiligen Abend saß Katharina dann im Zug nach Köln, nachdem in Loditten zwischen ihr und Marie Schimkus ein schwermütiger Abschied stattgefunden hatte. Beide Frauen lagen sich in den Armen, weinten und drückten sich, als wäre es ein Abschied für immer.
Zwar freute sich Marie auf ihren Sohn, aber sie hätte das Weihnachtsfest gern mit beiden gefeiert.
Die Wochen der Vorweihnachtszeit hatten die zwei Frauen in inniger Verbundenheit verbracht, und Marie fürchtete sich vor dem Gedanken, dass Katharina nicht wiederkommen könnte. Die stetigen Bombenangriffe auf Köln und die damit verbundene Angst um ihre Eltern machten der jungen Frau zu schaffen, und wer weiß, ob sie sich in dieser schweren Zeit noch einmal von ihren Eltern trennen würde.
Als Katharina nach zweiundzwanzig Stunden Fahrzeit in Köln aus dem Zug stieg, war sie müde und nicht mehr so unbeschwert wie beim letzten Mal. Die Bahnhöfe und die Züge waren mit Soldaten überfüllt und die wenigen Zivilisten hatten Mühe einen Platz zu finden. Bereits am Stadtrand von Köln waren die gravierenden Veränderungen im Stadtbild zu erkennen. Der Krieg hatte weitere Marken in die geschundene Stadt geschlagen, die nicht mehr zu übersehen waren.
Allein die Freude, ihre Eltern und Verwandten wiederzusehen milderte ihre Beklemmung ein wenig.
Der Zug hatte diesmal eine gewaltige Verspätung, so dass sie eigentlich nicht mehr erwartete, von ihrem Vater vom Bahnhof abgeholt zu werden.
Immer wieder legte ihr Zug einen Halt ein, um beladenen Militärzügen die ungehinderte Durchfahrt zu gewähren. Auf Bahnhöfen zwischen Berlin und Köln warteten Unmengen von Güterzügen auf ihre Abfahrt zur Front.
Auf den Bahnsteigen herrschte auch im vierten Kriegsjahr eine emsige Betriebsamkeit und nichts deutete auf die Gefahr von Fliegerangriffen hin.
Riesige Propagandaplakate füllten nach wie vor die Bahnhofswände und die zahlreichen Soldaten suggerierten Stärke, die allerdings zumindest im Osten Europas und in Nordafrika zu bröckeln begann.
Die junge Frau sah sich nach einer Kofferkarre um, da entdeckte sie ihren Vater, der mit langen Schritten auf sie zu stürmte. Unendlich erleichtert sank sie ihm bei der Begrüßung in die Arme.
»Mein Mädchen, ist das eine Freude, dass du wieder da bist. Mutter freut sich auch riesig und wird vor Ungeduld schon ganz krank sein. Lass’ uns schnell nach Hause fahren. Zum Glück fahren die Straßenbahnen auf den wichtigsten Linien noch immer im Fünfzehnminutentakt, wenn sie auch früher alle zehn Minuten fuhren. Zweimal war ich schon auf dem Bahnhof und immer wieder wurde eine andere Ankunftszeit bekannt gegeben. Mutter wartet schon sehnsüchtig auf dich!«
Er übernahm das Gepäck und auf dem Nachhauseweg erzählte ihm seine Tochter bereits in der Straßenbahn alles, was in den letzten Wochen in Loditten passiert war. Na ja, fast alles, denn dass sie sich verliebt hatte, wollte sie erst einmal für sich behalten, der Vater wäre sonst vielleicht ein wenig beunruhigt, dass ihre Liebe sie in Ostpreußen festhalten könnte.
Mit Bestürzung sah sie durch die Fensterscheiben die Ruinen der bombardierten Häuser und die Schutthalden, die sich überall türmten. Autos waren wegen des Treibstoffmangels auf den Straßen eine Seltenheit geworden. Der Vater bemerkte ihre Verfassung und sagte: »Schau nicht so genau hin, Mädel. Überall Leid und Tod, das kann einen krank machen, aber wir hatten bisher alle Glück gehabt, hoffentlich bleibt es auch so! Rede nicht mit Mutter darüber, sie kann mit dem Elend nicht so gut umgehen.«
Katharina nickte etwas geistesabwesend und versuchte, die Bilder aus ihrem Kopf zu bekommen.
Wie schon bei ihrem letzten Besuch, brach die Mutter auch diesmal wieder bei der Begrüßung in Freudentränen aus und wollte natürlich ebenfalls alle Neuigkeiten der letzten Wochen erfahren. Katharina gab gern ein zweites Mal Auskunft darüber, doch auch der Mutter verschwieg sie, dass sie sich verliebt hatte.
Es lag nicht etwa am mangelnden Vertrauen zu ihren Eltern, vielmehr wollte sie dieses Geheimnis noch ein wenig bewahren, da ihre Liebe zu Wolfgang doch erst auf zwei kurze Wochen gegründet war. Erst, wenn sie beide sich besser kennengelernt hatten, um Pläne für das weitere Leben schmieden zu können, würde sie sich ihren Eltern offenbaren.
In der Wohnstube duftete es nach Plätzchen, wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit, wenn Mutter die frisch gebackenen Plätzchen zum Abkühlen in einer Schale auf die Anrichte stellte und Katharina die Neugier in die Stube trieb. Dort auf einem kleinen Tischchen stand er, der Weihnachtsbaum. Kleiner als in den Jahren zuvor, aber mit bunten Kugeln und Lametta festlich geschmückt. Die Spitze des Baumes zierte, wie bereits seit ihren Kindertagen, ein kleiner Rauschgoldengel.
Alles war wie früher und doch war es ein wenig anders.
Sie war kein Kind mehr und lebte nicht mehr in dieser Wohnung.
Inzwischen hatte Elfriede Knieschitz Kaffee auf den Küchentisch gestellt und zum Kosten ein paar der Weihnachtsplätzchen.
Die junge Frau freute sich schon darauf, mit ihren Eltern am Heiligen Abend gemütlich beisammen zu sitzen, Weihnachtslieder zu singen, einen heißen Punsch zu trinken und die Geschenke auszupacken.
»Wie geht es eigentlich Tante Ida?«, wollte sie wissen.
»Gut geht es ihr«, antwortete die Mutter, »Onkel Herbert ist wieder bei ihr eingezogen und die beiden vertragen sich prima. Mussten erst so viele Jahre vergehen?«
»Das ist ja wunderbar«, freute sich Katharina, »ich werde sie morgen besuchen gehen. Da kann ich gleich die Weihnachtsgeschenke für sie mitnehmen. Für Tante Ida habe ich einen ganz frisch geräucherten Aal gekauft und für Onkel Herbert ein paar gute Zigarren«, platzte sie heraus.
»Zigarren für Onkel Herbert?«, fragte ihr Vater. »Du wusstest doch noch gar nicht, dass Onkel Herbert wieder bei Tante Ida wohnt«, staunte er.
Nun musste Katharina Farbe bekennen und gestand ihren Eltern erstens, dass sie ihren Onkel manchmal besucht hatte und zweitens, dass Tante Ida in ihrem Brief bereits eine Andeutung gemacht hatte, dass eine Versöhnung mit ihrem Mann nicht ausgeschlossen war.
»Na, siehst du, Mutter, du hast gedacht, dass unsere Tochter in Ostpreußen aus der Welt ist, dabei funktioniert die Nachrichtenübermittlung doch prima. Ich bin ja auch froh, dass Onkel Herbert und Tante Ida sich wieder vertragen haben.«
Mutter Knieschitz antwortete ihrem Mann: »Deshalb habe ich Ida und Herbert ja auch für den ersten Weihnachtsfeiertag zum Mittagessen eingeladen. Du kannst ihnen deine Geschenke also getrost bei uns zu Hause überreichen, Mädel«, sagte sie nun zu ihrer Tochter gewandt.
Am Abend saß die Familie beim Schein der vier Kerzen des Adventskranzes in der Wohnstube und unterhielt sich über die Weihnachtszeit der vergangenen Jahre, doch Katharina musste nun berichten, wie denn die Menschen in Ostpreußen Weihnachten feiern.
»Ach, es ist dort gar nicht anders als bei uns. Mit meiner Wirtin haben wir Plätzchen gebacken und Pfefferkuchen, wir haben an den Nachmittagen bei Kerzenlicht am Kaffeetisch gesessen, in der Schule haben wir Weihnachtslieder gesungen und jeder hat die Adventszeit genossen. Marie bekommt Besuch von ihrem Sohn Georg, aber Wolfgang kann das Weihnachtsfest leider nicht bei seiner Mutter und seinem Bruder verbringen. Mit tut er leid, Weihnachten unter den Soldaten, und immer die Gefahr, angegriffen zu werden.«
Aus ihren Worten sprach die Sorge und Mutter Knieschitz machte sich Gedanken darüber, wie vertraut sie den Namen »Marie« aussprach und in welcher Stimmlage die Tochter über den Sohn der Vermieterin gesprochen hatte. Das war nicht nur die allgemeine Sorge um einen Menschen, da schien mehr dahinter zu stecken, doch sie würde Katharina nicht drängen, um dies von ihr zu erfahren. Irgendwann würde ihre Tochter sicher selbst darüber sprechen.
Am Heiligen Abend besuchte die Familie Knieschitz traditionell den Festgottesdienst in der evangelischen Kirche am anderen Ende der Rothehausstraße, einem relativ jungen Kirchenbau.
Das aus roten Backsteinen errichtete Kirchengebäude war erst um 1880 fertig gestellt worden. Ihre beiden Bronzeglocken wurden leider in der allgemeinen Kriegsbegeisterung des ersten Weltkrieges 1917 eingeschmolzen und der Rüstung zur Verfügung gestellt, was allerdings vom Pastor und einem großen Teil der Ehrenfelder Kirchengemeinde heftig bedauert wurde, weil es für sie einen Widerspruch zur christlichen Weltanschauung darstellte.
Nach dem Abendessen fand die Bescherung statt, die für Katharina noch immer den Höhepunkt des Heiligen Abends bildete. Sie war genauso aufgeregt, wie vor Jahren, als sie als kleines Mädchen mit leuchtenden Augen dem Verteilen der Gaben entgegen gefiebert hatte. Unter dem Weihnachtsbaum standen drei »bunte Teller«, die mit Nüssen, Zuckerkringeln, Plätzchen, kleinen Süßigkeiten und Äpfeln gefüllt waren. Doch das Schönste, auf den bunten Tellern war für jeden ein Schokoladenweihnachtsmann, umwickelt mit farbenfrohem Stanniolpapier, wie in Vorkriegszeiten.
»Wo Mutter wohl all die schönen Dinge aufgetrieben haben mag?«, wunderte sich Katharina.
Anschließend beschäftigte sich jeder mit seinen Geschenken und Vater Knieschitz, der ganz selten rauchte, brannte sich zur Feier des Abends eine gute Zigarre an. Seine Frau liebte den Duft, aber sie erlaubte ihrem Mann nur zu Festtagen, in der Stube zu rauchen, zu sehr befürchtete sie, dass durch den Qualm ihre Gardinen grau würden.
Katharina hatte von ihren Eltern eine goldene Kette mit einem goldenen Kreuz bekommen. Es soll sie als Glücksbringer beschützen, und sie eines Tages wieder gesund nach Hause bringen, wünschte ihr die Mutter. Außerdem erhielt sie ein schönes Buch über die Sagen des Rheingaus, das sie auch in der Fremde an ihre Heimat erinnern soll.
Am ersten Weihnachtstag kam eine stattliche Gans auf den Tisch. Der Vater hatte sie von einem Kollegen bekommen, der in Bocklemünd-Mengenich wohnte.
Satte dreizehn Pfund wog der sattliche Vogel und Frau Knieschitz hatte ihn nicht in die Röhre bekommen.
Vater Knieschitz musste die Gans also zerlegen, damit sie in der Ofenröhre brutzeln konnte.
Das Tier hatte zudem so viel Fett, dass Frau Knieschitz sogar eine kleine Tonschüssel mit Gänseschmalz davon füllte.
Ein paar klein gehackte Apfelstücke, ein paar geröstete Zwiebelwürfel und eine Prise Majoran verfeinerten den Geschmack zusätzlich.
Onkel Herbert hatte seine alte Lebensfreude wiedergefunden und machte seinem Kölner Humor alle Ehre, indem er die Familie mit Witzen über Tünnes und Schäl in rheinischem Dialekt und fast identischer Stimmenimitation unterhielt.
Er hatte in den letzten Wochen bei der guten Pflege seiner Frau ein paar Kilo zugenommen und sah mit seinem runden rotbäckigen Gesicht und seiner Knollennase fast selbst wie Tünnes aus. Sogar seine rötlichen Haare machten das Bild stimmig.
Auch Tante Ida hatte der wiederhergestellte Familienfrieden gut getan. Katharina fand sogar, dass ihre Tante weniger Falten im Gesicht hatte als früher, aber vielleicht war das nur Einbildung.
Natürlich musste sie auch Onkel und Tante genauen Bericht über ihren neuen Wohnsitz und ihre Arbeit erstatten.
Anschließend wurde die momentane Situation diskutiert, in der sich die Stadt befand. War es gefährlich in Köln zu bleiben, sollte man versuchen, bei Bekannten in den Außenbezirken unterzukommen, doch was würde inzwischen mit der Wohnungseinrichtung geschehen? Viele Fragen wurden gestellt, doch für die wenigsten fand sich eine Antwort.
»Ich gehe nicht von hier weg«, stellte Paul klar. »Mein ganzes Leben habe ich hier verbracht, da lasse ich mich nicht vom Tommy oder den Amis vertreiben.«
»Ja, ja, ist ja schon gut«, beschwichtigte seine Frau, »vielleicht lassen sie uns ja auch bald in Ruhe.«
»Das glaube ich nicht«, weissagte Onkel Herbert, »dafür haben unsere Truppen in England zu viel Unheil angerichtet. Wir können nur hoffen, dass wir mit heiler Haut davon kommen.«
»Ach, hört doch auf, über diese Dinge zu reden, es ist doch Weihnachten und vielleicht wird auch alles nicht so schlimm«, wollte Tante Ida das Thema beenden.
»Du hast recht, Ida! Soll ich uns Kaffee machen?«, entschärfte nun Mutter Knieschitz ihrerseits das Thema.
Vater Knieschitz nutzte die Gunst der Stunde und bot seinem Schwager eine Zigarre und einen Verdauungsschnaps an. Beides wurde von Herbert dankend angenommen.
Es erinnerte in dieser Familie an jenem Heiligen Abend wenig daran, dass sich Deutschland in einem gnadenlosen blutigen Krieg befand, der bereits über eine Million deutsche Soldaten gefordert hatte, doch es sprach niemand die Befürchtung aus, dass es das letzte gemeinsame Weihnachtsfest gewesen sein könnte.
Auch die folgenden zwei Weihnachtstage blieb die Bevölkerung Kölns von Bombenangriffen verschont.
Am Dienstag, dem neunundzwanzigsten Dezember, wurde die Familie allerdings auf den Boden der Realität zurückgeholt, denn gegen zwanzig Uhr schreckten die Sirenen die Einwohner Kölns auf, um sie vor einem Fliegerangriff zu warnen.
Obwohl Katharina die verheerenden Angriffe im Mai miterlebt hatte, und auch noch einige Angriffe danach, ehe sie zu ihrer neuen Arbeitsstelle nach Loditten reiste, war sie inzwischen von der Ruhe in Ostpreußen so verwöhnt, dass sie plötzlich furchtbare Angst verspürte. Die Bewohner der Häuser in der Rothehausstraße hasteten die Treppen des Hauses hinunter, um sich im Luftschutzbunker am Neptunplatz, der sich ganz in der Nähe ihrer Straße befand, in Sicherheit zu bringen.
In den Händen hielten sie Taschen oder kleine Koffer mit den wichtigsten Unterlagen oder Familienerinnerungen, manchmal auch eine Decke oder ein Proviantpaket und die Kinder trugen ihre Lieblingspuppen oder Teddys in ihren Armen.
Auf den Straßen herrschten chaotische Zustände, Menschen rannten panisch durcheinander. Auch Elfriede und Katharina Knieschitz liefen ängstlich aus der Wohnung.
Frau Knieschitz hatte die Tasche mitgenommen, in der sie alle wichtigen Papiere, das Sparbuch und ihren Schmuck verstaut hatte. Paul Knieschitz schloss noch eilig die Wohnungstür ab, ehe auch er die Treppe hinab zum Bunker eilte.
Inzwischen strömten die Bewohner der umliegenden Häuser in die unterirdischen Schutzräume und besetzten natürlich die sichersten Plätze an den dicken Längsmauern. Auf der Straße versuchte der Luftschutzwart, mit dröhnender Stimme Ordnung in das Durcheinander der hastenden Menschen zu bringen. Er trieb die Massen lautstark an, geordnet im Bunker Schutz zu suchen.
Kaum waren die Leute in die Bunkerräume geeilt, da war das Dröhnen und das Heulen der Bomben und Luftminen zu vernehmen. In einem der hinteren Räume hatte die Nachbarin von Familie Knieschitz an einer Längsmauer zwei Plätze für Elfriede und Katharina freigehalten. Direkt neben ihnen war der Eingang zur Gasschleuse, durch den sie bei einem Giftgasangriff schlüpfen konnten. Die Männer nahmen in den vorderen Räumen Platz. Die Menschen saßen eng zusammengedrückt auf Holzbänken und hofften, dass der Feuersturm sie verschonen würde.