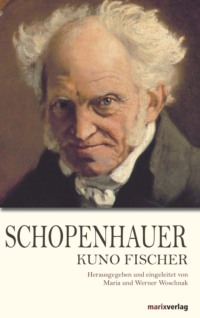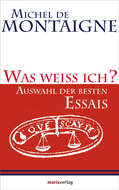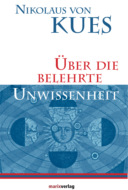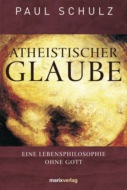Kitabı oku: «Schopenhauer», sayfa 12
III. Neue Schriften
1. Pläne
Schon zehn Jahre nach der Herausgabe des Hauptwerkes trug sich Schopenhauer mit dem Wunsch und Plan einer neuen zu vermehrenden Auflage, die in der Stille herangereift war; sie sollte den Manen des Vaters (»Piis patris manibus«) gewidmet sein, und er hat auf dieses Monument seiner kindlichen Liebe so viel künstlerische Sorgfalt verwendet, dass er die Dedikation dreimal umgeschrieben und erst in den Pandektä »einfach und kurz« festgestellt hat (1834).173
Auch die Vorrede zu der neuen im Plan befindlichen Auflage stand schon in den »Cogitata« (1833). Dann gedachte er die Vermehrungen in die Form »ergänzender Betrachtungen« zu fassen und in einem Supplementband dem Hauptwerke beizufügen. In den »Pandektä« findet sich der Entwurf zur Vorrede (1834).
Alle diese Pläne stießen auf die unüberwindlichen Hindernisse in dem beharrlichen Misserfolg des Hauptwerks. Wir kennen die Antwort, die ihm von Seiten der Verlagshandlung im November 1828 erteilt worden war. Als er jetzt nach sieben Jahren wieder anfragte, lautete die Antwort noch deutlicher und trostloser. Es sei in neuerer Zeit leider gar keine Nachfrage nach dem Werk gewesen; man könne ihm nicht verhehlen, dass man die Vorräte des Buchs, um wenigstens einigen Nutzen daraus zu ziehen, großenteils zu Makulatur habe machen lassen und nur noch eine kleine Anzahl zurückbehalten habe (1835).
Wollte er dennoch seine schriftstellerische Tätigkeit erneuern, so blieb ihm nichts übrig, als eine neue, von dem Hauptwerk unabhängige Schrift zu verfassen, den Plan aber einer zweiten Auflage oder eines nachträglichen Buchs ergänzender Betrachtungen, wenn nicht aufzugeben, doch auf unbestimmte Zeit zu vertagen.
2. Das neue Werk
Er ging sogleich ans Werk. Seine Absicht war, seine Lehre in nuce vorzutragen, den Kern derselben kürzer, bündiger, einleuchtender darzustellen, als es bisher geschehen sei und in einer anderen Schrift jemals geschehen könne. Die Erfahrungswissenschaften im Gegensatz zu der bisherigen Spekulation kamen ihm günstig entgegen und boten eine Reihe willkommener Anknüpfungspunkte. Er fand, dass die Naturwissenschaften mit Begriffen, wie Lebenskraft, Bildungstrieb, Grundkräften u. s. f., lauter unbekannten Größen, rechneten, die, bei Licht besehen, nichts anderes seien als Wille: der Wille in der Natur. In einem seiner glücklichsten Bilder verglich er Metaphysik und Physik mit Bergleuten, die im Schoß der Erde von weit entfernten Punkten aus Stollen graben und zusammenstoßen müssen, wenn sie richtig arbeiten. So verhalte es sich mit seiner Metaphysik und der induktiven Naturforschung der Gegenwart: sie kommen einander immer näher, schon höre man die gegenseitigen Hammerschläge. Das Büchlein hieß: »Über den Willen in der Natur. Eine Erörterung der Bestätigungen, welche die Philosophie des Verfassers seit ihrem Auftreten durch die empirischen Wissenschaften erhalten hat.«174
In der »Einleitung« macht er seinem Grimm wider die Philosophie der Gegenwart Luft: hier hat er sich zum ersten Mal gegen Hegel, die Philosophieprofessoren und die Universitätsphilosophie in Schmähungen ergossen, die fortan das ständige Thema seiner polemischen Bravourarien ausmachen sollten. Er tröste sich mit der Zeit, welche die Wahrheit ans Licht und zu Ehren bringen werde. Schon in dem »Prooemium« seiner lateinischen Farbenlehre hieß es: »Tempo è galantuomo«. Auf das Titelblatt dieser neuen Schrift setzte er Worte des gefesselten Prometheus des Äschylus, der über die Missachtung seiner Lehren und Werke klagt: »ἀλλ᾽ ἐϰδιδάσϰει πάνϑ᾽ ὁ γηράσϰων χρόνος«.
Während Schopenhauer sein Büchlein über den Willen in der Natur schrieb, erschien das Leben Jesu von Dav. Fr. Strauß (1835), ein Werk, welches bekanntlich nicht bloß in der gelehrten, sondern in der ganzen gebildeten Welt eine ungeheure Sensation hervorrief und auf dem Gebiet der biblischen Theologie und des Schriftglaubens eine Epoche gemacht hat, die in ihren Folgen noch heute fortwirkt. Gleichzeitig erschien in der gleichen Richtung »Die Religion des Alten Testamentes« von Wilhelm Vatke in Berlin; das Strauß’sche Werk, in zwei starken Bänden, erlebte in vier Jahren vier Auflagen. Es folgten Bruno Bauer mit seiner »Kritik der Synoptiker«, Ludwig Feuerbach mit seinem »Wesen des Christentums« u. s. f. Die Welt war von religionsphilosophischen und religionshistorischen Fragen, die zu den interessantesten und wichtigsten der Menschheit gehören, und von den Parteikämpfen für und wider erfüllt.
Von allen diesen Erschütterungen hat Schopenhauer in seiner Frankfurter Klause kaum etwas gespürt. Beigetragen oder mitgewirkt dazu hat er nichts. Kann er sich wundern, dass er ungehört blieb? In seinen späteren Schriften finden sich einige Stellen, aus denen hervorgeht, dass er von Strauß’ Leben Jesu Kenntnis genommen und dieser Art der Bibelkritik Verbreitung in England gewünscht, dass er die Anwendung der mythologischen Erklärungsart auf die Evangelien gebilligt und in Ansehung der asketischen Grundsätze der Ehelosigkeit und Armut, welche aus dem evangelischen Abbild der Lehre Jesu erkennbar seien, sich auf die kritischen Untersuchungen und Urteile von Strauß berufen hat.
Wusste er nicht, dass Strauß, der nach Berlin gekommen war, hauptsächlich, um Hegel zu hören, ein Schüler und Verehrer der Hegel’schen Philosophie gewesen und auf seine Art stets geblieben ist? Auch Vatke war Hegelianer. Auch Straußens Freund und Schulgenosse, der Ästhetiker Fr. Th. Vischer, war Hegelianer; auch ihr Lehrer Ferdinand Christian Bauer, der Begründer der Tübinger Schule und Theologie, war von dem Einfluss der Hegel’schen Philosophie ergriffen. Wer von den wirksamsten Denkern und Schriftstellern jener Zeit war es nicht?
Schopenhauer aber, als ob er wie der Vogel Strauß den Kopf in den Sand gesteckt hielt und von allem, was geschah, nichts sah und hörte, nannte in der oben erwähnten Einleitung die Hegelianer ohne Unterschied »die ergötzlichen Adepten der Hegel’schen Mystifikation«, und die hegelsche Lehre »die Philosophie des absoluten Unsinns, wovon drei Viertel bar und ein Viertel in aberwitzigen Einfällen« bestehe; er verglich sie »dem Tintenfisch in der Wolke mit der Umschrift: mea caligine tutus!« Kann man sich wundern, dass diese hohlen und leeren Worte, so farbig sie waren, damals wie Seifenblasen zerflossen und erst auf ein nachlebendes Geschlecht, das von allen diesen Dingen nichts mehr wusste und sich mit ein paar effektvollen Phrasen sehr gern von sehr schwierigen Studien loskaufte, etwas von dem gewünschten Eindruck hervorbrachten!
3. Zwei Gelegenheitsschriften. Goethe und Kant
Wir wissen ja, dass in seinen Augen es in Deutschland nur zwei Genies allerersten Ranges gab: Kant und Goethe. Nun traf es sich gleichzeitig (1837), dass Goethe in und von Frankfurt das erste Denkmal errichtet und dass in Königsberg die erste Gesamtausgabe der Werke Kants durch Karl Rosenkranz und Wilhelm Schubert veranstaltet werden sollte. In jeder der beiden Angelegenheiten ergriff Schopenhauer das Wort, aus freien Stücken, aus rein sachlichem und sachkundigem Eifer.
Über das Goethe-Monument richtete er an das neu gegründete Komitee ein »Gutachten«, worin er die Beweggründe seiner Ratgebung, die leitenden Grundsätze, den Plan und die Ausführung des Denkmals darlegte. Es sei zu verhüten, dass der Unverstand und Ungeschmack öffentliche und kostbare Werke verunstalte. In der Inschrift des neuen Bibliothekgebäudes habe man in vier lateinischen Worten drei Fehler gemacht175; in der Städel’schen Sammlung seien die roten und gelbroten Wände in den Sälen der vortrefflichen Gipsabgüsse ein Zeugnis der Geschmacklosigkeit und Barbarei. Das zu errichtende Denkmal müsse erhaben sein, darum einfach. Männer, welche die Welt durch ihr Genie, d. h. durch die Werke des Kopfs erleuchtet haben, wie die Denker und Dichter, seien der Nachwelt nicht durch Statuen, sondern durch Büsten zu vergegenwärtigen, so haben es in der Regel die Alten und in der neuen Zeit die Italiener gehalten, die darin den richtigen Geschmack zeigen im Gegensatz zu den Engländern und Deutschen. Die Büste Goethes auf einem angemessenen Postament, von hohen schattigen Bäumen umgeben, möge so kolossal sein, wie die Mittel es erlauben, die Inschrift sei lakonisch: »Dem Dichter der Deutschen seine Vaterstadt 1838«. Keine Silbe mehr! Der Name, der sonst immer genannt wird, werde hier nicht genannt, er versteht sich von selbst. Eben dadurch ehre man den einzigen Mann auf eine einzige Weise. – Er hatte diesen Rat erteilt, »mit vollkommenster Resignation darin ergeben, dass er unberücksichtigt bleiben werde, wie dies dem Weltlauf gemäß und in der Ordnung« sei. Der Weltlauf hat recht behalten.
Es ist sonderbar genug, dass sich nirgends eine Angabe darüber zu finden scheint, wann Schopenhauer die erste Ausgabe der Kritik der reinen Vernunft kennen gelernt hat, die ihm völlig unbekannt war, als er seine Kritik der kantischen Philosophie schrieb und seinem Hauptwerk einverleibte. Diese Kritik gründete sich auf die zweite oder, was in der Sache gleichbedeutend ist, fünfte Auflage des Werks (1799). Zwar hatte Fr. Heinr. Jacobi schon im Jahre 1815 auf den beträchtlichen Unterschied der beiden Ausgaben, die Weglassungen in der zweiten, die Vorzüge der ersten und die Seltenheit ihrer Exemplare sehr nachdrücklich aufmerksam gemacht, aber diese Belehrung hat Schopenhauer nicht gekannt, sonst würde er wohl darauf hingewiesen haben. Ich vermute, dass er die Vernunftkritik vom Jahre 1781 erst in der zweiten Hälfte des Jahres 1829 gelesen hat, als er so eifrig mit dem Plan umging, das Werk ins Englische zu übersetzen. Zu diesem Zwecke musste er die beiden Ausgaben vergleichen.
Jetzt zeigte sich, dass seine Kritik auf die erste Ausgabe passte wie die Faust aufs Auge. In der Widerlegung der rationalen Psychologie hatte die erste Ausgabe die durchgängige Idealität der Körperwelt (d. i. die idealistische Grundansicht) auf das unzweideutigste ausgesprochen und die Unmöglichkeit der ganzen Lehre von der Substantialität oder Wesenheit, der Einfachheit, Unkörperlichkeit und der ihrer selbst gewissen Realität der Seele bewiesen. Von diesen Ausführungen aber waren die wichtigsten in der zweiten Auflage weggelassen worden, nicht weniger als 57 Seiten; dagegen fand sich eine »Widerlegung des Idealismus«, die in der ersten Auflage fehlte. Jene Weglassung glich dem amputierten Bein, diese Hinzufügung dem hölzernen. Schopenhauer fand, dass die Kritik der reinen Vernunft in der zweiten Ausgabe ein sich selbst widersprechendes, verstümmeltes, verdorbenes Buch geworden sei und einen gewissermaßen unechten Text biete. Die neue Widerlegung des Idealismus sei »so grundschlecht, so offenbare Sophisterei, zum Teil sogar so konfuser Gallimathias, dass sie ihrer Stelle in dem unsterblichen Werke ganz unwürdig erscheine. Kants eigene Verschlimmbesserung habe das Missverstehen der Kritik, welches Anhänger und Gegner sich gegenseitig vorwerfen, zur Folge gehabt, denn wer könne verstehen, was widersprechende Elemente in sich tragen?
Zweifache Furcht habe den Königsberger Philosophen zu einer solchen Verunstaltung seines Werks bewogen: einmal die Besorgnis für die eigene Originalität, da man seine Lehre in ihrer ursprünglichen Gestalt für Berkeley’schen Idealismus erklärt hatte, dann wegen der Zerstörung der rationalen Psychologie die Angst vor dem Nachfolger Friedrichs des Großen und seiner Regierung. So richtig Schopenhauers Urteil über die Verschiedenheit und den Wert der beiden Ausgaben ist, so unrichtig ist seine Ansicht von dem Charakter, der Altersschwäche und Untertanenfurcht Kants.
Die volle Übereinstimmung seiner eigenen Lehre und ihrer idealistischen Grundansicht mit der kantischen Vernunftkritik in ihrer eigentlichen und wahren Gestalt musste jener zur Hebung gereichen. Deshalb lag ihm so viel daran, dass in der ersten Gesamtausgabe der Werke Kants die Kritik der reinen Vernunft vom Jahre 1781 als der Grundtext behandelt werde. Zu diesem Zwecke richtete er den 14. August 1837 an Karl Rosenkranz, den philosophischen Mitherausgeber, einen der angesehensten Schüler Hegels, ein ausführliches Schreiben, worin er die beiden Ausgaben verglich und mit allen den Gründen, die schon erörtert sind, die Bedeutung der ersten ans Licht stellte. Die Herausgeber haben seinen Rat befolgt und mit einigen kleinen, unmotivierten Auslassungen und Änderungen sein Schreiben abdrucken lassen.176
4. Zwei Preisschriften. Die Grundprobleme der Ethik
Die schriftstellerischen Pläne des Philosophen blieben auf die Erneuerung seines Hauptwerks gerichtet, das der Vermehrung und Ergänzung, auch in manchen Punkten neuer Begründungen und Erläuterungen bedurfte. Der dazu angesammelte Ideenvorrat lag bereit; die jüngste Schrift »über den Willen in der Natur« war dem zweiten Buch, welches die Lehre von der »Objektivation des Willens« enthielt, zustatten gekommen. Nun würde es sich auf das beste gefügt haben, wenn er eine solche dem Hauptwerk dienende und doch von ihm unabhängige Schrift auch zu dem vierten Buch, welches die Lehre von der »Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben bei erreichter Selbsterkenntnis« d. h. die Ethik enthielt, hätte schreiben können.
Da kam es ihm wie gerufen, dass eben jetzt zwei skandinavische Akademien Preisaufgaben verkündet hatten, welche die Grundfragen der Ethik betrafen und mit dem Thema seines vierten Buchs auf das genaueste zusammenhingen. Die königlich norwegische Sozietät der Wissenschaften zu Drontheim hatte gefragt: »Num liberum hominum arbitrium e sui ipsius conscientia demonstrari potest?« Deutsch nach Schopenhauer: »Lässt die Freiheit des menschlichen Willens sich aus dem Selbstbewusstsein beweisen?«
Die königlich dänische Sozietät der Wissenschaften zu Kopenhagen hatte nach einer vorangeschickten, weitläufigen und unklaren Einleitung die Frage aufgestellt: »Philosophiae moralis fons et fundamentum utrum in idea moralitatis, quae immediate conscientia contineatur, et ceteris notionibus fundamentalibus, quae ex illa prodeunt, explicandis quaerenda sunt, an in alio cognoscendi principio?« Deutsch nach Schopenhauer: »Ist die Quelle und Grundlage der Moral zu suchen in einer unmittelbar im Bewusstsein (oder Gewissen) liegenden Idee der Moralität und in der Analyse der übrigen, aus dieser entspringenden moralischen Grundbegriffe, oder aber in einem andern Erkenntnisgrund?« Die Frage der norwegischen Akademie ging auf die Freiheit des Willens, die der dänischen auf die Grundlage der Moral. Die Verkündigung der ersten hatte in der Hallischen Literaturzeitung vom April 1837, die der zweiten in derselben Zeitschrift vom Mai 1838 gestanden. Dort hatte sie Schopenhauer gelesen.
Die Abhandlung über die menschliche Willensfreiheit mit dem Motto: »La liberté est un mystère« wurde in Drontheim den 26. Januar 1839 mit dem ersten Preise gekrönt und der Verfasser zugleich zum Mitglied der königlich norwegischen Sozietät der Wissenschaften ernannt. Es war die erste öffentliche Anerkennung, die dem einundfünfzigjährigen Mann zuteil wurde. Die deutsche Zuschrift der Akademie beantwortete er in einem lateinischen Danksagungsschreiben (28. September 1839), worin er das Wort Petrarcas auf sich anwandte: »Si quis toto die currens pervenit ad vesperam, satis est«. Er hat dieses Wort, das Motto seiner Spicilegia, oft gebraucht und sich damit getröstet: »Wenn einer den ganzen Tag über läuft und gegen Abend ans Ziel gelangt, so ist es genug«.
Als er die Abhandlung nach Drontheim gesandt hatte, ging er sogleich an die Bearbeitung des dänischen Themas. Sobald er die Nachricht von der Krönung der Schrift und seiner Erwählung zum Mitglied der Sozietät erhalten hatte (Februar 1839), schickte er die neue Abhandlung nach Kopenhagen, mit dem seinem Buch »über den Willen in der Natur« entlehnten Motto: »Moral predigen ist leicht, Moral begründen schwer«. Der verschlossene Brief mit seinem Namen sollte erst nach zuerkanntem Preise eröffnet werden. Hier stand zu lesen: dass für eine Arbeit von verwandtem Thema die königlich norwegische Sozietät der Wissenschaften zu Drontheim ihm die große Medaille und das Diplom ihrer Mitgliedschaft erteilt habe, dass er auf die Ehre der zweiten Art ein größeres Gewicht lege als auf die der ersten, und dass er die beiden Abhandlungen nunmehr unter dem gemeinsamen Titel herauszugeben wünsche: »Die beiden Grundprobleme der Ethik, in zwei gekrönten Preisschriften gelöst«.177
Vergebens harrte er auf die Siegesbotschaft. Als er sich endlich nach dem Ausgang erkundigte, wurde ihm die Antwort erteilt, dass den 30. Januar 1840 das Urteil gefällt und seine Arbeit des Preises nicht für würdig erachtet worden sei: er habe den Zielpunkt der Aufgabe außer Acht gelassen und anhangsweise behandelt, was er als Hauptsache hätte behandeln solle: den Zusammenhang des Prinzips der Ethik mit dem der Metaphysik; er habe als Prinzip der Ethik das Mitleid aufgestellt, aber weder die zureichende Geltung desselben bewiesen, noch durch die Art seiner Darstellung den Preisrichtern genügt; endlich wolle man nicht verschweigen, dass man an den ungeziemenden Ausdrücken, in denen er von einigen der angesehensten Philosophen der Zeit geredet habe, gerechten und ernsten Anstoß genommen.
Nunmehr veröffentlichte er beide Abhandlungen unter dem gemeinsamen Titel: »Die beiden Grundprobleme der Ethik, behandelt in zwei akademischen Preisschriften von Dr. Arthur Schopenhauer, Mitglied der königlich norwegischen Sozietät der Wissenschaften. I. Über die Freiheit des menschlichen Willens, gekrönt von der königlich norwegischen Sozietät der Wissenschaften zu Drontheim am 26. Januar 1839. II. Über das Fundament der Moral, nicht gekrönt von der königlich dänischen Sozietät der Wissenschaften zu Kopenhagen, den 30. Januar 1840.«178
Das Urteil der dänischen Akademie hatte ihn auf das bitterste enttäuscht und in einen Aufruhr von Ärger versetzt, dem er nun in der »Vorrede« ungezügelten Lauf ließ. Dass seine klare und bündige Auslegung des Themas nicht als richtig befunden wurde, hatten die Preisrichter selbst durch die unsichere und etwas missverständliche Fassung desselben verschuldet. Unter den Gründen wider ihn war der triftigste, dass er Männer wie Fichte, Schelling und Hegel auf schmähsüchtige Art erwähnt hatte. Gerade diese Philosophen zählten damals unter den dänischen Akademikern Anhänger und Verehrer. Ich nenne nur den einen: Hans Christian Oersted, den Entdecker des Elektromagnetismus. Selbst wenn eine Abhandlung wegen ihres wissenschaftlichen Wertes den Preis verdient, kann eine Akademie ihr denselben unmöglich erteilen, wenn sie genötigt sein soll, Schmähungen, die sie verwirft, mitzukrönen. In einer solchen Lage sah sich die dänische Akademie dem Bewerber gegenüber und war mit diesem Grund wider ihn ganz in ihrem Recht.
Aber gerade dieser Tadel mit der Hinweisung auf die »summi philosophi« hatte ihn am meisten erbost. Was nach seiner Ansicht die dänische Akademie an ihm gesündigt hatte, sollte nun Hegel entgelten, gegen den sich die Vorrede in einer wirklich tollen Kapuzinade erging. Fichte, der in der Abhandlung selbst »so ein Windbeutel« genannt war, gilt hier mit einmal als »ein Talentmann«, der hoch über Hegel stehe, »diesem sehr gewöhnlichen Kopf, sehr ungewöhnlichen Scharlatan, diesem Philosophen mit seinem falschen, erschlichenen, gekauften, zusammengelogenen Ruhm, diesem Absurditätenlehrer, diesem Papier-, Zeit- und Kopfverderber, dessen Philosophie, die Apotheose des Unsinns, einen höchst verderblichen, verdummenden, pestilenzialischen Einfluss auf die deutsche Literatur ausgeübt habe«. Um solche Beschimpfungen zu erhärten, wurden aus dem naturphilosophischen Teile der Hegel’schen Enzyklopädie drei Beispiele angeführt: in dem ersten habe er in der zweiten Schlussfigur positiv geschlossen, in dem zweiten der Trägheit die Gravitation entgegengesetzt und in dem dritten die Vergänglichkeit der Materie behauptet.
Wie vor fünf Jahren in der Einleitung seiner Schrift »Über den Willen in der Natur«, so verhallten auch die Schmähungen dieser Vorrede, obwohl ihre Keile verstärkt waren, völlig ungehört. Unterdessen stand die Hegel’sche Philosophie in vollster Blüte und übte in den »Hallischen Jahrbüchern«, die unter A. Ruge und Th. Echtermeyer eine Menge der tüchtigsten schriftstellerischen Kräfte ins Feld führten, einen herrschenden Einfluss in der Tagesliteratur. Man mochte diesen Einfluss bekämpfen und beklagen, aber denselben »verdummend« nennen konnte nur die blinde und ohnmächtige Wut.179
Es gehörte die damalige weite Verbreitung der philosophischen Interessen infolge des Einflusses der Hegel’schen Philosophie dazu, dass zwei gelehrte Gesellschaften im Norden auf den Gedanken kamen, rein philosophische Themata, wie die Fragen über die menschliche Willensfreiheit und die Grundlage der Moral, als Preisaufgaben zu verkünden. Schopenhauer selbst, über die Seltenheit solcher Aufgaben erstaunt, sagt in seiner Vorrede: er habe beide Fragen »pour la rareté du fait« beantwortet; die dänische Akademie hätte sich hüten sollen, eine so hohe, ernste, bedenkliche Frage zu stellen. »Denn hinterher, nachdem auf eine ernste Frage eine ernste Antwort eingegangen, ist es nicht mehr an der Zeit, sie zurückzunehmen. Und wenn einmal der steinerne Gast geladen worden, da ist bei seinem Eintritt selbst Don Juan zu sehr ein Gentleman, als dass er die Einladung verleugnen solle.«
Er verglich sich außerordentlich gern mit dem steinernen Gast. Als er zehn Jahre später einem Professor und Hegelianer von großem Ruf auf dessen höfliche, wohl etwas scheue Bitte seinen Lebensabriss schickte, berichtet er diese Begebenheit an Frauenstädt mit den Worten: »Tritt er im Briefe nicht zu mir ein wie ein athenischer Jüngling zum Minotaur? oder Leporello mit ›Du Bild von Erz und Steine, mir zittern die Gebeine‹?« Noch lieber verglich er sich mit dem Montblanc, wenn er in der Morgensonne strahlt; am liebsten mit der Sonne selbst.
Nicht bloß die Vorrede blieb unbeachtet, sondern das ganze Buch. In keiner Literaturzeitung wurde es besprochen oder auch nur erwähnt. Und es war, sachlich genommen, ein höchst interessantes, geistvolles und lehrreiches Werk.180