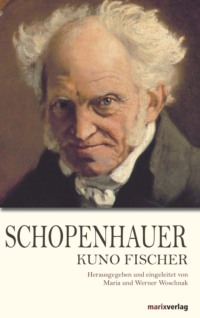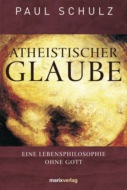Kitabı oku: «Schopenhauer», sayfa 11
3. Der Rückblick
Diese kleinen Erquickungen abgerechnet, vermochten die letzten acht Jahre dem vierzigjährigen Mann, wenn er am 22. Februar 1828 darauf zurückblickte, keine zufriedenen Eindrücke zu bieten. Wo er hinsah, traten ihm Mängel und Verluste, Misserfolge und hoffnungslose Aussichten entgegen. Seine persönlichen Familienverhältnisse, die beiden einzigen, die er auf der Welt hatte, waren gründlich zerrüttet; seine Lehrtätigkeit hatte aufgehört, bevor sie eigentlich erst angefangen; die Hälfte jenes wiedererkämpften Vermögens war durch schlechte Anlagen, die ihm ein guter Freund geraten, verloren gegangen (1827); die Absichten auf ein akademisches Lehramt, die sich erst nach Würzburg, dann nach Heidelberg gerichtet hatten, waren vergeblich gewesen, die letztere wurde durch die Antwort, die ihm Creuzer im März 1828 erteilte, völlig niedergeschlagen.162
Alle seine Hoffnungen ruhten auf seinem Hauptwerk. Als er sich jetzt nach dem Erfolg desselben erkundigte, musste er zehn Jahre nach der Herausgabe erfahren, dass eine »bedeutende Anzahl« Exemplare makuliert worden, der Absatz stets »sehr unbedeutend« gewesen und noch 150 Exemplare vorrätig seien (29. November 1828). Von diesem geringen Vorrat wurden im Jahre 1830 noch 97 Exemplare eingestampft, und von den 53 übriggebliebenen waren dreizehn Jahre später (1843) »noch genug für die Nachfrage vorhanden«.163 So stand es mit dem Erfolg seines Hauptwerks nach einem Vierteljahrhundert!
In die Mitte aller dieser Widerwärtigkeiten war noch ein höchst unwürdiger, ärgerlicher und nachteiliger Rechtshandel gefallen. Eine bejahrte Näherin, die im Vorraum seiner Wohnung sich unbefugterweise aufgehalten und auf sein Verbot nicht gewichen war, hatte er unter gröblichen Schimpfreden hinausgeworfen, wobei die Frau zu Boden gefallen war und einigen Schaden erlitten hatte. Ihre Klage war in erster Instanz abgewiesen worden. Dann aber durchlief der Prozess, in welchem von beiden Seiten appelliert wurde, alle Instanzen und endete damit, dass Schopenhauer zur Alimentation der Klägerin verurteilt und dieses Urteil endgültig bestätigt wurde. Er musste der Klägerin 15 Taler vierteljährlich zahlen, und da dieselbe noch zwanzig Jahre fortlebte, so hat ihm dieser Akt einer heftigen und rohen Selbsthilfe 1200 Taler gekostet! Als er endlich die offizielle Todesnachricht empfangen hatte, schrieb er auf den Brief: »obit anus, abit onus!«164
Hätte er sich in wohlgeordneten häuslichen Verhältnissen befunden, so würde eine solche Szene, wie die mit der Näherin, unmöglich gewesen sein; aber er wollte, gleich den Philosophen, die bei ihm hoch in Ansehen standen, wie Hobbes und Locke, Descartes und Kant, Hagestolz bleiben und pflegte weniger treffend als witzig zu sagen, dass die Ehemänner umgekehrte Papagenos wären; während dem Papageno in der Zauberflöte sich ein altes Weib blitzschnell in ein junges verwandle, ginge es in der Wirklichkeit den Ehemännern gerade umgekehrt. Das Gleichnis zeigt, wie er von der Ehe dachte. Er hat die Heirat, nicht die Weiber vermieden, die nach seinen eigenen Worten ihm viel zu schaffen gemacht haben: er hat sich seiner Hamburger Jugendsünden geschämt, in Dresden einen natürlichen Sohn gehabt, der früh gestorben ist, in Venedig eine Geliebte im Stich gelassen und in Berlin »in zarten Beziehungen zu einer dem Theater angehörenden Dame gestanden«, die er noch in seinem Testamente bedacht hat.165 In seinen späteren Schriften erscheint er, wie es dem Pessimisten ziemt, als der ausgemachteste Misogyn.
III. Literarische Pläne und Arbeiten
1. Übersetzungspläne
So sah sich unser Philosoph auf ein einsames, der Meditation und den literarischen Beschäftigungen gewidmetes Leben angewiesen. Auch in dieser Hinsicht war die Berliner Periode bisher steril geblieben. Während seines letzten Aufenthaltes in Dresden hatte er den Plan gehabt, einige Schriften des englischen Philosophen David Hume und des italienischen Philosophen Giordano Bruno ins Deutsche zu übersetzen; bei diesem hatte er die Schrift »Della causa, principio ed uno«, bei jenem »The natural history of religion« und »Dialogues on natural religion« ins Auge gefasst, da man aus einer Seite von Hume mehr lernen könne als aus sämtlichen Werken von Schleiermacher, Hegel und Herbart (1824).
Angemessener aber und seiner würdiger war es, wenn er, der deutsche Philosoph, dem die englische Sprache beinahe zur zweiten Muttersprache geworden, den größten aller deutschen Philosophen ins Englische übersetzte. Er war daher lebhaft überrascht und erfreut, als er in der »Foreign Review« einem Artikel über Damirons Geschichte der Philosophie in Frankreich begegnete (Juli 1829), worin der Wunsch nach einer englischen Übersetzung der Hauptwerke Kants ausgesprochen wurde. Der ungenannte Verfasser des Artikels war Francis Haywood in Liverpool. An diesen schrieb Schopenhauer und legte ihm, einleuchtend und wohlgeordnet, alle Gründe dar, aus denen er bereit sei, das gewünschte Werk auszuführen: Deutschland habe während des letzten Jahrhunderts zwei Genies wahrhaft ersten Ranges hervorgebracht: Kant und Goethe; die vielgenannten Nachfolger Kants seien mit diesen nicht zu vergleichen, und der gegenwärtige Philosoph, der von sich reden mache, Hegel, »a mere swaggerer and charlatan«. Die Deutschen seien unfähig, Kant zu verstehen und zu würdigen; die Engländer dagegen wären es imstande, denn sie seien die intelligenteste Nation in Europa; freilich sei das Verständnis Kants sehr schwierig, denn seine Meditationen wären die tiefsinnigsten, die je in eines Menschen Kopf gekommen. Nun habe er sein Leben metaphysischen Betrachtungen gewidmet und seit zehn Jahren als Lehrer der Logik und Metaphysik der Berliner Universität angehört, wie deren Lektionsverzeichnisse ausweisen; der geniale Jean Paul habe sein Werk ein genial philosophisches, kühnes, vielseitiges Werk voll Scharfsinn und Tiefsinn genannt; und von allen Schriften über Kants Lehre, die sich auf tausend belaufen, habe der Theologe Baumgarten-Crusius in seiner christlichen Sittenlehre nur zwei hervorgehoben: Reinholds Briefe über die kantische Philosophie und die Kritik der letzteren von Schopenhauer.166
Man möge die Sache nicht fallen lassen, mahnte er in einem späteren Brief an die Verleger der Zeitschrift, denn es könne ein Jahrhundert vergehen, bevor in einem und demselben Kopf so viel kantische Philosophie und so viel Englisch zusammentreffen, wie in dem seinigen. Und darin hatte er vollkommen recht. Nur die Hinweisung auf seine akademische Lehrtätigkeit und die Berliner Lektionsverzeichnisse macht einen etwas wunderlichen und seiner Wahrheitsliebe nicht gerade günstigen Eindruck, denn in diesen Verzeichnissen stand freilich nicht zu lesen, dass er seine »zehnjährige Lehrtätigkeit« nur während eines Semesters ausgeübt hatte.
Als die zu übersetzenden Hauptwerke Kants bezeichnete er in erster Reihe die »Kritik der reinen Vernunft«, die »Prolegomena« und die »Kritik der Urteilskraft«, in zweiter die »metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft« und die »Kritik der praktischen Vernunft«. Für die Übersetzung der Vernunftkritik forderte er ein Jahr, für die der Prolegomena drei Monate. – Haywoods ungereimten Gegenvorschlag, dass er übersetzen wolle, Schopenhauer die Übersetzung korrigieren möge, ließ er unerwidert. Alle weiteren Schritte, die er zur Herstellung dieser ihm so wichtigen Sache teils bei dem Verleger der Review, teils bei dem Dichter Thomas Campbell noch versucht hat, blieben erfolglos.
2. Übersetzungswerke
Statt der Werke Kants ins Englische übersetzte er ein spanisches Büchlein ins Deutsche: es war ein Schatz von dreihundert Regeln der Welt- und Lebensklugheit, welchen aus den Werken des berühmten Balthasar Gracian, Jesuitenrektors in Tarragona, dessen Freund Lastanosa gesammelt und als Handorakel: »Oraculo manuel y arte de prudencia« herausgegeben hatte (1653). Schopenhauer wollte seine dem Geist und Stil des Originals angepasste Übersetzung unter dem Namen Felix Treumund herausgeben und hatte auch mit dem Professor Keil in Leipzig schon Verhandlungen darüber angeknüpft (1832), die wohl zur Herausgabe geführt hätten; aber er gab die Absicht der letzteren auf, da er die Übersetzungskunst zu wenig geschätzt sah.167
Der Gegenstand einer zweiten Übersetzung war eines seiner eigenen Werke. Damit die Schrift »über das Sehn und die Farben«, die doch einiges Aufsehen erregt hatte, auch im Auslande bekannt werde, hielt er es für zweckmäßig, dieselbe ins Lateinische zu übertragen und in der Sammlung der »Scriptores ophthalmologici minores«, die Justus Radius in Leipzig herausgab, einrücken zu lassen. Er schrieb deshalb an den Herausgeber (März 1829), und die Sache wurde so eingerichtet, dass die Schrift unter dem Titel »Theoria colorum physiologica eademque primaria« in dem dritten Bande der »Scriptores« als dessen erstes Stück erschien (1830).
In dem Brief an Radius und in der Abhandlung selbst hatte Schopenhauer darauf hingewiesen, dass die Sensualisten, wie Locke und Condillac, nicht imstande gewesen wären, die Gesichtswahrnehmung zu erklären, da sie den Unterschied zwischen Eindruck und Wahrnehmung, zwischen Sensation und Anschauung nicht erkannt und daher beide für dasselbe gehalten hätten. Diesen Unterschied habe erst Kant entdeckt und dargetan, daher seine Philosophie sich zu der sensualistischen verhalte wie die Analysis zu den vier Spezies.
Nicht ohne Bewunderung sehen wir diesen Mann vollkommen gerüstet, in derselben Zeit ein spanisches Buch ins Deutsche, die schwierigsten und tiefsinnigsten Werke der deutschen Philosophie ins Englische und eine seiner eigenen Schriften, welche keineswegs zu den leichteren gehörte, ins Lateinische zu übersetzen. Zu der Kenntnis dieser vier Sprachen kam bei ihm noch die der französischen in gleicher Vollkommenheit, dann die der griechischen und italienischen Sprache.
Fünftes Kapitel
Der erste Abschnitt der Frankfurter Periode (1831 – 1841)
I. Die Übersiedlung nach Frankfurt
1. Traum und Flucht
In der Neujahrsnacht von 1831 hatte Schopenhauer, den wir als einen traumgläubigen Philosophen noch werden kennen lernen, ein Traumgesicht, das er sich als eine bedeutungsvolle Warnung auslegte: er sah seinen Vater und einen früh verstorbenen Spielkameraden aus den Tagen seiner Hamburger Kindheit vor sich und glaubte, dass diese Erscheinung eine im neuen Jahr ihm bevorstehende Todesgefahr bedeute. Als nun die Cholera herannahte, verließ er Berlin im August 1831 und begab sich nach Frankfurt am Main. Diese Flucht galt ihm als die Rettung aus der Gefahr, vor der jener Traum ihn gewarnt habe.
Er kam in den ersten Tagen des September und blieb bis in den Juli des folgenden Jahres. Dieser erste Aufenthalt in Frankfurt war womöglich noch trauriger als acht Jahre vorher sein Leben in München; er fühlte sich niedergedrückt und verdüstert, auch durch körperliche Leiden, und lebte so ungesellig, dass Monate vergingen, bevor er jemand sah, mit dem er sprach.
2. Annäherung an Mutter und Schwester
In dieser völligen Vereinsamung rührte sich die Sehnsucht nach den Seinigen, die seit kurzem (Juli 1829) aus Rücksichten der Ökonomie und Gesundheit Weimar verlassen hatten und an den Rhein gezogen waren, wo sie in ihrem Landhaus zu Unkel bei Bonn den Sommer und in Bonn selbst den Winter zubrachten. Eben war der Umzug nach Bonn zum zweiten Mal geschehen, als Adele Nachrichten von der Hand des Bruders empfing, der seit zehn Jahren für sie, seit siebzehn für die Mutter verstummt war. Sie antwortete sogleich, liebevoll und nachgiebig (Oktober 1831), wie sie auch schon vor Jahren bei ihrem gemeinsamen Freunde Osann, damals Professor der klassischen Philologie in Jena, besorgt und schmerzlich nach ihm geforscht hatte. Da sie der Mutter über den erneuten Briefwechsel Mitteilungen machen durfte, so schrieb auch diese wieder an den Sohn, und das unselige Missverhältnis hat wenigstens nicht in seiner vollen Schroffheit bis an das Ende fortbestanden; doch hat ein Wiedersehn, welches Adele sehnlichst gewünscht, nicht stattgefunden, obwohl es bei der räumlichen Nähe leicht zu bewerkstelligen war.
Das Leben der Schwester scheint nach jenem plötzlichen Glückswechsel sich immer mehr vereinsamt zu haben und ist von schwermütigen Stimmungen erfüllt, die sich in ihrem Brief aussprechen; sie macht dem Bruder Bekenntnisse, die in den ökonomischen Differenzen, welche früher obgewaltet hatten, ihm Recht geben. Sein damaliger Gemütszustand erhellt aus dem Brief der Mutter vom 20. März 1832: »Was Du über Deine Gesundheit, Deine Menschenscheu, Deine düstere Stimmung schreibst, betrübt mich mehr, als ich Dir sagen kann und darf. Du weißt, warum. Gott helfe Dir und sende Dir Licht und Mut und Vertrauen in Dein umdüstertes Gemüt.«168
Noch stand es bei ihm keineswegs fest, dass er Berlin für immer verlassen haben wollte; die Mutter hatte schon den 6. Februar 1832 zur Rückkehr gemahnt, weil man jetzt am Rhein der Ankunft »der asiatischen Hyäne« entgegensehe. Der Tod Hegels, der den 14. November 1831 an der Cholera gestorben war, hätte für Schopenhauer wohl ein Beweggrund sein können, noch einmal seine Lehrtätigkeit zu versuchen. Indessen konnte er sich nicht dazu entschließen und kündigte für das Wintersemester 1831/32 zum letzten Mal eine Vorlesung an, die er nicht hielt. Nunmehr gab er auch den Namen eines Dozenten für immer auf und ging für die nächste Zeit, beinahe ein Jahr, nach Mannheim (Juli 1832 bis Juni 1833).169
Nachdem er hier Ort und Gesellschaft zur Genüge kennen gelernt hatte, stellte er zwischen den beiden Städten, die er zuletzt bewohnt, eine gründliche Vergleichung an, wog ihre Vorteile und Nachteile in einer langen Liste gegeneinander ab, schriftlich und auf englisch, und kehrte im Juni 1833 nach Frankfurt zurück, um diesen Ort nicht wieder zu verlassen. Die dortigen Witterungsverhältnisse behagten ihm, und er fand A. v. Humboldts Ausspruch gerechtfertigt, dass in Ansehung des Klimas sich Frankfurt zu Berlin verhalte wie Mailand zu Frankfurt.170
3. Die Niederlassung in Frankfurt
Er hatte noch 27 Jahre vor sich. Die Geburtsstadt Goethes wurde Schopenhauers Eremitage. Hier lebte er wie Descartes in Holland, nur waren die Grundstimmungen beider Philosophen sehr verschieden. Während jener seine Einsiedelei liebte und sich glücklich pries, in bevölkerten Städten völlig unbekannt, darum ungestört zu leben und dem Ruhm aus dem Wege zu gehen, verzehrte sich dieser im brennenden Durst nach Ruhm und sah in der Menschenwelt, die ihn umgab, ohne ihn zu kennen, eine Wüste. Wo er bemerkt wurde, galt er als ein Sonderling. Wo er genannt wurde, hieß es nicht: »Das ist Arthur Schopenhauer, der berühmte Verfasser der ›Welt als Wille und Vorstellung‹«, sondern: »Das ist der Sohn der berühmten Johanna Schopenhauer«. Während die Mutter mit der Gesamtausgabe ihrer Werke beschäftigt war, sah der Sohn die seinigen in die Nacht der Vergessenheit sinken.
Werfen wir einen Blick auf sein äußeres Leben, um nicht wieder darauf zurückzukommen. Mit Ausnahme einer viertägigen Rheinreise, die bis Koblenz ging (August 1835), hat er seinen Wohnort nicht mehr verlassen, denn eine gelegentliche Fahrt nach Mainz oder eine nach Aschaffenburg (um das pompejanische Haus zu sehen) zählten nicht als Reisen. Es gibt verschiedene Arten menschlicher Narrheiten, welche uns die deutschen Satiren des sechzehnten Jahrhunderts sehr anschaulich geschildert haben; es gibt auch verschiedene Arten von Teufeln, die bei unseren Narrheiten die Hand im Spiel haben. Eine der modernsten Teufelarten ist nach Schopenhauers treffender Benennung »der Reiseteufel«. Dieser hat ihn während seiner letzten fünfundzwanzig Lebensjahre nicht mehr heimgesucht. Mit den Wanderjahren war es für immer zu Ende.
Erst als er zweiundfünfzig geworden war (1840), schaffte er sich eigenes Mobiliar an und begann sich häuslich einzurichten bis auf die Mahlzeiten, die er stets im Gasthaus nahm; er wohnte Parterre, um im Fall einer Feuersbrunst sich leichter retten zu können. Während der letzten siebzehn Lebensjahre (1843 – 1860) hatte er seine Wohnung am rechten Mainufer (»Schöne Aussicht«), dem deutschen Ordenshaus in Sachsenhausen gegenüber, wo ein halbes Jahrtausend früher als Kustos und Priester der Verfasser der deutschen Theologie gewohnt haben sollte. Dieses Gegenüber tat ihm wohl, denn er sagte gern: »Buddha, der Frankforter und Ich«. Er zog den »Frankforter« selbst dem Meister Eckart vor, den er übrigens erst spät kennen gelernt hat. Das deutsche Herrenhaus nannte er, weil es einst den Verfasser der deutschen Theologie beherbergt hatte, »die heiligen Hallen«.
Sein Zimmer wusste er sich allmählich so auszuschmücken, dass sein Blick überall auf Gegenstände traf, die seine Gesinnungsart und Lehre verkündeten. Unter den tierischen Willenserscheinungen waren ihm die interessantesten und liebenswürdigsten, ohne welche das Menschenleben in seinen Augen viel von seinem Reiz und Wert eingebüßt haben würde, die Hunde, die treuen und klugen Freunde des Menschen, ganz besonders die Pudel. Rings an den Wänden sah man eine Galerie von Hunden unter Glas und Rahmen, sechzehn an der Zahl, als er zuletzt noch aus München das Bild des berühmten Mentor erhalten, der ein Menschenleben gerettet und die Medaille verdient hatte. Der einzige ihm unentbehrliche Stubengenosse war der Pudel, der auf einem Bärenfell zu seinen Füßen lag; als der schöne große weiße an Altersschwäche gestorben war, kam ein brauner an seine Stelle171; der Pudel hieß »Âtma« (Weltseele), als der lebendige Ausdruck der Lehre vom Brahm nach dem Oupnek’hat, welches aufgeschlagen auf dem Tisch lag. – An der Wand hingen die Bildnisse von Descartes und Kant, der beiden ihm verehrungswürdigsten Philosophen der neuen Zeit, auch das von Matthias Claudius wegen eines pessimistischen Aufsatzes, der ihm teuer war. – Er konnte nicht oft und nachdrücklich genug wiederholen, dass das letzte Jahrhundert zwei wahre und echte Genies erzeugt habe: Kant und Goethe. Goethes Ölbild hing über seinem Sofa, Kants Büste von Rauch stand auf seinem Schreibpult; er hatte sie bei Rauch bestellen lassen mit der ausdrücklichen Hervorhebung, dass sie »für den wahren und echten Thronerben Kants« bestimmt sei.
Es fehlte noch ein Schmuck, der höchste: das Bild des Buddha! Endlich kam die Statuette an, in Paris gekauft, in Tibet gegossen, von Bronze, schwarz lackiert; sie wurde von diesem Überzug befreit, auf eine Marmorkonsole gestellt, und hier thronte nun in der Ecke des Zimmers, glänzend wie Gold, der allerherrlichst Vollendete, »orthodox dargestellt mit dem berühmten sanften Lächeln«. Seit dem 30. Oktober 1851 stand die Büste Kants auf dem Schreibpult, seit dem 13. Mai 1856 die Statuette Buddhas auf der Konsole in der Ecke des Zimmers, welches nunmehr auch den Anspruch hatte, »die heiligen Hallen« zu heißen. Es gereichte dem Philosophen zu inniglicher Befriedigung, dass sein Buddha hoffentlich tibetanischen und nicht chinesischen Ursprungs war wie ein anderer, im Besitz eines reichen Engländers befindlicher, mit dem er den seinigen sorgfältig verglich. Aus Tibet, dem Reich des Lamaismus! Wenn er seinen Pudel »Âtma« rief, vergegenwärtigte sich ihm der Pantheismus und das Oupnek’hat; wenn er das tibetanische Götzenbild anblickte, lächelte ihm sanft der Atheismus und Pessimismus entgegen.172
In allem Übrigen war, dem Vorbild Kants gemäß, sein Lebenslauf nach Gesundheits- und Arbeitszwecken genau geregelt, und ein Tag ging wie der andere.
II. Die handschriftlichen Bücher
Seit seiner ersten italienischen Reise, die er im September 1818 antrat, pflegte Schopenhauer nach den jeweiligen Bedürfnissen und Antrieben der Gegenwart Aufzeichnungen zu machen, die er in der Form handschriftlicher Bücher von verschiedenen Namen, Umfang und Inhalt bis an sein Ende fortgeführt hat. Da wurden Erlebnisse, Selbstbetrachtungen, Ideen, philosophische, zur Aufnahme in die Werke bestimmte Materien niedergeschrieben, sodass in diesen Büchern gleichsam die »Vorratskammern« für neue Auflagen und Schriften angelegt waren.
Die erste dieser Sammlungen, im September 1818 angelegt, hieß das »Reisebuch«; in den Anfang der Berliner Zeit gehören der »Foliant« (Januar 1821) und »Εἰς ἑαυτόν«, jene Selbstbetrachtungen, die Schopenhauer nicht bloß in zwei späteren Sammelbüchern, den »Cogitata« und dem »Cholerabuch«, sondern auch in dem Handexemplar eines seiner Werke zitiert hat, im Hinblick auf Stellen, die in eine neue Auflage der »Parerga« aufgenommen werden sollten.
Aus Anlass der zweiten italienischen Reise im Mai 1822 entstand die »Brieftasche« und während des letzten Aufenthaltes in Dresden der »Quartant« (November 1824). Unter dem Eindruck seines vieljährigen und vielfältigen Missgeschicks nannte er das im März 1828 angelegte Buch »Adversaria«. Das Motto hieß: »Vitam impendere vero«. Im Februar 1830 begann er die »Cogitata« mit demselben Motto. Hier hat er jenen Warnungstraum erzählt, der ihn bewog, Berlin zu verlassen. Die »Adversaria« und »Cogitata« fallen in das Ende der Berliner Zeit.
Den 6. September 1831 begann er das »Cholerabuch«, so genannt, weil »geschrieben auf der Flucht vor der Cholera«. Ein Jahr später (im September 1832) wurden in Mannheim die »Pandektä« angelegt. Nach der Erneuerung seiner schriftstellerischen Tätigkeit wurden im April 1837 die »Spicilegia« (Ährenlese), sein neuntes Manuskriptbuch, nach Vollendung seines letzten Werks fünfzehn Jahre später (im April 1852) die »Senilia« angefangen, so genannt, weil sie in das Greisenalter des Philosophen gehören (1852 – 1860). Die Spicilegia und Senilia fallen recht eigentlich in die Frankfurter Periode.