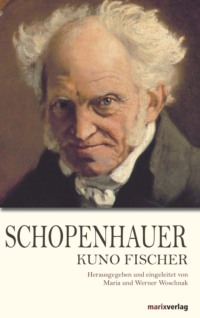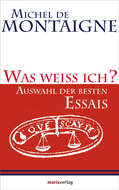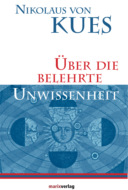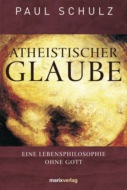Kitabı oku: «Schopenhauer», sayfa 6
3. Das mütterliche Erbteil
Ein solcher Ideendurst, eine solche intellektuelle Triebkraft herrschte wirklich in dem jungen Arthur, und zwar von Anbeginn. Dieser zweite Grundzug seines Wesens war das Erbteil seiner Mutter. Johanna Schopenhauer, wie wir sie schon kennen gelernt haben, war eine lebensfrohe, heitere, der Sonnenwelt zugewendete Natur, die vor allem Pessimismus zurückwich, als ob sie ein Gifthauch anwehte. Es lagen dichterische und künstlerische Keime in ihr bereit, die nur auf günstige Bedingungen harrten, um sich schnell und leicht zu entfalten. Sie ist eine anmutige und vielgelesene Schriftstellerin geworden und hat ihre intellektuelle Begabung auf ihre beiden Kinder vererbt. Adele hat sich als Blumenmalerin ausgezeichnet, Märchen gedichtet und, was mehr als beides sagen will, sich in das Gebiet der literarischen und künstlerischen Interessen dergestalt eingelebt, dass sie Goethe bei seinen Arbeiten gute Dienste leisten konnte.
Und Arthur? Sein intellektuelles Naturell war mit dem ganzen Schwergewicht seines starken und heftigen Wollens angetan und ausgerüstet; er war berufen ein genialer Künstler zu werden, nicht ein solcher, der die Erscheinungen in Gestalten und Farben, sondern der das Wesen und die Beschaffenheit der Dinge in Begriffen darstellt und abbildet: ein Künstler, dessen Stoff in Erkenntnissen, Einsichten und Ideen besteht, die auf dem Weg der gelehrten, wissenschaftlichen, philosophischen Bildung und Arbeit erworben werden mussten. Vermöge seiner Geistesart gehörte er zu den Kindern des Lichts, zu jenen »Göttersöhnen«, die nach dem Wort des Herrn berufen sind, das Wesen der Welt, das Ewige im Vergänglichen zu erkennen und anzuschauen: »Und was in schwankender Erscheinung schwebt, befestiget mit dauernden Gedanken!« – Das Gefühl dieses Berufs war schon in ihm lebendig, als er sich verurteilt sah, im Comptoir zu Hamburg die kaufmännischen Geschäfte zu erlernen.
Zweites Kapitel
Der zweite Abschnitt der Jugendgeschichte. Die neue Laufbahn und die neuen Lehrjahre (1805 – 1814)
I. Johanna Schopenhauer in Weimar
1. Der gesellige Kreis. Goethe
Den 28. September 1806 war Frau Schopenhauer mit ihrer neunjährigen Tochter in Weimar angelangt, ahnungslos, welchen furchtbaren Ereignissen in nächster Zukunft sie entgegenging. Aber, wie seltsam es klingt, sie hätte zu ihrem geselligen Heil in keinem gelegeneren Zeitpunkte nach Weimar kommen können, als in den Tagen der Schlacht bei Jena. Solche ungeheure Begebenheiten rütteln die Menschenlose durcheinander und führen Personen, die sonst getrennt bleiben, schnell und traulich zusammen. In der gemeinsamen Ausübung weiblicher Tugenden, um Not und Elend zu lindern, fand sie sogleich alle Gelegenheit, sich tätig und hilfreich zu zeigen; sie war wohlhabend und freigebig; sie wusste auch im geistigen Wechselverkehr angenehm und anregend zu wirken durch die Art, wie sie sich mitteilte und wie sie empfing.
Gleich in den ersten Tagen hatte sie Goethe besucht, aber nicht angetroffen, alsbald überraschte er sie durch seinen schnellen und scheinlosen Gegenbesuch; sie war durch Fräulein von Göchhausen der Herzogin Amalie vorgestellt und mit Wieland bekannt gemacht worden. Es dauerte nicht lange, so war Johanna Schopenhauer der Mittelpunkt eines geselligen Kreises von unvergleichlicher Art. Nun interessieren uns vor allem die brieflichen Nachrichten, die sie dem Sohne gab.
Einige Tage nach der Schlacht hatte Goethe sich mit Christiane Vulpius, seiner bewährten tapferen Freundin, trauen lassen und die natürliche Ehe, die er schon achtzehn Jahre mit ihr geführt, in eine vollgültige verwandelt. Aber von der weimarschen Gesellschaft wurde ihm die gesetzliche Form seiner Ehe noch mehr verübelt als die ungesetzliche, da sie eine soziale Erhöhung und Anerkennung der Frau zur Folge hatte, die man derselben nicht gönnte. Ganz anders dachte Frau Schopenhauer; sie freute sich aufrichtig ihrer Bekanntschaft, als ihr Goethe seine Frau schon am nächsten Tage zuführte (20. Oktober 1806). Ein treffendes Wort darüber schrieb sie ihrem Sohn: »Wenn Goethe ihr seinen Namen gibt, so können wir ihr wohl eine Tasse Tee geben«.
Goethe hat diese Aufnahme dankbar empfunden und ihr vergolten. Bald fühlte er sich wohl und heimisch in ihrem Hause und nahm an den Gesellschaftsabenden, die sie zweimal wöchentlich hielt, den regsten Anteil; jedes Mal stand für ihn ein kleiner Tisch mit Material zum Zeichnen in Bereitschaft. Unter den Genrebildern, die uns Goethe im geselligen Verkehr zeigen, würde eines der anmutigsten und eigenartigsten fehlen, wenn Johanna Schopenhauer ihre weimarschen Gesellschaftsabende dem Sohne nicht so anschaulich beschrieben hätte.
Hier las Goethe eines Abends mit verteilten Rollen seine »Mitschuldigen«, ein anderes Mal las er schottische Balladen, dann Calderons »standhaften Prinzen«, der mehrere Abende in Anspruch nahm. Da diese Tragödie, als er sie aufführen sah, einen so außerordentlich tiefen Eindruck auf Arthur Schopenhauer gemacht und in seinen Schriften ihm wiederholt zur Erleuchtung seiner Heilslehre gedient hat, so ist uns der Brief seiner Mutter, worin sie ihm die eben erwähnte Vorlesung schildert, in mehr als einer Hinsicht merkwürdig. »Goethe verlässt mich nicht«, schrieb sie den 23. März 1807, »er hat jeden Abend seinen standhaften Prinzen standhaft vorgelesen bis gestern, wo er ihn zu Ende brachte. Es ist doch ein hoher Genuss, von Goethe dies lesen zu hören; mit seiner unbeschreiblichen Kraft, seinem Feuer, seiner plastischen Darstellung riss er uns alle mit fort, obgleich er nicht kunstgemäß gut liest.
Er ist viel zu lebhaft, er deklamiert, und wenn etwa ein Streit oder gar eine Bataille vorkommt, macht er einen Lärm, wie in Drury Lane, wenn es dort eine Schlacht gab. Auch spielt er jede Rolle, die er liest, wenn sie ihm eben gefällt, so gut es sich im Sitzen tun lässt. Jede schöne Rolle macht auf sein Gemüt den lebhaftesten Eindruck, er erklärt sie, liest sie zwei- und dreimal, sagt tausend Dinge dabei, kurz, es ist ein eigenes Wesen, und wehe dem, der es ihm nachtun wollte! Aber es ist unmöglich, ihm nicht mit innigem Anteil, mit Bewunderung zuzuhören, noch mehr ihm zuzusehen; denn wie schön alles dieses seinem Gesichte, seinem ganzen Wesen lässt, mit wie einer eigenen hohen Grazie er alles dies treibt, davon kann niemand sich einen Begriff machen. Er hat etwas so Einfaches, so Kindliches. Alles, was ihm gefällt, sieht er leibhaftig vor sich; bei jeder Szene denkt er sich gleich die Dekoration und wie das Ganze aussehen muss. Kurz, ich wünschte, du hörtest das einmal.«125
Der Brief charakterisiert auch die Briefstellerin, ihre lebhafte Einbildungskraft, ihr anschauliches Darstellungsvermögen, das alles, was sie erzählt, uns so sehen lässt, wie sie selbst es sieht. Dies heißt künstlerisch vorstellen und schreiben. Ich kann es mir nicht versagen, aus einem Brief, der zwei Monate nach ihrer Ankunft in Weimar geschrieben ist, die Stelle anzuführen, worin sie Goethes Erscheinung und deren Eindruck schildert. »Welch ein Wesen ist dieser Goethe! Wie groß und gut! Da ich nicht weiß, ob er kommt, so erschrecke ich jedes Mal, wann er ins Zimmer tritt; es ist, als ob er eine höhere Natur als alle übrigen wäre, denn ich sehe deutlich, dass er denselben Eindruck auf alle übrigen macht, die ihn doch länger kennen und ihm zum Teil auch weit näher stehen als ich. Er selbst ist immer ein wenig stumm und auf eine Art verlegen, bis er die Gesellschaft recht angesehen hat, um zu wissen, wer da ist. Er setzt sich dann immer dicht neben mich, etwas zurück, so dass er sich auf die Lehne von meinem Stuhle stützen kann; ich fange dann zuerst ein Gespräch mit ihm an, dann wird er lebendig und unbeschreiblich liebenswürdig.« »Er ist das vollkommenste Wesen, das ich kenne; eine hohe schöne Gestalt, die sich sehr gerade hält, sehr sorgfältig gekleidet, immer schwarz oder ganz dunkelblau, die Haare recht geschmackvoll frisiert und gepudert, wie es seinem Alter ziemt, und ein gar prächtiges Gesicht mit zwei klaren, braunen Augen, die mild und durchdringend zugleich sind. Wenn er spricht, verschönert er sich unglaublich, und ich kann ihn dann nicht genug ansehen.«
Er fühlte sich der Frau Schopenhauer so befreundet, dass er interessante Personen, die um seinetwillen nach Weimar gekommen waren, bei ihr einführte. So lernte sie Bettina Brentano, Goethes jugendliche Freundin, und Zacharias Werner, den Dichter der »Söhne des Thals« und der »Weihe der Kraft«, in ihrem eigenen Hause kennen, jene den 1. November, diesen den 23. Dezember 1807.126
In welcher Epoche damals Goethes dichterische Kraft und Tätigkeit stand, bekunden uns seine Werke. Während eines mehrwöchentlichen Aufenthaltes in Jena (vom 11. Nov. bis 18. Dezember 1807) entstanden unter dem Eindruck der in schönster Jugendblüte prangenden Minna Herzlieb, der Pflegetochter des Frommann’schen Hauses, die Sonette.127 Gleichzeitig reifte die Dichtung der »Pandora«. Der Plan der »Wahlverwandtschaften« wurde entworfen, und die Ausführung gedieh nach einigen Unterbrechungen schnell zur Vollendung, so dass dieser tief durchdachte, seelenkundige und mit der vollkommensten Meisterschaft geschriebene Roman noch im Jahre 1809 erscheinen konnte. Ostern 1808 war der erste Teil des »Faust« endlich erschienen und nun dieses weltbedeutende Gedicht auch für alle Zeiten weltberühmt.
Die literarischen Größen Weimars versammelten sich im Hause der Frau Schopenhauer und zierten ihre Tafelrunde; jeder trug zur Erheiterung und Belehrung der Gäste bei, was er vermochte. Bisweilen erschien auch Wieland und las aus seiner Übersetzung des Cicero vor, und Hildebrand von Einsiedel, der Hofmarschall der Herzogin Amalia, der den Anbruch der goldenen Zeit Weimars schon miterlebt und mitgefeiert hatte, gab seine Übersetzung plautinischer Lustspiele zum besten. Mit vollem Rechte konnte Johanna Schopenhauer bald nach ihrer Ankunft dem Sohne schreiben: »Der Zirkel, der sich Sonntag und Donnerstag um mich versammelt, hat wohl in Deutschland und nirgends seinesgleichen«.
2. Karl Ludwig Fernow
Unter den vorzüglichen Männern jenes Kreises war einer, mit dem Johanna Schopenhauer alsbald die innigste Freundschaft schloss, die, da seine Tage gezählt waren, nur von kurzer Dauer sein konnte, aber für ihre ganze Zukunft die heilsamsten Folgen hatte, auch für die ihres Sohnes, weshalb diesem Freunde hier eine Stelle gebührt. In ihm fand Frau Schopenhauer den Führer, den sie zur Ausbildung und Anwendung ihrer Fähigkeiten bedurfte.
Karl Ludwig Fernow, ein Bauernsohn aus der Uckermark, hatte sich vom Notarsschreiber, Apothekerlehrling und Apothekergehilfen zum Künstler, Ästhetiker und Gelehrten emporgearbeitet. Als er im Jahre 1786 in die Ratsapotheke nach Lübeck kam, lernte er den Zeichenkünstler und Maler Asmus Carstens kennen, und im Verkehr mit ihm, der sein Lehrer und Freund wurde, erkannte er in dem Studium und der Ausübung der bildenden Kunst seinen eigentlichen Beruf. Dass die bildende Kunst nationale Aufgaben und Zwecke zu erfüllen, dass sie durch die Wahl großer Gegenstände und deren Darstellung in Wandgemälden an der Erziehung des Volks teilzunehmen habe, waren Ideen, die der großdenkende Carstens hegte und auf seinen Freund übertrug. Solche Gesichtspunkte führten in das Gebiet der Kunstgeschichte und Kunstphilosophie. Mit Begeisterung las Fernow Schillers ästhetische Aufsätze, studierte er Kants »Kritik der Urteilskraft« und hörte er Reinholds Vorlesungen in Jena. Es gelang ihm nach Rom zu kommen, wo er mit Carstens einige Jahre zusammenlebte. Als dieser den 26. Mai 1798 hier gestorben war, hielt ihm Fernow an der Pyramide des Cestius die Grabrede und wurde nachmals sein Biograph.
Nach einem neunjährigen Aufenthalt in Rom (1794 – 1803) war er als ein vorzüglicher Kenner der antiken Kunst wie der italienischen Malerei, Sprache und Poesie nach Deutschland zurückgekehrt, um in Jena Vorlesungen über Ästhetik, Kunstgeschichte und italienische Literatur zu halten. Aber an der Ausübung dieses Lehramtes hinderte ihn ein schweres Leiden, das er sich auf der Rückreise mit Weib und Kind in ungünstiger Jahreszeit durch Entbehrungen und Strapazen aller Art zugezogen hatte. Nun wurde er Bibliothekar der Herzogin Amalia und lebte in Weimar, mit umfassenden Arbeiten beschäftigt: darunter waren die Lebensbeschreibungen der vier größten Dichter und Maler Italiens und die Gesamtausgabe der Werke Winckelmanns.
Gleich im Beginn ihrer weimarschen Zeit hatte ihn Frau Schopenhauer am Hofe der Herzogin kennen gelernt; bald gehörte er zu ihren täglichen Gästen, er kam jeden Abend zur Teestunde, las und erklärte ihr italienische Dichter oder sprach über Werke der bildenden Kunst. Nach dem Tod der Herzogin (den 10. April 1807) verschlimmerte sich seine Krankheit, deren eigentliche Beschaffenheit die Ärzte entweder verkannten oder verheimlichten. Als er Antonio Scarpas jüngste Schrift »sul aneurysmo« gelesen hatte, kannte er sein Schicksal. Er litt an der Pulsadergeschwulst. Nachdem seine schwindsüchtige Frau, eine Römerin aus der dienenden Klasse, verschieden war, wohnte er während der letzten Monate seines Lebens im Hause der Freundin und genoss die liebevollste Pflege. Hier starb er den 4. Dezember 1808.
3. Die Schriftstellerin
Der beständige Verkehr mit Fernow, seine Gespräche und sein Beispiel führten Johanna Schopenhauer in die schriftstellerische Bahn. Ihr erster Gegenstand war Fernow selbst. Sie schrieb großenteils aus dem Nachlass der Briefe seine ergreifende Lebensgeschichte und fand Teilnahme und Beifall (1810).128 Dann versuchte sie sich als Kunstschriftstellerin. Noch glücklicher und ergiebiger konnte sie sich auf dem Felde der Reiseerzählung erproben, da sie hier in dem vertrauten Element ihrer eigenen Erlebnisse und Erfahrungen war. So erzählte sie ihre Reise durch England und Schottland (1813) und die durch das südliche Frankreich (1817). Sie war bereits eine Schriftstellerin von Ruf, als sie anfing Romane zu schreiben und leider genötigt wurde, ihre Feder nunmehr als Erwerbsmittel zu brauchen. Nach dem Vorbild der neuen Heloise, des Werther und der Wahlverwandtschaften schrieb sie ihre »Gabriele« (1819 – 1821), einen mehrbändigen Roman, dessen Heldin das Ideal leidenschaftlicher Hingebung und völliger Entsagung verkörpern sollte. Goethe hat diesen Roman, der die Höhe ihrer dichterischen Leistungen bezeichnet, in Marienbad gelesen und gelobt, ein Jahr bevor er hier die letzte seiner eigenen Wahlverwandtschaften erlebt hat, woraus aber kein Roman, sondern die »Marienbader Elegie« hervorging (1823).
II. A. Schopenhauers neue Laufbahn
1. Die letzten Jahre in Hamburg
Während Mutter und Tochter in Weimar eine zweite Heimat gefunden hatten, worin sie sich mit jedem Tage wohler und behaglicher fühlten, wurde der Sohn in Hamburg von Tag zu Tag unzufriedener mit seinem Los und schrieb verzweifelte Briefe. Es ging ihm wie Descartes, aber umgekehrt. Dieser stand mit sechzehn Jahren am Ende der Schulzeit und brannte vor Begierde nach dem Buch der Welt; Arthur Schopenhauer hatte in ungefähr gleichem Alter in dem Buch der Welt schon viel geblättert und vielerlei gelesen; jetzt brannte er vor Begierde nach dem Unterricht der Gelehrtenschule und den Büchern der Weisheit als nach dem Stoff, dessen sein Gestaltungsvermögen bedurfte.
Er trieb in Hamburg allerhand Allotria, womit er seinen Lehrherrn hinterging; eifrig und heimlich hörte er alle Vorlesungen, welche Gall über seine Schädellehre hielt; in Gemeinschaft mit seinem Freunde Anthime de Blésimare, der zur Erlernung der deutschen Sprache nach Hamburg gekommen war, gab er sich lockeren Genüssen und Ausschweifungen hin, die seinem erhabenen Selbstgefühl recht zur Beschämung gereichten. Man darf sich überhaupt seine pessimistische Grundstimmung ja nicht als dumpf und elegisch vorstellen, dazu war in ihm zu viel Naturkraft und Geisteslebendigkeit. Wenn er in Klagen ausbrach, äußerten sich dieselben bitter und spottsüchtig.
Um eine Natur, wie die seinige, für den kaufmännischen Beruf zu gewinnen, war eine Reise durch die weite große Welt, wie sie der Vater ihm hatte angedeihen lassen, ein sehr zweckwidriges Mittel gewesen. Und die Briefe, die jetzt die Mutter an ihn schrieb, von und über Weimar, die Schilderungen ihrer Gesellschaftsabende und der geistigen Interessen, die sie belebten, das Bild, das sie ihm von Goethes bezaubernder Persönlichkeit, von seiner Vorlesung des standhaften Prinzen entwarf – »ich wünschte, du könntest das einmal hören« – alle diese Mitteilungen waren gar nicht geeignet, ihm das Comptoir in Hamburg erträglicher zu machen. Um so schmerzlicher verwünschte er sein Schicksal und bestürmte die Mutter mit Klagen.
Diese, besorgt und zärtlich, wie sie damals für den Sohn gesinnt war, wünschte ihm zu helfen. Die Frage war, ob er im zwanzigsten Lebensjahr noch eine Laufbahn ergreifen könne, die mit dem Gymnasium beginnen musste. Darüber beriet sie sich mit ihrem Freunde Fernow, der aus der eigenen Erfahrung am besten urteilen konnte: er, der mit zwanzig Jahren die ersten bedeutenden Kunstwerke gesehen, mit dreißig die ersten akademischen Vorlesungen gehört hatte und ein berühmter Kunstgelehrter und Kunstschriftsteller geworden war! Fernow erteilte ihr seinen Rat in einer eingehenden Denkschrift. Noch sei für den Sohn keine Zeit verloren, da bei den Sprachkenntnissen und der Bildung, die er schon habe, derselbe wohl imstande sein werde, die alten Sprachen in zwei Jahren so weit zu erlernen, dass er in zwei weiteren Jahren die Reife für das akademische Studium erlangen könne. Nur möge er sich über seinen Drang zur Wissenschaft keiner Einbildung und Selbsttäuschung hingeben.
Die Mutter schickte ihm Fernows Brief und ließ ihm die Wahl frei (28. April 1807). Der plötzliche Eindruck, dass die neue ersehnte Lebensbahn sich ihm öffne, erschütterte ihn so, dass er in Tränen ausbrach. Während sonst seine Unentschlossenheit, die natürliche Folge seines Misstrauens, ins Grenzenlose ging, war jetzt sein Entschluss auf der Stelle gefasst. Schon in ihrem Brief vom 14. Mai wünschte ihm die Mutter mit herzlichen Worten Glück zum neuen Lebensberuf. Ein merkwürdiger Lebenslauf: erst die Wanderjahre, dann die Lehrjahre!
2. Die Schulzeit in Gotha und Weimar
Es war durch Fernow ausgemacht und vorbereitet, dass er das Gymnasium in Gotha besuchen, bei dem Professor Lenz wohnen, von dem Direktor Döring Privatstunden im Lateinischen erhalten und an dem Klassenunterricht in der Selecta teilnehmen sollte, wo Friedrich Jacobs den deutschen Unterricht gab. Alles ging auf das Beste. Der neunzehnjährige Jüngling, der mit »mensa« beginnen musste, machte die schnellsten Fortschritte, Jacobs erstaunte über die Vortrefflichkeit seiner Aufsätze; da verdarb er sich alles durch die Spottsucht. Seine Spottverse auf einen Professor, der die Selecta getadelt hatte, wurden bekannt, und Döring kündigte ihm den Unterricht. Nun war auch seines Bleibens in Gotha nicht länger.
Nach bitteren und verdienten Vorwürfen von Seiten der Mutter wurde ihm die Wahl des Gymnasiums zwischen Altenburg und Weimar gelassen. Frau Schopenhauer würde um ihretwillen Altenburg vorgezogen haben, er wählte Weimar. Hier wurde er von dem Direktor Lenz im Gebrauch der lateinischen Sprache geübt und von dem jüngst berufenen, nur drei Jahre älteren Professor Franz Passow im Griechischen unterrichtet; er wohnte mit dem letzteren in demselben Haus und arbeitete unter seiner Leitung. Im Beginn des Jahres 1808 war er nach Weimar gekommen, im Herbst 1809 hatte er, dank seiner Begabung und Energie, das Ziel der Schule erreicht, und zwar in der Hälfte der Zeit, die Fernow berechnet hatte.
Die segenreichste Frucht seiner weimarschen Gymnasialzeit war eine gründliche und gewandte Kenntnis der klassischen Sprachen, eine unauslöschliche Begeisterung für das klassische Altertum, welches er in Hamburg noch keineswegs zu schätzen gewusst hatte; in Weimar dichtete er eine Art Vaterunser auf den Homer und schrieb es in sein Handexemplar. Sein erstes Jahr in Weimar war das letzte im Leben Fernows, dem er noch die ersten Anregungen zum Studium der italienischen Literatur zu danken gehabt hat; ich nenne besonders das Studium Petrarcas, der einer seiner Lieblingsdichter geworden und stets geblieben ist.