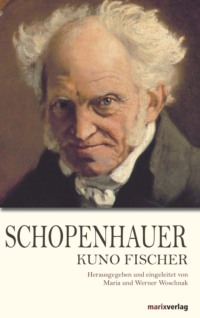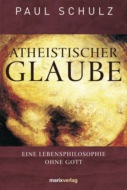Kitabı oku: «Schopenhauer», sayfa 8
3. Die häuslichen Differenzen
Seit einiger Zeit lebte in ihrem Hause ein jüngerer ihr befreundeter Mann, den Arthur schon im Mai zu seinem großen Verdruss hier angetroffen hatte: Friedrich Müller aus Ronneburg im Altenburgischen (später durch die Adoption eines Oheims mütterlicherseits »von Gerstenbergk« genannt), Verfasser der »Kaledonischen Erzählungen« und der Gedichte, die in dem Roman »Gabriele« eingeflochten wurden. Es kam zwischen den beiden Männern sehr bald zu heftigen Auftritten, denen heftige Auftritte zwischen Mutter und Sohn folgten. Am Ende verkehrten diese beiden unter demselben Dache nur noch schriftlich, bis ihm zuletzt die Mutter die Wohnung kündigte und den Absagebrief schrieb.
Er ging und hat seine Mutter, die noch vierundzwanzig Jahre zu leben hatte, nicht wiedergesehen, auch nicht die Schwester, die mit der Mutter vereinigt blieb und, obwohl sie für deren Schwächen nicht blind war, ihre Herzensgüte stets gepriesen hat. Der Sohn hat ihr vorgeworfen, dass sie den Vater nicht geliebt und sein Andenken nicht in Ehren gehalten habe, was mit den Bekenntnissen, welche sie selbst kurz vor ihrem Tod niedergeschrieben hat, nicht wohl übereinstimmt. Um so eifriger war er bestrebt, nachdem der letzte Funken der Pietät für die Mutter erloschen war, dem Vater Altäre des Dankes zu errichten. Wäre es nach dem Vater gegangen, so wäre er ein elender Kaufmann geworden. Da die Mutter ihm half, wurde er ein genialer Denker und Schriftsteller.
Drittes Kapitel
Der dritte Abschnitt der Jugendgeschichte. Neue Werke und neue Wanderjahre (1814 – 1820)
I. Der Dresdner Aufenthalt
1. Glückliche Jahre
Unter den deutschen Städten, die er noch am Schluss jener großen Reise gesehen hatte, war ihm Dresden in guter Erinnerung geblieben. Jetzt wählte er diesen Ort zu einem mehrjährigen Aufenthalt (vom Mai 1814 bis in den September 1818), um hier in voller Muße seine Ideen auszuarbeiten, systematisch zu ordnen und darzustellen. Nach seiner eigenen Aussage war er schon während des Jahres 1814 mit den Grundgedanken ins Reine gekommen, aber die Ausführung des Hauptwerkes geschah erst in der Zeit vom März 1817 bis in den März 1818. Andere Arbeiten waren dazwischengetreten.
Es war eine glückliche, schaffensfreudige Zeit, die er hier in Dresden verlebte: voller Ideen und Arbeitsdrang, in frohem Erstaunen über die Entstehung und Geburt seines Werkes, gehoben von den sichersten Hoffnungen künftigen Ruhmes. Er sah seine Schöpfung vor sich aufsteigen, »wie aus dem Morgennebel eine schöne Landschaft«. Sein Lebensbaum stand in voller Blüte und die Früchte reiften schnell. Als er einmal an einem Frühlingsmorgen, mit Blüten bedeckt, aus dem Zwinger heimkehrte, rief ihm die Hauswirtin zu: ,,Sie blühen, Herr Doktor!« »Jawohl«, erwiderte er, »die Bäume müssen blühen, wenn sie Frucht tragen sollen!«
Im Kreise ästhetischer und belletristischer Schriftsteller, die ihn »Jupiter tonans« nannten, da er im Ausdruck seiner Affekte zu donnern und zu blitzen verstand, fand er nach angestrengter Geistesarbeit gesellige Zerstreuung; und die Ausflüge, die er in die benachbarten Gegenden unternahm, im Sommer 1817 nach Teplitz, im nächsten Sommer in die Sächsische Schweiz, gewährten ihm angenehme Erholung. Unter jenen Dresdner Freunden befand sich der Kunstkenner Joh. Gottlob von Quandt, der bis ans Ende einer seiner treuesten Freunde geblieben und noch zuletzt auch ein enthusiastischer Anhänger seiner Lehre geworden ist.138
Hier in Dresden lernte ihn der Freiherr von Biedenfeld kennen und wurde im Fortgang des persönlichen Verkehrs von soviel Interesse und Bewunderung für den Philosophen und sein Werk erfüllt, dass er dem Buchhändler Brockhaus dringend riet, dieses Werk zu verlegen. Noch vierzig Jahre später hat er im Stuttgarter »Morgenblatt« den Schopenhauer der Dresdner Jahre ad vivum geschildert. »Als Sohn der hochbegabten Johanna Schopenhauer, völlig unabhängig durch ein hübsches Vermögen und früh in philosophisches Studium vertieft, hatte Arthur schon vor seiner Ankunft in Dresden sehr reiche Bekanntschaft mit dem geselligen Leben in verschiedenen Gegenden Deutschlands gemacht, ohne seinen Eigentümlichkeiten im mindesten zu entsagen, noch in die Schwächen anderer sich geduldig zu fügen. In dieser Hinsicht war er unverkennbar ein wenig enfant gâté, von offenherzigster Ehrlichkeit, geradeheraus, herb und derb, bei allen wissenschaftlichen und literarischen Fragen ungemein entschieden und fest, Freund und Feind gegenüber jedes Ding bei seinem rechten Namen nennend, dem Witze sehr hold, oft ein wahrhaft humoristischer Grobian, wobei nicht selten der Blondkopf mit den blaugrau funkelnden Augen, der langen Wangenfalte auf jeder Seite der Nase, der etwas gellenden Stimme und den kurzen heftigen Gestikulationen mit den Händen ein gar grimmiges Aussehen gewann. Mit seinen Büchern und Studien lebte er fast gänzlich isoliert und ziemlich einförmig, suchte keine Freundschaft, schloss sich auch niemandem besonders an, sah sich aber bei seinen weiten und großen Spaziergängen gern begleitet, unterhielt sich dabei sehr lebhaft über einzelne literarische Vorkommenheiten, wissenschaftliche Gegenstände, hervorragende Geister, besonders gern über Drama und Theater. Wer ihn liebenswürdig, anziehend, belehrend haben wollte, der musste mit ihm allein spazieren gehen. Mir wurde dieser Genuss oft zuteil, und dieser Umstand erwarb mir sein Wohlwollen, womit er mich noch jetzt erfreut. So galt er allgemein für einen Sonderling und war es auch gewissermaßen wirklich. Obschon entschiedener Gegner jenes Abendzeitungs-, Almanachs- und Liederkranzwesens, der sämtlichen Teilnehmer daran, die er nur die literarische Clique nannte, besonders aber Böttigers, den er laut als den gestiefelten Kater verhöhnte, fand er sich doch sehr häufig an den öffentlichen Orten ein, wo diese Männer gewöhnlich sich vergnügten. In der Regel entspann sich alsdann bald ein Kampf, wobei er mit seinem unverblümten Geradeheraus sehr den Unangenehmen spielte, mit den beißendsten Sarkasmen den Kaffee versalzte, seinem kritischen Humor ungeniert die Zügel schießen ließ, die ärgsten Brocken von Goethen und Shakespeare den Leuten ins Gesicht warf und dabei immer mit übereinandergeschlagenen Beinen an ihrem Whisttisch saß, dass sie Bock über Bock schossen. Dabei erschien er ihnen stets als ein Wauwau, alle fürchteten ihn, ohne dass einer jemals gewagt hätte, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Zum Glück blieb er über solche Dinge beim Reden stehen und bewahrte seine Tinte für anderes: Journalgeträtsche war nicht seine Sache, erschien ihm als zu kleinlich und verächtlich.«139
Schon in Göttingen war ihm Ludwig Sigismund Ruhl, ein Maler aus Kassel, nahegetreten. Als beide in Dresden von ungefähr wieder zusammentrafen, erneuerte sich ihr persönlicher Verkehr, und hier befestigte sich ein freundschaftliches Verhältnis von lebenslänglicher Dauer. Ruhl, der als Direktor der hessischen Kunstsammlungen zu Kassel im Jahre 1887 gestorben ist, neunzig Jahre alt, hat fünf Jahre vor seinem Tod »Eine Groteske« geschrieben (1882), worin er den Geist des Philosophen erscheinen lässt und ihm huldigt. In einer »Note« schildert er die Persönlichkeit Schopenhauers in jenen Jahren, wo er sein Werk schrieb. »Jetzt aber will ich dich, mein guter Arthur, der Welt keineswegs so zeigen, wie du endlich bei der Erkenntnis ihres Elends und ihrer unsäglichen Leiden bitter geworden bist. Gerade das Gegenteil habe ich im Sinn; meine Erinnerung führt mich vielmehr zu dem jungen, noch allerlei hoffenden Doktor Schopenhauer zurück, so wie ich ihm, nachdem wir beide Göttingen verlassen, in Dresden ganz unvermutet hinter der Kreuzkirche wieder begegnete, wo wir dann von da ab, trotz täglichen Streitens, unzertrennliche Gefährten wurden.« »Ich sehe dich noch im Geist unter all den Figuren auf der Brühl’schen Terrasse, hinter deren Erdendasein Zeit und Vergessenheit auch die letzte Spur schon verwehte. Du stehst wieder vor mir, mit der blonden, von der Stirn aufstrebenden Phöbuslocke, mit der sokratischen Nase, mit den stechend sich dilatierenden Pupillen, aus welchen gegen Kuhn und Kind, gegen Theodor Hell, Langbein, Streckfuß e tutti quanti der damaligen Dichtergrößen, die in Dresden le haut du pavé hielten, zerschmetternde Blitze fuhren. Ich war ganz Ohr bei euren Disputen, die mich zugleich ergötzten und unterrichteten. Dein Wissen zwang mich oft, den langen Weg aus der pirnaischen Vorstadt über die Elbbrücke bis zum schwarzen Tor hin und zurück zu machen. Wir saßen dann in deinem Zimmer, du mir vordozierend von dem und jenem, von den Erwartungen auf den Erfolg deiner Philosophie, von der vierfachen Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde, worüber deine Mutter dich verspottend fragte, ob es eine Anweisung für Apotheker wäre?« u. s. f.140
Auch hat Ruhl ein von ihm gemaltes Ölbild seines Freundes hinterlassen, das Schemann geerbt und wovon er einen Stahlstich seinem Sammelwerk der »Schopenhauer-Briefe« vorgesetzt hat. Keine Spur einer Ähnlichkeit zwischen diesem Bild Schopenhauers, das Ruhl gemalt, und jenem, das er in Worten beschrieben! Keine Spur einer Ähnlichkeit in Bau, Form und Ausdruck des Gesichtes zwischen diesem Bild des dreißigjährigen und dem wirklichen Porträt des siebzigjährigen Mannes. Es gibt auch ein Bild von dem jungen Schopenhauer, aus dem Jahre 1809, welches Gerhard von Kügelgen gemalt haben soll und Gwinner in einem Stahlstich seinem obengenannten Werke einverleibt hat. Keine Spur einer Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Jugendbildern, dem von Kügelgen (wenn es von ihm herrührt) und dem von Ruhl: dieses letztere ist offenbar ein Phantasiestück, in einer Zeit gemalt, wo er das Original nicht vor Augen hatte! Keine Spur einer Ähnlichkeit zwischen diesen Jugendbildern und dem wirklichen Porträt des greisen Frankfurter Philosophen!
2. Die Schrift über Farbenlehre und der Briefwechsel mit Goethe
Das größte Erlebnis seines letzten weimarschen Aufenthaltes war sein persönlicher Verkehr mit Goethe gewesen und der Gewinn, der ihm daraus hervorging, das Studium und die Aneignung der Goethe’schen Farbenlehre, welche er jetzt in Dresden mit den wissenschaftlichen Hilfsmitteln, die ihm zu Gebote standen, theoretisch auszubilden und aus einem einzigen Grundgedanken herzuleiten bemüht war. Eine solche Theorie hatte er in den Goethe’schen Untersuchungen vermisst. Diesem Mangel abzuhelfen, die Goethe’sche Farbenlehre im Gegensatz zur Newton’schen zu begründen, war nun die erste seiner Dresdner Aufgaben. Wir haben es hier nicht mit dem Inhalt seiner Farbenlehre, sondern nur mit ihrer biographischen Bedeutung zu tun. Er wollte nachweisen, dass die Farbe von durchaus subjektiver Beschaffenheit sei, in der Teilbarkeit nicht des Lichtes, wie Newton gelehrt hatte, sondern der Tätigkeit unserer Netzhaut bestehe und physiologisch begründet werden müsse, dass die verschiedenen Arten oder Grade des Helldunkels polare Farbengegensätze bilden, aus denen das Weiße sich wiederherstellen lasse, was Goethe im Gegensatze zu Newton unrichtigerweise bestritten und verneint habe.
So entstand im ersten Jahre seines Dresdner Aufenthaltes die Schrift »Über das Sehn und die Farben«, die er Goethe als Manuskript im Juli 1815 und als Druckschrift den 4. Mai 1816 zugesendet hat;141 dazwischen fällt jener Briefwechsel, von dem bisher nur die Antworten Goethes bekannt waren, neuerdings aber auch die Zuschriften Schopenhauers veröffentlicht sind, die ohne Zweifel zu den besten und interessantesten Briefen gehören, die er überhaupt geschrieben hat.142 Sie sind nicht bloß wegen ihres Themas, sondern noch mehr aus psychologischen Gründen merkwürdig, da sie uns den Briefsteller in einer Lage zeigen, in welcher seine Geduld, ohne die mindeste üble Absicht von Goethes Seite, auf die grausamste Probe gestellt, sein Misstrauen auf das peinlichste gereizt, seine Hoffnungen auf das bitterste getäuscht wurden, und er sich doch bei aller Offenheit und allem Freimut die höchste Mäßigung auferlegen musste und keinen Augenblick vergessen durfte, dass es Goethe war, an den er schrieb. Er hat es nicht vergessen und diese recht schwere Prüfung in seiner Weise musterhaft bestanden.
Der Brief, der die Zusendung des Manuskripts begleitet hat, fehlt. Offenbar hatte Schopenhauer gewünscht, Goethe von der Richtigkeit seiner Theorie zu überzeugen und seine Schrift durch ihn oder gemeinsam mit ihm herauszugeben: er wollte als sein Schüler, als einer »der ersten seiner Proselyten« und der zweite Begründer seiner Farbenlehre erscheinen. Er hatte sich vorgestellt, dass Goethe noch ebenso lebhaft von der Sache erfüllt sei wie damals, als er sie ihm vortrug; war doch kaum ein Jahr seitdem verflossen. Aber der Dichter weilte schon in einer ganz anderen Region. Als Schopenhauer acht Wochen vergeblich auf Antwort gewartet hatte und sich endlich nach dem Schicksal seiner Schrift erkundigte (3. September 1815), wohnte Goethe auf der Gerbermühle bei Frankfurt und lebte nicht in der Farbenlehre, sondern bei Suleika und im west-östlichen Diwan.
Man fühlt in den Ausdrücken Schopenhauers, wie Ungeduld und Misstrauen schmerzhaft erregt und mühsam unterdrückt sind. Mit einer in Bescheidenheit verhüllten Ironie schreibt er: »Ew. Excellenz haben mich bisher keiner Antwort gewürdigt, welches ich mir hauptsächlich daraus erkläre, dass die mannigfaltigen Umgebungen Ihres öfter veränderten Aufenthaltes, dabei der Umgang mit regierenden, diplomatischen und militärischen Personen Sie zu sehr beschäftigt und Ihre Aufmerksamkeit einnimmt, als dass meine Schrift anders als sehr unbedeutend dagegen erscheinen oder zu einem Briefe über dieselbe Zeit übrigbleiben könnte«. »Ich weiß von Ihnen selbst, dass Ihnen das literarische Treiben stets Nebensache, das wirkliche Leben Hauptsache gewesen ist. Bei mir aber ist es umgekehrt: was ich denke, was ich schreibe, das hat für mich Wert und ist mir wichtig; was ich persönlich erfahre und was sich mit mir zuträgt, ist mir Nebensache, ja ist mein Spott.« »Mir ist diese Ungewissheit über etwas, das zu dem gehört, was mir allein wichtig ist, unangenehm und quälend, ja in manchen Augenblicken kann meine Hypochondrie hier Stoff zu den widrigsten und unerhörtesten Grillen finden. Um allem diesem und der Plage einer täglich getäuschten Erwartung ein Ende zu machen, – bitte ich Ew. Excellenz, mir meine Schrift nunmehr zurückzuschicken mit oder ohne Bescheid, wie Sie für gut finden: in jedem Fall glaube ich jedoch noch diese Bitte mit Zuversicht hinzufügen zu dürfen, dass Sie mir zugleich in zwei lakonischen Worten anzeigen, ob außer Ihnen irgend jemand sie gelesen hat oder gar eine Abschrift davon genommen ist.«
Goethe vertröstete ihn auf seine Rückkehr nach Weimar, von wo er eingehend antworten werde; die Antwort kam, aber keine eingehende; er hat die Schrift noch fünf Monate behalten und erst den 28. Januar 1816 zurückgeschickt, ohne sie je einem andern gezeigt, aber auch ohne je sich selbst in einem eingehenden, von Schopenhauer inbrünstig ersehnten Urteil darüber ausgesprochen zu haben. Er fühlte sich teils schon dem Gegenstande selbst, dieser »geliebten und betretenen Region« der Farbenlehre entfremdet und von dem Widerspruch, den er erfahren hatte, ermüdet, teils auch durch die Abweichungen Schopenhauers, wie in Ansehung der Farbenpolarität, der Herstellung des Weißen, der Entstehung des Violetten unangenehm berührt. Es schien ihm, dass der Schüler bereits den Meister spielen wollte, und er hat sich in einigen Epigrammen von bitterem Geschmack darüber ausgelassen.143 Es half nichts, dass Schopenhauer jene Differenzen für nebensächlich erklärte und von seiner Farbenlehre sagte, sie verhalte sich zur Goethe’schen wie die Frucht zum Baum, wie der Scheitelpunkt zur Pyramide, dass er der treuste und gründlichste Verteidiger der Goethe’schen Farbenlehre gewesen und stets geblieben ist.
Den Vorschlag Goethes, die Schrift seinem Freunde Thomas Seebeck, dem Entdecker der entoptischen Farben, mitzuteilen144 und ihn zu einem Urteil aufzufordern, lehnte Schopenhauer sehr entschieden ab, voller Angst und Misstrauen, dass es ihm mit Seebeck ergehen könne, wie es Goethe in Ansehung seiner Entdeckung der Bildung und Zusammensetzung des Schädels mit Oken gegangen sei. Er wolle über sein Werk »nicht eine Meinung hören, sondern eine Autorität, nicht das Urteil eines Einzelnen, sondern des Einzigen«. Er wusste von Seebeck und dessen Entdeckung der entoptischen Farben so wenig, dass er fragen konnte, ob das Wort nicht »epoptisch« heißen sollte! Dass Goethe die Absicht gehegt, seine Schrift durch Seebeck beurteilen zu lassen, hatte ihn so gereizt, dass er brieflich sein Schicksal mit dem der Pfarrerstochter von Taubenhain verglich, welche der gnädige Herr mit seinem Jäger habe verheiraten wollen!
Der ausführlichste und geistreichste der Briefe Schopenhauers ist vom 11. November 1815; er verdient auch deshalb unser Interesse, weil aus seinen Ideen bis in die Bilder und die Ausdrucksweise hinein die gleichzeitige Entstehung des Hauptwerks unverkennbar hervorleuchtet. Goethe hat in dem vorangegangenen Brief (23. Oktober) gesagt: »Ich versetze mich in Ihren Standpunkt, und da muss ich denn loben und bewundern, wie ein selbstdenkendes Individuum sich so treu und redlich mit jenen Fragen befasst und das, was gegenständlich daran ist, rein im Auge behält, indem es sie aus seinem Innern, ja aus dem Innern der Menschheit zu beantworten sucht.« Diese treffende und wohltuende Anerkennung beantwortet Schopenhauer mit einer Schilderung seiner intellektuellen Persönlichkeit: »Alles, was von Ihnen kommt, ist mir ein Heiligtum. Überdies enthält Ihr Brief das Lob meiner Arbeit, und Ihr Beifall überwiegt in meiner Schätzung jeden anderen. Besonders erfreulich aber ist es mir, dass Sie in diesem Lobe selbst mit der Ihnen eigenen Divination gerade wieder den rechten Punkt getroffen haben, indem Sie nämlich die Treue und Redlichkeit rühmen, mit der ich gearbeitet habe. Nicht nur was ich in diesem beschränkten Felde getan habe, sondern alles, was ich in Zukunft zu leisten zuversichtlich hoffe, wird einzig und allein dieser Treue und Redlichkeit zu danken sein. Denn diese Eigenschaften, die ursprünglich nur das Praktische betreffen, sind bei mir in das Theoretische und Intellektuale übergegangen; ich kann nicht rasten, kann mich nicht zufrieden geben, solange irgendein Teil eines von mir betrachteten Gegenstandes nicht reine, deutliche Kontur zeigt. Jedes Werk hat seinen Ursprung in einem einzigen glücklichen Einfall, und dieser gibt die Wollust der Konzeption: die Geburt aber, die Ausführung ist wenigstens bei mir nicht ohne Pein, denn alsdann stehe ich vor meinem eigenen Geist, wie ein unerbittlicher Richter vor einem Gefangenen, der auf der Folter liegt, und lasse ihn antworten, bis nichts mehr zu fragen übrig ist.« »Der Mut, keine Frage auf dem Herzen zu behalten, ist es, der den Philosophen macht. Dieser muss dem Ödipus des Sophokles gleichen, der Aufklärung über sein eignes schreckliches Schicksal suchend, rastlos weiter forscht, selbst wenn er schon ahnt, dass sich aus den Antworten das Entsetzlichste für ihn ergeben wird. Aber da tragen die meisten die Jokaste in sich, welche den Ödipus um aller Götter willen bittet, nicht weiter zu forschen: und sie gaben ihr nach, und darum steht es auch mit der Philosophie noch immer, wie es steht.«145
Nachdem er auf Goethes Zustimmung oder wenigstens gutachtliche Meinung sieben Monate hindurch vergeblich gehofft hatte, endete die Sache für Schopenhauer mit einer sehr bitteren Enttäuschung, die er Goethe gegenüber zwar nicht verhehlt, aber bemeistert hat. Vielleicht ist der Dank und die Ehrfurcht, die Goethe gebühren, nie schöner und stolzer ausgesprochen worden als in den folgenden Worten: »Ew. Excellenz haben es in Ihrer Biographie gesagt«, schrieb er den 7. Febr. 1816: »’so ist doch immer das Finale, dass der Mensch auf sich zurückgewiesen wird’«. »Auch ich muss jetzt schmerzlich aufseufzen: ›ich trete die Kelter allein‹.« »Nach so langer Zeit, so vielem Schreiben auch nicht einmal Ihre Meinung, Ihr Urteil zu erfahren, nichts, gar nichts als ein zögerndes Lob und ein leises Versagen des Beifalls ohne Angabe von Gegengründen: das war mehr als ich fürchten, weniger als ich je hoffen konnte. Indessen bleibe es ferne von mir, gegen Sie mir auch nur in Gedanken einen Vorwurf zu erlauben. Denn Sie haben der gesamten Menschheit, der lebenden und kommenden, so Vieles und Großes geleistet, dass alle und jeder, an dieser allgemeinen Schuld der Menschheit an Sie, mit als Schuldner begriffen sind, daher kein Einzelner in irgendeiner Art je einen Anspruch an Sie zu machen hat. Aber wahrlich, um mich bei solcher Gelegenheit in solcher Gesinnung zu finden, musste man Goethe oder Kant sein: kein anderer von denen, die mit mir zugleich die Sonne sahen.«
In Goethes »Tag- und Jahresheften« lesen wir unter dem Jahre 1816: »Dr. Schopenhauer trat als wohlwollender Freund an meine Seite. Wir verhandelten manches übereinstimmend miteinander, doch ließ sich zuletzt eine gewisse Scheidung nicht vermeiden, wie wenn zwei Freunde, die bisher miteinander gegangen, sich die Hand geben, der eine jedoch nach Norden, der andere nach Süden will, da sie denn sehr schnell einander aus dem Gesichte kommen.« Unmittelbar vorher hatte Goethe der Schrift eines Gegners gedacht mit der sehr beherzigenswerten Bemerkung: »Professor Pfaff sandte mir sein Werk gegen die Farbenlehre nach einer den Deutschen angeborenen Zudringlichkeit.«
Als er Schopenhauer drei Jahre später (den 19. und 20. August 1819) zum letzten Mal sah, bemerkte Goethe in den Annalen: »Ein Besuch Dr. Schopenhauers, eines meist verkannten, aber auch schwer zu kennenden verdienstvollen jungen Mannes, regte mich auf und gedieh zur wechselseitigen Belehrung«.