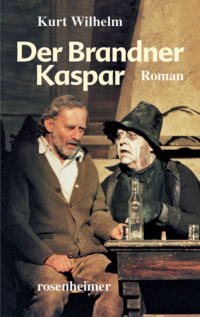Kitabı oku: «Der Brandner Kaspar», sayfa 3
»Der sell kunnt’s g’wesen sein, ja. Aber es macht nix.«
»Da kann man doch was unternehmen, damit Sie die Erlaubnis wieder erlangen. Ich bin gern bereit, als Jurist …«
»Dankschön, Herr Dokter, aber ’as Mitgehen am Pirschgang is genau a so scho schön, gar, wenn ma älter wird und bläder dazua.«
»Na, Sie doch net. Sie san doch das leibhaftige Leben, mit Ihre – wie alt san S’?«
»Zwoarasiebaz’ge bin g’wesen, vor etliche Wochen.«
»Na, also – mit zweiundsiebzig so vif beianand, des is doch a Gnade vom Herrgott.«
»Kann ma in Dankbarkeit sagen, ja.«
»Was ham S’ denn für an Verband um den Kopf? Is Ihnen was g’schehn?«
Es ist dem Kaspar nicht recht, dass man von seiner Verwundung erfährt. Und dem Senftl ist es schon gleich gar nicht genehm. Er hat zu langsam geschaut, als die Brandnerleut auf dem Platz erschienen sind. Als er sie verjagen hat wollen, hat der Hofadvokat schon mit dem Alten geredet, und er hat es sich nicht mehr getraut.
Nun muss er mit ansehen, wie der Senger den Alten zu den Großkopferten führt und berichtet, dass es unbemerkt zu einem gefährlichen Vorfall gekommen ist. Voll Ärger sieht er den Kobell, Graf Arco und den Reichenbach um den Brandner herumstehen und sich den Hergang erzählen lassen. Dann holt man gar noch den Prinzen dazu, den Gastgeber und Herrn der Jagd.
»Sie ham wirklich nicht g’sehn, wer’s gewesen sein könnt?«
»Tut mir Leid, Königliche Hoheit, nix.«
»Wer hat Sie denn in der Ohnmacht gefunden?«
»Der Florian Högg.«
»Geh, seids so gut, bittet’s mir den amal her. Vielleicht hat der wen erkannt. Wer war überhaupt droben platziert? Ist da nicht mein Jäger g’standen, der Haller? – Simmerl, kommen S’ doch amal her, bittschön!«
Sakradi, denkt der Senftl, jetzt kommt’s auf. Der Hundling, der Högg, wird’s verklagen, der Simmerl in seiner Blödheit bringt’s Herauslügen nicht z’amm, der Makel bleibt meiner Familie und mir. So ein Hundskopf, der Brandner! Nicht genug, dass er mir ein Wild weggeschossen hat, seinerzeit, jetzt macht er auf dem Wege des Mitleids sich gar noch Liebkind. Wer weiß, ob er denen nicht auch von dem Streit was erzählt, den wir gehabt ham –?
Prinz Carl besteht darauf, dass ein Medicus sich die Wunde besieht. Des Belgierkönigs Vertrauter, der sächsische Baron Christian von Stockmar, der Arzt war, ehe er sich der Geheimdiplomatie verschrieb, wickelt persönlich den Verband ab. Das Ohr blutet kaum mehr. Immerhin, kein Zweifel, das ging haarscharf am Tode vorbei. Sowas darf bei einer sauberen jagdlichen Ordnung nicht vorkommen. Der Florian Högg wird herbeigeführt und berichtet, dass der Brandner beim Erwachen etwas von einem schwarzen Kerl gefaselt hat.
Der Kobell flüstert ironisch zum Arco hinüber: »A ganz a Schwarzer? Uiui! War a Pfarrer dabei?«
»Wer sonst wär zuständig für die Schwelle zum Jenseits?«, grinst der leise zurück.
Der Medicus hält die Gestalt für ein Traumbild, das der Patient ins Erwachen geschleppt hat. Als aber der Prinz sich beim Simmerl erkundigt, ob jemand bei der Gesellschaft schwarze Kleidung trägt, da schluckt der verlegen, kriegt einen ganz roten Schädel und würgt schließlich heraus:
»Des net, Hoheit, aber – ich muss es vermelden, dass ich ganz in der Näh war und dass ich g’schossen hab.«
»Gib a Ruh«, fährt ihm der Kaspar ins Wort. »Dein Schuss war zu späterer Zeit, da bin ich schon wieder erwacht. Des hat nix zu tun mit dem!«
»Ich hab aber zweimal g’schossen, mit Verlaub, Königliche Hoheit. Einmal den Lenkschuss, wie der Hirsch abi zur Fürlege g’saust is, absichtlich nahe vorbei an ihm, in den Boden, und ’as zweite Mal, wie er wieder auf und davon g’roast is, ganz überraschend, als an versuchten Fangschuss.«
»Beide Schüss’ hab ich vernommen, und keiner von denen is’ g’wesen«, beharrt der Kaspar.
Prinz Carl legt seinem Jäger die Hand auf den Arm: »Es ehrt Sie, lieber Haller, dass Sie an diese Möglichkeit denken, aber san S’ friedlich: Sie waren’s net, wir müssen uns anderweitig erkundigen. Ich bring es zur Sprach bei der Jagdtafel, später, im Schloss drüben. Jetzt holen S’ an Wagen, dann fahren wir ihn heim, den Herrn Brandner.«
»Des braucht’s aber wirklich net, Hoheit, ich bin gut auf die Füß und hab auch zwei Leut zur Begleitung.« Der Kaspar beharrt aus Bescheidenheit und wehrt sich auch, als der Prinz ihn dem König von Belgien vorstellen will: »Hoheit, des braucht’s doch net, und i kann ja aa net Französisch.«
»Lieber Freund, einmal hat der Coburger auf sein Deutsch net vergessen, zum ändern waren Sie es, der den Hirschen für ihn aufg’funden hat. Also kommen S’ getrost, der Leopold freut sich, ich versprech’s Ihnen.« Des aa no, denkt der Senftl voll Ingrimm, wie der Prinz höchstselbst den Brandner vor den König hinführt. Ihn schmerzt diese Huld. Er ist neidig, dass dem Hofmeister gewinkt wird, der ein Geschenk zureicht und der Brandner einen goldenen Taler bekommt, als Dank, zum Trost und als Angedenken, und dass die Herrschaften um den Alten scharwenzeln, als sei er der Mittelpunkt. »Vielen Dank, zu viel Ehr, unverdient«, murmelt der Kaspar verlegen ein über das andre Mal, und weil er sich der Franzosenzeit seiner Jugend erinnert, sagt er noch mutig zum Belgier: »Merci beaucoup, Majestät«, eh er sich unter Verneigungen zurückzieht.
Eine leise schnarrende Stimme fragt den lurenden Senftl: »Pardong, Sie wissen, wer dieser Mann ist, um den man sich derart auffällig bemüht?«
»A windiger Jagdhelfer, der sich an Schuss eing’fangen hat, a Irgendwer, weiter net wichtig.«
Der Fragende ist ein eleganter junger Herr mit Schmissen im glatten Gesicht, gekleidet in eine nagelneue Jagduniform. Er blickt leicht blasiert, raucht eine Zigarette und sieht so wichtig und einflussreich aus, dass der Senftl sich allsogleich anbiedert:
»Gestatten, dass ich mich vorstell, Alois Senftl mein Name, eigentlicher Bürgermeister von Tegernsee, gewissermaßen. Und mit wem hab ich die Ehre?«
»Leutnant von Zieten, Adjutant des königlich preuß’schen Gesandten am bayerischen Hofe. Finde alles hier kolossal. Bin erst seit drei Tagen im Lande, muss sagen, äußerst disturbierend, verstehe kein Wort von dem, was die Leute so reden, aber insgesamt kolossal urig.«
»Gell, ja. Den meisten nördlichen Herrschaften gefallt’s bei uns gut. Wenn Sie mir die Ehre erweiserten, dass ich Ihnen beim Eingewöhnen behilflich sein dürft …«
»Wird dankbarst angenommen, Herr Bürgermeister.«
Das tut gut. Der Senftl belässt es bei der Titulatur. Er hört sie gar zu gern, und der Fremde braucht ja nicht wissen, dass er nur der Stellvertreter ist. Er wird es schon noch erreichen, dass ihn die zähen Leute zum Alleinherrscher des Ortes erwählen, na was denn …
Der Brandner kommt am Senftl vorbei, beider Blicke streifen sich, und wie der Senftl sieht, ist der Kaspar totenblass. Da kann er nicht anders, er grinst ihn mit seinen glühenden Augen so freundlich an, als sei nie etwas zwischen ihnen gewesen, der falsche Hund. Der Kaspar schüttelt nur seinen Kopf und geht weiter, zum Marei, das mit dem Flori bescheiden abseits steht.
Da geschieht ihm abermals etwas Unerwartetes. Sein Schritt wird unsicher, er stolpert, schwankt, taumelt und wäre gestürzt, hätte der Flori ihn nicht rasch noch gestützt.
Wieder muss der Senftl erleben, dass es ein Hallo gibt um den Alten, dass man sich erneut um ihn schart, dass der Freiherr von Stockmar noch einmal beigezogen wird, einen Schwächeanfall nach der übergroßen Aufregung feststellt, Ruhe verordnet und der Prinz apodiktisch befiehlt, der Brandner sei in einer Kutsche nach Hause zu fahren.
Der Simmerl bittet dringlich, ihn kutschieren zu dürfen, aber die Dienstpflicht verbietet es, er ist im Moment unentbehrlich. Während die Gesellschaft zur Jagdtafel hinüber ins Schloss Tegernsee zieht, ist er es, der beaufsichtigen muss, dass die Strecke und alle Jagdgerätschaften pünktlich dorthin verbracht werden.
Im Hin und Her stellt Dr. Senger seinen Jagdwagen zur Disposition. Der Flori soll ihn kutschieren, den Alten abliefern und das Gefährt dann zum Schloss Tegernsee bringen.
»So a G’schiss um den alten Deppen«, knirscht der Senftl in sich hinein, während er huldvoll lächelnd behilflich ist, den Wagen herbeizuführen. Er tut öffentlich dar, wie gewogen er der Brandnerfamilie ist, denn er kennt das Leben. Er weiß, der Kaspar ist von nun an nicht mehr nur ein geduldeter Kleinhäusler, der keinen Rückhalt hat. Wer von den hohen Herrschaften bemerkt und gefördert wird, darf ein besseres Leben und Beachtung erhoffen.
Das weiß er genau, weil sein eigener Aufstieg begann, als er sich beim König anwanzte, durch jene G’schicht, an die er nimmer erinnert sein mag.
Damals, als Jungem, war es ihm notig gegangen, und er hat Straßenarbeiten gemacht. Er war nicht grad fleißig dabei, das kann niemand behaupten. Oft ist er auf seinem Schubkarren gesessen und hat Brotzeit gemacht. Wie er einmal so dahockt, kommt die Kalesche des Königs Max I. Joseph vorbei, und der Monarch ruft herüber, leutselig oder ironisch, das hat er nicht ausmachen können:
»Recht guten Appetit, lieber Freund!«
Er ist hochgerumpelt, hat sich verneigt, hat im Verwirrnis sein Brot hingestreckt und gerufen:
»Dank, gnädiger König! Wir waar’s – mitgehalten?«
Da sind Majestät tatsächlich ausgestiegen und haben in das dargebotene Brot gebissen. Das war der entscheidende Augenblick.
Der Senftl hat gleich recht gezahnt und gejammert, wie schlecht es ihm geht, hat sich hingekniet und sein Lamento beschlossen:
»Sonst kann i nix tun für Enk, aber ich will fleißig beten für die gnädige Majestät.«
Das hat dem gutmütigen König gefallen. Er hat geschmunzelt: »Bet du für mich. Ich kann für dich auch was anderes tun«, hat sich den Namen sagen lassen, und schon am Abend hat der Senftl einen Beutel Dukaten bekommen und den Bescheid, dass er für den Hof arbeiten darf.
Von da an ist er überall besser behandelt worden, weil Protektion halt Reputation mit sich bringt, so sind die Leut, kannst nix machen. Damals begann sein Aufstieg, und wie man ihm draufgekommen ist, auf welch anlassige Weise er ihn erreicht hat, wurde er zum Gespött. Aber nicht lang. Er hat es den Klatschmäulern, den grinsenden, bald gezeigt, dass mit ihm von nun an zu rechnen ist.
Und jetzt, verflucht, denkt er, kann es sein, dass der Kaspar genauso in die Gnade kommt! Das hat noch gefehlt!
Eifrig besorgt hilft er beim Einsteigen und kommt dabei mit dem Marei in nahe Berührung, was ihm angenehm ist. So alt ist er nicht, trotz erwachsener ehelicher Kinder sowie derer, für die er insgeheim zahlen muss, dass ihm bei einem so frischen Geschöpf nicht einfiele, wie man herumtaubern muss, um sich zu nähern. Könnte er sich das Marei geneigt machen, würde der Kaspar zerspringen vor Wut, und er selber hätte zudem noch sein Vergnügen. Als er das denkt, lächelt er sie so liebreich und so verheißungsvoll an, dass die sich nur wundert, wie ein Mensch sich so zu verstellen imstand ist. Aber sie sagt es nicht.
Sie geniert sich ohnehin in ihrem Bubengewand und möchte rasch fort, ohne aufzufallen. Sie wagt es auch nicht, den Herrn Reichenbach wegen einer Arbeit für den Flori anzureden. Sie lächelt verlegen, als die Gesellschaft ihnen bei der Abfahrt zuwinkt und gute Wünsche nachruft.
Sie kutschieren im leichten Trab an Kaltenbrunn und dann an Gmunds dreißig Häusern vorbei, der Flori auf dem Bock, der Brandner und das Marei im Fond wie ein hochherrschaftliches Nobelpaar, zu ihren Füßen der Söllmann. Sie staunen, wie schnell es vorangeht, vorbei am Bauern am See, den Sandweg am Ufer entlang, schauen, genießen, kommen sich stolz vor, und der Kaspar denkt, dass es so eine Ehr in seiner Jugend gewiss nicht gegeben hätte, weil man damals noch nicht demokratisch war.
Sie begegnen Abendspaziergängern, Sommerfrischlern aus der Stadt. Man trifft sie seit einiger Zeit immer häufiger. Früher war ein fremdes Gesicht was Besonderes – wer kam schon hierher außer Weinreisenden, Schmusern, Händlern mit Holz oder Vieh und gelegentlich ein paar spinnerten Engländern. Seit aber König Max I. Joseph Schloss Tegernsee zur Sommerresidenz erkor, ist es, als sei dieses Tal entdeckt worden wie weiland Amerika und seine Indianer.
Die Sonne geht hinter dem Hirschberg hinab, der See erglänzt blau und golden, in den Rainen und Wiesen ratschen die Grillen, es wird kühler und stiller. In Quirin, beim Kircherl am See, hält der Viehtrieb vom Angermanngütl sie auf. Ihr elegantes Gefährt steckt in der muhenden, trottenden Herde. Die Kühe, die heim in den Stall geführt werden, sind aufgeregt, weil ein Pferd in der Nähe ist. Die Magd vom Gütl, die Genovefa, die mit dem Marei in die vom König eingerichtete Näh- und Strickschule geht, staunt nicht schlecht, als sie die Fahrgäste erkennt.
»Habt’s ihr in der Lotterie g’wunna?« ruft sie. Der Brandner antwortet ihr würdig: »Glei zwoamal, Vevi. Ich die Kutsch und sie des Ross, und jetzt samma so fürnehm, dass du künftig fei Sie sagen musst zu mir, und zu ihra gnädiges Fräulein!«, und dann feixen sie alle.
Sie überlegen den Weg, denn das einzelne Pferd kann den steilen Anstieg zum Hof gewiss nicht bewältigen. Das letzte Stück wird der Kaspar zu Fuß gehen oder auf dem ausgespannten Ross reiten müssen.
»Ich hatsch auffi, macht’s keine Krampf, ich bin doch scho wieder wie neu«, sagte er. »Kutschier du beim Westerhof auffi, so weit als es geht, dann kehrts ihr um und bringts den Wagen gleich z’ruck. Ich mag des Entgegenkommen net gar a so ausnutzen.«
Hinter ›Maria Schnee‹, der kleinen Kapelle, wo der Albach in den See sich ergießt, schlägt das Pferd selber den Weg hinauf ein. Es kennt ihn, er führt ja zum Lustschloss seines Herrn, Dr. Senger, und es zieht kraftvoll empor.
Die Sonne ist hinunter, die Silhouetten der Berge stehen scharf und blauschwarz vor dem in vielen Farben leuchtenden Himmel, und der Kaspar kann auf den schimmernden See hinabsehen. Er hat nicht die Wahrheit gesprochen, als er sagte, er sei schon wieder wie neu. Sirrend und klingend bedrängt seinen Schädel der unausweichliche Schmerz, und durch seine Glieder rieselt Kälte in Schüben und Wellen.
Ihm ist elend und fremd, und plötzlich fasst ihn der Gedanke, dass er das alles irgendwann ein letztes Mal sieht, dass das Sterben zu jeder Minute dicht beim Lebendigsein steht und dass er heut nicht einmal mehr Abschied hätte nehmen können von seiner Welt.
Ja, hätte er den Schädel um eines Fingers Breite zur Seite geneigt, er läge seit einer Stunde tot auf der Erde. Hätte er zur Mittagsstunde gedacht, dass ihn zu Abend eines Fingers Breite vom Tode trennt, von einem plötzlichen Sterben, das er nicht einmal wahrnehmen könnte? Dass er mitten aus seinem selbstverständlichen Leben ohne Abschied dahin gemusst hätte?
Wohin?
Erzählt der Herr Pfarrer jemals, wie das Sterben geschieht? Der sagt nur, dass vielleicht in einem lichten Himmel voll Engel und Heiliger das Paradies und die ewige Seligkeit warten, dass Sünder hinab ins Fegfeuer müssen. Was mir geschehen wäre, nachdem mich der Schuss aus dem Leben riss, davon schnauft er nichts.
Wär ich gestürzt ins Bewusstlose, Schwarze? In ein dunkles Reich, von dem alte Bücher und Weissagungen künden? Ich kann’s mir nicht ausmalen. Ist dieses Reich, unsichtbar, stets so dicht neben uns, dass in jeglicher Stunde eines Fingers Breite genügt, uns in seine ewige Finsternis zu stürzen? In jeder Minute unwahrnehmbar nah, ohne dass wir es merken? Wie geschieht die Verwandlung? Wie kann ein Geschöpf, Mensch oder Tier, grad noch voll Leben sein und gleich darauf unwiderruflich erloschen und tot? Wo ist das hin, das es lebendig hat sein lassen?
Herrschaft, was denk ich heut für a Zeug z’amm, schimpft er mit sich. Ich bin oft genug am Tode vorbeig’rutscht, und nie haben mich solche Gedanken bedrängt. Damals, wie auf der Pirsch am Setzberg der Steinschlag herunter ist mit Rumpeln und Poltern, wie links und rechts die Brocken eingehaut haben, da hätt mich, um des Fingers Breite, ein Trumm derschlagen können. Oder wie der Blitz neben mir in die Eiche gefahren ist, unter der ich den Augenblick vorher noch Schutz gesucht hab vor dem Gewitter. Wie oft werd ich, ohne es zu spüren, so nah am Tode gewesen sein?
Wenn ich’s nie gespannt hab, dass die nächste Minute die letzte sein könnt, warum hämmert’s mir heut so im Hirn? Ich bin wiederum unbeschadet davongekommen, mir droht keine Gefahr. Werd ich dappig und feig? Ich muss mich zusammenreißen.
»Dir is doch net gut, Großvater«, sagt das Marei besorgt, »du schaust drein, als wär dir net extra. Sollt ma anhalten, und du rastest dich aus?«
»Nix. Es ist alles, wie es sich g’hört. Wir sind ja gleich droben. Des Ross zieht ja wie der Deifi den Berg ’nauf, Sapristi!«
Ein paar hundert Schritte vom Haus wird der Weg zu steil und zu lehmig, da geht es nicht weiter, der Wagen bleibt stecken. Der Flori wirft die Zügel über den Weidezaun und schirrt so weit ab, dass das dampfende Tier sich beugen und grasen kann. Dann gehen sie das letzte Stück hinauf. Der Söllmann läuft vor ihnen her und kriecht gleich in seine Hütte beim Stall.
Dem Brandner sein Anwesen war früher einmal eine Hube. Heut ist es kein Lehen und nicht einmal mehr ein Halblehen, sondern nur noch eine Sölde, ein Sechzehntel von einem richtigen Hof.
Ihm gehört noch das niedrige Haus mit dem geneigten Schindeldach, der Altane aus Holz im ersten Stockwerk, den kleinen Fenstern, um die herum eine Lüftlmalerei verblasst. Die vielen Geranienkästen, die das Marei liebevoll pflegt, lassen es freundlich genug herschauen. Im Stall stehen drei Schafe, zwei Küh und zwei Ochsen, einer für die Arbeit und einer zur Mast, zum Erwerb. Früher waren da zwei Dutzend Milchvieh und die vier Rösser vom Fuhrgeschäft seines Vaters eingestellt, nun ja. Eine Loas mit vier Fackein liegt drinnen im Koben. Im Verschlag nebenan sind nur mehr zwei Enten und sieben, acht Hühner. Gäns gar keine mehr.
Der Wald hinterm Haus gehört schon lang nicht mehr ihm. Nur noch das Dicket aus Fichten und Buchen den Hang zum Albach hinunter. Der verläuft seit über vier Jahren außerhalb seiner Grenze, seit er, um dem Senftl Schulden zu zahlen, das Land mit dem Bach schweren Herzens dem Pfliegel verkauft hat, dessen stattlicher Hof im Dämmer in der Entfernung zu sehen ist.
Ans Haus grenzten einstmals sechzig Tagwerk bucklige Gründ. Zwölfe davon sind ihm verblieben. Das meiste ist Grasland, ein Acker Kartoffeln und ein Eckerl, wo der Roggen gedeiht, auf dass er sein eigenes Brot hat, das dankbar und fromm mit dem IHS des Brotstempels geweiht wird, und vor dem Anschneiden mit dem Messer bekreuzigt.
Im Stadel, an den das Brennholz sauber geschlichtet ist, stehen der große und der kleinere Wagen und der zum Odeln. Dort sind die alten Gerätschaften aufbewahrt: Strohschneider, Gsootbank, Schäffel, Dengelstock, Sattlerbank und die Hoanzlbank fürs Bearbeiten kleinerer Hölzer. Und natürlich das Heu für das Vieh. Voll wird er nimmer. Im Winter hacheln und kämmen er und das Marei dort das bissei Flachs, das oberhalb wächst, das sie zuvor geriffelt und am heißen Ofen gebrechelt haben, und das Marei ist tüchtig im Spinnen und Weben.
Am Stadel das Backhaus, daneben seine finstere Schlosserwerkstatt mit dem alten – zu alten – Werkzeug. Alles sauber geordnet und ein bissei heruntergekommen, weil es so lang schon am Nötigen fehlt.
Sie gehen durchs Sommergatterl in den Vorgarten mit den Blumen, dem Gmüs und den Krautern. Sie öffnen die Haustür, auf deren Stock das segnende 18 C + M + B 56 mit Kreide geschrieben steht. Hinter der Tür nimmt der Kaspar den Weichbrunn – heut ist ihm danach – und schlägt das Kreuz, dankbar für seine Heimkehr.
»Bring ma dich gleich ’nauf ins Bett?«, fragt das Marei, aber er mag noch nicht liegen, er will in die Stube, zum Lehnstuhl. Es ist bereits dunkel. Das Marei zündet die Petroleumlampe an, hockt sich nieder, zieht ihm die Stiefel aus und bringt die Hauspantoffeln mit den hölzernen Sohlen. Er lässt sich heut die Bedienung gefallen, weil er sich doch recht hart schnauft und keine Kraft in sich spürt.
»Ich mach dir was z’ essen.« Das Marei will in die Kuchl, doch er hält sie zurück:
»Dankschön, i mag nix. Ich brachtert nix nunter. Ich brauch bloß a Zeitl mei Ruh zum staad Sitzen und Ausschnaufen.«
Der Flori steht herum wie ein fremder Besuch und schaut ein bissei besorgt drein: »’s Beste is g’wiss, i druck mi und bring den Wagen zurück.«
»Das Marei soll mitfahren!«
»Geh, Großvater, ich lass dich doch jetzt net allein.«
»Und dein Treiberlohn? Wir ham’s net grad zum Verschenken, Madl. Du fahrst mit zur Jagdtafel und holst ihn dir ab. Da kann der Senftl nix machen dagegen. Nimm die Kraxen mit, dass d’ was heimschleppen kannst, im Fall was von der Strecke an die Treiber verteilt wird.«
Das Marei möchte schon gern zum Gelage, aber sie zögert: »Des wär doch net zum Verantworten, bei dei’m Zustand …«
Der Alte muss sie hinausstampern zum Umziehen, weil sie im Treibergewand, als Bub, dort nicht gut auftauchen kann. »Schleun di«, sagt er, »net dass die besseren Trümmer alle vergeben san.«
Das Marei lacht und gehorcht nur zu gern.
Während sie in ihrer Kammer sich putzt, mag der Flori in seiner jugendlichen Neugierde noch einmal über die Vorfälle reden:
»Du hast den Schwarzen doch ’kennt und magst es net sagen, aus Schonung für ihn. War’s dem Simmerl sein Schuss?«
»Is doch Wurscht. Es ist gut ausganga und damit vergessen. Ich hab niemand kennt und bin mir auch nimmer sicher, ob da wirklich wer war. Der Doktor wird schon Recht haben, es war a Traum, mehra net.«
»I glaub aber schon, dass es der Simmerl gewesen sein könnt.«
»Und wenn – ich wär ihm net gram, es wär net mit Absicht geschehn.«
Der Flori geniert sich ein wenig, ehe er allzu neugierig wissen mag:
»Is ’as Marei immer noch Freund mit dem?«
Der Kaspar schmunzelt, weil sich der junge Dutterer gar so plump über den Rivalen erkundigt:
»Des fragst sie selber. I schaug net dahinter – des is ihra Sach’.«
»Und die Drohung vom Senftl? Die war ja beinah wie a biblischer Fluch. Ich mein’, so ein Garneamd, wie ich, der richtet nix aus gegen ihn. Aber traut der sich wirklich an euch?«
»Bei dem weiß ma nie. Er is a tüchtiger Mann, er hat seine Verdienste, auch um die Gemeinde, aber halt a Ruach, a Geizkragen, a Zornniggel und a Gifthaferl dazu.«
»Des kannst aber laut sagen. Seine Knecht sind der Ansicht, sie derleben es noch, dass den der Schlag trifft, vor Giez und vor Geiz. Der werd amal blau im G’sicht und fallt um – auf des warten s’.«
»Man soll neamd nix Böses net wünschen, aber eine Vermahnung kunnt dem g’wisslich net schaden. Es war oft g’nua nah dran, dass s’ ihn ins Haberfeld treiben, so harb sein manche auf ihn. Was meinst, hat er’s dir gegenüber ernst g’meint?«
»Glaub schon. Ich geh nachert z’ruck auf sein Hof, in mei’ Kammer, und wart ab, was er morgen daherred’t. Kunnt aa sein, i triff ihn jetzt noch, drunten im Schloss, dass er da scho was sagt …«
»Geh ihm heut aus ’m Weg. Heut is er noch z’ gifti.«
»Vorhin, wie sich die Herrschaften um dich bekümmert ham, da war er ganz zahm und hat sogar aufs Marei a ganz a süße Fotzn hing’macht. Ihren Treiberlohn werd er na doch net verhindern, oder was meinst?«
Sie hätten noch mehr hin und her überlegt, wäre nicht das Marei hereingekommen, unternehmungslustig und voll Vorfreude. Im Feiertagsgewand mit dem Schalk sieht sie so zum Abbusseln aus, dass der Brandner ganz stolz auf sein ansehnliches Enkelkind wird.
»I waar ’s, Flori! Großvater, im Herd is noch Feuer, kanntst dir die g’schmalzene Brotsuppen aufwärmen, wenn dir danach is. Dann gehst aber ins Bett, des musst mir versprechen. Du schaugst zwar schon wieder ganz frisch her, aber besser is besser. Gib gut auf dich Obacht und mach keine G’schichten. Wenn’s dir schlechter gehn sollt, läutest die Glocken oben am Haus. Die hör ich bis drunten und bin glei bei dir.«
»Wenn ’s mir letz wurert, hätt i den allerbesten Nothelfer gleich bei der Hand«, sagt der Alte, holt den Kerschgeist des Simmerl aus seiner Tasche und lacht: »Jetzt druckt’s euch, ihr zwoa, vor i euch ’nausschmeiß! Hat ma denn niemals a Ruh vor euch Junge?«
Er ist so guter Dinge, wie er da sitzt in dem Lehnstuhl, dass sie fröhlich und sorglos davoneilen können. Er sieht durch das Fenster sie ins letzte Dämmerlicht laufen, hört ihre Stimmen, das Anschirren drunten, das Wenden des Wagens, das Schnauben des Sengerschen Pferdes. Sie rasseln davon, es wird still.
Da ist er allein und allem ausgeliefert, was kommt.