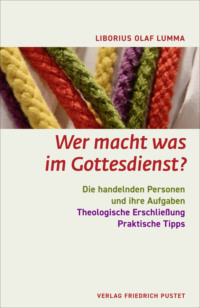Kitabı oku: «Wer macht was im Gottesdienst?», sayfa 3
2 Vereinssitzung, Theaterstück oder offener Himmel –
wenn Christen sich versammeln
Katholischer Gottesdienst: Bühne und Publikum
Über viele Jahrhunderte wurde das Lebensgefühl Liturgie feiernder Katholiken wie folgt geprägt: Man geht in die Kirche, wo eine Gruppe von Menschen etwas vorführt: Gesten, Texte, Musik. Davon profitiert man: Man kommt zur Ruhe, entflieht dem Alltag, denkt über den Sinn des Lebens nach, betet zu Gott, gibt dem Leben eine Zielrichtung. Wenn man möchte, kann man an dem Geschehen aktiv mitwirken: Man beteiligt sich am gemeinsamen Liedersingen, man antwortet auf vorgesprochene oder vorgesungene Formeln in einer vertrauten Weise, man nimmt vorgesehene Körperhaltungen ein und so weiter.
Liturgie war ein Bühnenstück mit gewissen Mitmach-Elementen, aus dem man persönlichen Gewinn zog oder jedenfalls ziehen sollte. Der Raum, in dem das alles stattfand, war aufgeteilt in eine Art Bühne und einen Zuschauerraum. Zwischen beiden Bereichen bestand eine architektonische Grenze: mehrere Stufen, eine kleine Trennmauer oder Ähnliches. Wer sich auskannte, wusste, dass diese Grenze während des Rituals und sogar außerhalb des Rituals nur nach genauen Regeln und nur von bestimmten Personen überschritten werden durfte. Alles andere war ein Störfaktor, wenn nicht ein Skandal.
Die alles entscheidende Rolle in diesem Geschehen spielte eine einzige Person, die das Zeremoniell leitete. Sie musste männlich sein, die katholische Priesterweihe empfangen haben, nahm auch im Alltagsleben der Gemeinde eine besondere Stellung ein, war in der Kirche und außerhalb der Kirche schon durch die Kleidung erkennbar und genoss besonderes gesellschaftliches Ansehen. Dieser Priester wurde im Ritual von einigen assistierenden Personen ergänzt, manchmal handelte es sich auch bei ihnen um Priester, jedenfalls waren alle männlich. In bestimmten Rollen agierten bevorzugt Kinder.
Gottesdienst als Versammlung
Im 20. Jahrhundert hat sich vieles davon geändert. Diese Änderungen geschahen Schritt für Schritt, und sie geschehen auch heute noch. Innerhalb dieser langfristigen Entwicklung gab es einen besonders großen einzelnen Schritt: die Neuherausgabe des Messbuchs 1969 zuerst in lateinischer Sprache, anschließend in den verschiedenen Landessprachen. Dies geschah auf Grundlage der durch das Konzil begründeten und inhaltlich skizzierten Liturgiereform. Die Zulassung der Landessprachen darf zweifellos als einer der bahnbrechendsten Konzilsbeschlüsse gelten.
Viele katholische Gemeinden pflegen aber auch heute noch die Mentalität eines Publikums, das den Spezialisten – zum Teil hauptamtliche Mitarbeiter der Kirche, zum Teil Ehrenamtliche – beim Ritual „zuschaut“ und die einzelnen Mitmach-Elemente mit mehr oder weniger aktiver Beteiligung über sich ergehen lässt.
Diese Einstellung wird allerdings der Liturgie nicht gerecht. Grundmodell der Liturgie ist nicht das Gegenüber von Bühne und Zuschauerraum, sondern die Versammlung der Kirche, oder besser: die Versammlung als Kirche, oder noch besser: die Kirche als Versammlung.
Dabei handelt es sich nun nicht etwa um eine neumodische Idee des 20. Jahrhunderts, sondern um etwas, das sich in der frühen Selbstfindung des Christentums genauso festmachen lässt wie in den liturgischen Büchern, und zwar durchaus auch den liturgischen Büchern vor dem Konzil. Das Konzil wollte Liturgie nicht neu definieren, sondern die Bedeutung der Liturgie, die im Prinzip für alle Zeiten gilt und gegolten hat, die aber nicht allen Beteiligten im Bewusstsein war, deutlich herausstellen und daraus Konsequenzen für die Praxis ziehen, konkret für die Neuherausgabe liturgischer Bücher.
Zu den wichtigsten Aufträgen Jesu gehörte es, Menschen zu (ver-) sammeln (Lk 11,23; Joh 11,52 – an beiden Stellen steht im Neuen Testament dasselbe griechische Wort, das auch den jüdischen Versammlungsraum Synagoge bezeichnet). Paulus spricht von der Versammlung der Gemeinde (was auch mit Versammlung als Kirche übersetzt werden kann, siehe 1 Kor 11,18 und 14,23). Das Versammeltsein und dabei Einssein der Kirche ist eine Vorausschau auf eine vereinte Menschheit, die von Frieden erfüllt ist und in der der Tod keine Macht mehr hat (Joh 17). Diese endgültige Einheit und dieser endgültige Friede sind kein Menschenwerk, sondern können nur von Gott kommen. Insofern bleibt die Kirche als Versammlung derer, die zu Jesus Christus gehören und mit ihm und unter seiner Führung eins sind, immer vorläufig und unerfüllt.
Die Versammlung der Kirche weist in doppelter Weise über sich selbst hinaus. Sie verweist zurück in eine Vorzeit, in der ihr Ursprung liegt: Ohne Jesus – und Jesus wiederum eingebettet in die Geschichte Israels – und die Geschichte der ersten Christengenerationen würde es die heutige Versammlung der Kirche gar nicht geben. Außerdem verweist die Versammlung auf die Zukunft, denn die Einheit der Menschheit in Frieden, die sich in der Kirche anfanghaft ausdrücken soll, ist hier und jetzt und aus menschlicher Kraft gar nicht in ganzer Fülle möglich. Ihre Erfüllung kann es nur in der Zukunft geben, und sie wird kein Menschenwerk sein, sondern ein Geschenk.
Liturgische Versammlung und himmlisches Jerusalem
Wenn sich die Kirche als Versammlung bildet, dann folgt sie dem Auftrag, den sie von Jesus erhalten hat, und sie beruft sich auf seine Zusage (Mt 18,20). Damit steht die Versammlung zugleich als Repräsentantin der gesamten Menschheit vor Gott. Denn Christsein bedeutet, Hoffnung auf Leben und Frieden für alle zu haben, auch jene, die nichts von Gott wissen oder nichts von ihm wissen wollen (Joh 17,18).
Die Versammlung der Kirche ist somit zugleich eine visionäre Vorausschau. Sie bringt hier und jetzt zum Ausdruck, was es hier und jetzt noch nicht gibt, nämlich Einheit und Frieden. Die Versammlung macht ihre eigene Hoffnung hier und jetzt erfahrbar, obwohl die Erfüllung dieser Hoffnung noch aussteht.
Aus diesem Grund muss sich die Versammlung der Kirche symbolischer Ausdrucksweisen bedienen. Denn nur im symbolischen Handeln kann Unsichtbares sichtbar und erfahrbar gemacht werden, wie etwa Einheit aller in Frieden, ohne Grenzen von Raum und Zeit oder von Schuld und Tod.
Das Konzil schreibt: „In der irdischen Liturgie nehmen wir vorauskostend an jener himmlischen Liturgie teil, die in der heiligen Stadt Jerusalem, zu der wir als Pilger streben, gefeiert wird“ (SC 8). Jerusalem ist schon im Alten Testament Ausdruck für die gemeinsame Heimat aller Menschen (Ps 95) und wird im Neuen Testament in einer symbolisch aufgeladenen Erzählung zum Bild der Zukunftshoffnung (Offb 21–22,5). Kein Zufall also, wenn manche christlichen Kirchengebäude als himmlisches Jerusalem künstlerisch ausgestaltet sind.
Liturgie ist Manifestation der Kirche (SC 41) in ihrer Ausrichtung auf das Vergangene – ihren geschichtlichen Ursprung – und das Zukünftige – ihr Ziel in der Erfüllung aller menschlichen Hoffnung.
Ekklesia als Versammlung
Das griechische Wort, das sich im frühen Christentum zur Selbstbeschreibung ausbildete, war ekklesia, meist als Kirche, manchmal als Gemeinde oder Versammlung übersetzt. Der Wortherkunft nach bedeutet ekklesia so etwas wie „die Herausgerufenen“. Dieser Begriff stammt nicht aus der antiken Religionssprache, sondern aus dem Feld der Politik. Er bezeichnete beispielsweise eine städtische Bürgerversammlung. Auch für die wichtigsten Ämter der christlichen Gemeinden wurden Begriffe übernommen, die weniger in die antiken Religionen als mehr in das private Vereinswesen gehörten, wobei zugegebenermaßen die Grenzen fließender waren als in der uns heute vertrauten Trennung von Staat und Religion. Das Wort episkopos (Bischof, Kapitel 8), wörtlich Aufseher, bezeichnete Leitungsämter unterschiedlicher Art wie etwa den Stifter oder Finanzier eines Vereins. Presbyter (Kapitel 8) waren Mitglieder kollektiver Leitungsorgane von Gemeinschaften, die man vielleicht als Ältestenrat, Vorstand oder Senat in unsere Welt übertragen könnte. Ein diakonos (Diakon, Kapitel 10) übernahm Hilfsdienste unterschiedlicher Art, etwa in der Organisation von Versammlungen. Heute würde dem vielleicht eine Mischung aus Sekretär, Pförtner, Eventmanager und Kellner entsprechen.
Das Christentum wollte sich vermutlich durch solche Ämterbezeichnungen von anderen Religionen abgrenzen und den Gemeinschaftscharakter der Kirche herausstellen: Christen sind die, die sich zu einer ekklesia versammeln. Die wichtigste dieser Versammlungen ist die Eucharistiefeier, in manchen alten christlichen Sprachen wurde das Wort Versammlung dann auch zum Namen der Eucharistiefeier.
Liturgische Rollen im Verhältnis zur Versammlung
Wenn dieses Buch einzelne liturgische Rollen näher erschließen und Kriterien für die sachgerechte Ausübung entwickeln soll, dann steht folgende Leitfrage im Hintergrund: In welchem Verhältnis steht die einzelne Rolle zur Versammlung der Kirche? Jede Rolle ist Dienst an der Versammlung, damit die Versammlung sich als das erfährt, was sie sein soll. Eine christliche Gemeinde versammelt sich nicht wegen ihres Bischofs (Kapitel 8) oder wegen der Leiterin der Wort-Gottes-Feier (Kapitel 9), sondern umgekehrt: Bischof und Wort-Gottes-Feier-Leiterin üben ihre liturgische Rolle wegen der Versammlung der Kirche und für die Versammlung der Kirche aus. Liturgische Rollen sind niemals Selbstzweck.
Liturgische Rollen sind auch keine privilegierte Beziehung zu Gott oder zu Jesus Christus. In Bezug auf Gott und auf Christus sind alle Angehörigen der Kirche gleich. Wo es Unterschiede in der öffentlich ausgeübten Rolle gibt, ergeben sie sich aus ihrem Bezug zur Versammlung.
Man könnte es auch so sagen: Aus einer Versammlung, in der alle gleich sind – nämlich von Gott in die Kirche berufen –, treten einzelne Personen heraus, um dann für die Versammlung zu handeln, und zwar im Doppelsinn des für: einerseits im Dienst der Versammlung, andererseits stellvertretend für die Versammlung, je nachdem, um welche Handlung es sich im Einzelnen handelt (wie im Folgenden noch zu sehen sein wird).
Trotz der großen Bemühungen durch das Konzil ist dieses Liturgie- und Rollenverständnis noch immer nicht bei allen Beteiligten angekommen: von den Hauptamtlichen bis zu denen, die nur gelegentlich zur Versammlung dazustoßen.
Architektonische Rahmenbedingungen
Einen großen Beitrag zu diesem Defizit leistet die Architektur, die über viele Jahrhunderte ein anderes Verständnis der Versammlung in Szene setzte, nämlich das schon beschriebene Gegenüber von liturgisch Handelnden und fromm Anwesenden, oder anders gesagt: Bühne und Zuschauerraum. Alte Kirchenräume verdienen es, mit ihrer Geschichte, ihrem kunsthistorischen Wert, der Augen- und Linienführung im Raum usw. ernst genommen zu werden. Sie sind aber oft ungeeignet, um Versammlung erleben und erfahren zu können.
Es wurde und wird seit einigen Jahrzehnten viel ausprobiert und wieder verworfen, umgebaut, neugebaut und wieder rückgebaut, so dass ich für dieses Buch nicht von einer typischen Gestaltung eines katholischen Liturgieraums nach dem Konzil ausgehen kann. Bei Kirchenräumen der byzantinischen Tradition – um noch einmal kurz einen Abstecher ins östliche Christentum zu machen – ist das völlig anders. Sie folgen immer derselben Raumaufteilung, ganz gleich ob man in einem winzigen Provisorium oder einer riesigen Kathedrale Liturgie feiert.
Ich werde es daher in diesem Buch immer bei Hinweisen allgemeiner Art belassen müssen. Die Konkretisierung kann nur in jedem Gottesdienstraum einzeln vorgenommen werden. Ich habe aber mittlerweile einen Favoriten unter den Raumkonzepten, nämlich das Modell des Chorgestühls, bei dem sich die Versammlung in Gruppen aufteilt, die einander gegenüberstehen und anschauen. Das muss kein starres Gegenüber von zwei Seiten sein, es kann sich auch in Richtung eines Halboder Dreiviertelkreises oder -ovals erweitern. Die Erfahrung einer aus konkreten Menschen bestehenden Gemeinschaft ist im Chorgestühl unmittelbar gegeben, wenn man sein Gegenüber ansieht und selber angesehen wird. Sowohl in der Mitte als auch an der Stirnwand des Raumes befinden sich Stellen, die von überall gut zu sehen sind. So kann man sowohl ein symbolisches Zentrum erfahren als auch sich gemeinsam symbolisch nach außen öffnen – auf das dazu passende lateinische Schlagwort extra nos werde ich in Kapitel 3 noch in anderem Zusammenhang eingehen.
Das Wir und das Amen
Der Versammlungscharakter der Kirche wird in einem sprachlichen Detail deutlich, das von allerhöchster Bedeutung ist. An Gott gerichtete Gebete – in der Eucharistiefeier sind dies das Tagesgebet, das Gabengebet, das Eucharistische Hochgebet und das Schlussgebet – sind in der katholischen Liturgie immer in der Wir-Form formuliert, niemals in der Ich-Form. Das ist umso bemerkenswerter, als diese Gebete nur von einer einzelnen Person laut hörbar vorgetragen werden, nämlich dem Liturgievorsteher (Kapitel 9).
Warum darf jemand wir sagen, obwohl die anderen dabei schweigen?
Die Antwort gehört zum Wichtigsten, das es zu christlicher Liturgie zu sagen gibt. Zunächst einmal ist offensichtlich: Niemand darf ohne das Einverständnis der anderen wir sagen. Das gilt im Prinzip immer und überall. Wer ohne die Erlaubnis der anderen wir sagt, handelt übergriffig und unrechtmäßig. So ist es auch in der Liturgie. Wer sich öffentlich an Gott wendet und wir sagt, macht sich davon abhängig, dass die anderen das Gesagte bestätigen, und das können sie natürlich nur im Nachhinein. Man spricht hier von der Ratifikation eines Gebetes, etwa so, wie wenn eine Regierung einen Vertrag mit einem anderen Land aushandelt und anschließend vom eigenen Parlament die Ratifikation (Gültigmachung) des Vertrags erbitten muss. Lehnt das Parlament ab, so ist der Vertrag nicht zustande gekommen, auch wenn er noch so feierlich vor Fernsehkameras unterzeichnet worden ist.
Es ist so ähnlich wie bei der Vorsitzenden, die von der Entlastung durch die Vereinsmitglieder abhängig ist (siehe Kapitel 1): Wer ein Wir-Gebet vorträgt, drückt gegenüber Gott eine Gemeinschaft aus, in deren Hände er sein Schicksal legt. Die Gemeinschaft muss das wir erst noch bestätigen, ansonsten ist es nicht zustande gekommen. Die Ratifikation geschieht in der Liturgie tatsächlich: Die Versammlung sagt Amen – das kommt aus dem Hebräischen bzw. Aramäischen, ist in der christlichen Liturgie nie übersetzt worden und bedeutet nichts anderes als So sei es, Jawohl oder Zustimmung.
Zugegeben: Durch seine häufige Verwendung wurde das Amen in der christlichen Liturgie erheblich stilisiert. Es wurde zu einer boshaften Redewendung, mit der man ausdrückt, dass man auf Mitsprache verzichtet: „zu allem ja und Amen sagen“. Es wird auch heute kaum jemandem auffallen, wenn jemand in der Liturgie das Amen verweigert und stattdessen den Kopf schüttelt oder sich aus der Versammlung schleicht. Das Amen hat dasselbe Schicksal erfahren wie die Entlastung des Vorstands in den meisten Jahreshauptversammlungen: Der Bericht des Vorstands wird einfach durchgewunken, die meisten Mitglieder lesen den Bericht überhaupt nicht, interessieren sich nicht für die finanziellen Details (oder verstehen sie gar nicht erst) und wollen eigentlich nur, dass die Sitzung schnell vorbeigeht und das Buffet eröffnet wird. Aber auch dort gilt: Die Vereinsmitglieder tragen trotzdem die Verantwortung für ihre Abstimmung, und das kann erhebliche rechtliche Folgen haben.
Eine christliche Versammlung, die sich über die Bedeutung ihres Amen im Klaren ist, hat schon das Allerwichtigste ihrer liturgischen Rolle verstanden: Sie bildet, sie trägt und sie bestätigt das wir, das in der Liturgie zu Gott spricht. Im Amen zeigt sich die Mitgliedschaft zur Kirche und die Zustimmung zur gemeinsamen Ausrichtung auf Gott. Darin sind alle gleich. In dieser Rolle ist die Versammlung durch nichts und niemanden zu ersetzen, vor allem nicht durch den Vorsteher allein.
Insofern ist es ein sehr sinnvolles Projekt der gegenwärtigen Kirchenmusik, attraktive Melodien für den Ruf Amen zu erarbeiten und ihnen zu breiter Bekanntheit zu verhelfen. Mancherorts gelingt das schon ganz gut. So soll die Würde und Bedeutung des Amen besser zum Ausdruck gebracht werden als durch das belanglose Gemurmel, das man in katholischen Kirchen meistens hört. Wo ein Amen in einer solchen Weise erklingt und von der Versammlung so mitgetragen wird, dass es gar keiner theoretischen Erklärung mehr bedarf, sondern Gemeinschaft stiftet und die ganze Versammlung auf Gott ausrichtet, ist die wichtigste Grundlage für jede Liturgie gegeben, auf der alles andere aufbaut.
Gemeinsam vorgetragene Wir-Texte
Nun drängt sich eine Frage auf: Warum werden Wir-Gebete nicht einfach von allen gemeinsam gesprochen? Dann käme das wir doch viel besser zum Ausdruck, und nebenbei könnte man sich auch das floskelhafte Amen sparen.
(Kleine Anmerkung: Der Fachbegriff für liturgische Wir-Gebete lautet Oration oder Kollektengebet. Auch das Eucharistische Hochgebet, das größte und wichtigste liturgische Gebet, hat die Wir-Form.)
Die Idee scheint attraktiv, sie ist aber in der Praxis nur sehr schwer umzusetzen. In der katholischen Liturgie wechseln die Wir-Gebete jeden Tag, nur wenige wiederholen sich mehrmals im Jahr. Egal wie gut Sie es üben, egal ob Sie diese Texte sprechen oder singen: Sie werden es nicht schaffen, solche Texte gemeinschaftlich so vorzutragen, dass das irgendjemand akustisch verstehen kann. Alle werden vorrangig damit beschäftigt sein, auf die Atempausen, das Sprechtempo und auf die Aussprache der anderen zu achten. Vom eigentlichen Text lenkt das erheblich ab, aber genau um diesen Text geht es ja: ihm sollen alle zustimmen und dadurch die Kirche bilden.
Gemeinsames Vorlesen bewirkt übrigens auch soziale Ausgrenzung. Wer sich mit den Augen schwertut oder Analphabet ist, wird vor den anderen bloßgestellt, weil er nicht mitsprechen kann, und im Stimmengewirr der anderen kann er dann nicht einmal mehr verstehen, was da eigentlich inhaltlich gesagt wird.
Weil der Text verstanden werden soll, ist es sachgerecht, dass er nur von einer einzelnen Person laut vorgetragen wird. Man kann es auch aus einer anderen Perspektive beschreiben: Damit Wir-Texte verständlich bleiben, hat die Kirche ein eigenes Amt für den Vortrag geschaffen, nämlich das Amt des Liturgievorstehers (Kapitel 9). Der Vorsteher stellt sich in den Dienst der Versammlung, indem er anstelle unverständlichen gemeinsamen Genuschels einen verständlichen Text vorträgt, und zwar im Namen der Versammlung und mit Zustimmung der Versammlung. Der Vorsteher ist deswegen aber keineswegs mächtiger als die anderen, denn ohne das Amen der Versammlung ist alles, was er tut, unwirksam.
Nur in einem einzigen Fall lässt sich gemeinschaftlich vorgetragenes Gebet gut umsetzen, nämlich wenn der Text sehr häufig wiederkehrt und allen so gut bekannt ist, dass sich ein einheitlicher Sprechrhythmus etabliert hat, ohne dass es stressig oder unverständlich wird. In der Tat: Das Herrengebet (Vaterunser), das ja auch ein an Gott gerichtetes Wir-Gebet ist, wird in der katholischen Liturgie meist gemeinschaftlich gesprochen oder gesungen. Aber selbst das ist erst eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Zuvor beschränkte sich die Versammlung – wenn überhaupt – auf die letzte Zeile sondern erlöse uns von dem Bösen, alles andere wurde nur vom Vorsteher vorgetragen.
Konsequenzen für die Praxis
Schon an dieser Stelle ergeben sich erste Konsequenzen für die Praxis. Eine Versammlung, die das Amen nicht aktiv übernimmt, kann auch nicht die Verantwortung tragen, die ihr liturgisch zukommt. Das geschieht natürlich meistens nicht aus Boshaftigkeit oder bewusster Verweigerung, sondern aus Unkenntnis. (Dass es Menschen gibt, die wegen Krankheit, Gebrechlichkeit oder fehlender Sprachkenntnisse nicht aktiv und laut zustimmen können, ist ohnehin klar; darum geht es hier natürlich nicht.) Es zeigt sich, wie dringlich eines der Anliegen ist, die das Konzil ganz nach oben auf die Tagesordnung der katholischen Kirche gesetzt hat: liturgische Bildung, und zwar liturgische Bildung aller, nicht nur der Hauptamtlichen. Für liturgische Bildung sind theoretische Kenntnisse hilfreich, aber noch entscheidender ist das, was man heutzutage best practice nennt: Die katholische Kirche braucht dringend Orte, an denen Liturgie in sachgerechter Gestaltung erlebt und dabei zugleich erlernt werden kann. Die Theorie braucht man dann nur noch, um die Sache besser zu verstehen, aber nicht, um sie überhaupt zu verstehen. Dieses grundlegende Verstehen geschieht ohnehin nicht rational, sondern durch das Miterleben und Sich-Hineinbegeben in die Würde der Versammlung als Trägerin der Liturgie.
Ein weiterer Aspekt: Ein Liturgievorsteher, der das Amen selbst spricht, handelt gegenüber der Versammlung übergriffig (so wie die Vereinsvorsitzende, die bei der Entlastung des Vorstands schnell noch ihre Stimme in die Wahlurne wirft, in der Hoffnung, dass das niemandem auffällt). Natürlich hat auch das oft praktische Gründe und ist gut gemeint – der Vorsteher will den Menschen helfen, an der richtigen Stelle das Richtige zu sagen –, aber es läuft langfristig darauf hinaus, die Versammlung zur Zuschauerin zu degradieren, anstatt sie als Trägerin der Liturgie und damit als Kirche ernst zu nehmen. Haupt- und Ehrenamtliche stehen hier vor einem unlösbaren Problem, denn oft müssen sie Gottesdienste leiten, in denen nur sehr wenige oder gar keine Mitfeiernden ihre Rolle kennen und aktiv ausfüllen, zum Beispiel bei Taufen, Trauungen oder Begräbnissen. Das muss man dann irgendwie praktisch regeln und versucht es vielleicht mit eingeschobenen kommentierenden Anleitungen, mit der Produktion von Liturgieheften, aus denen der gesamte Ablauf hervorgeht, oder mit radikaler Vereinfachung des gesamten Rituals. Wie man es auch tut: Immer wird das Bild von Bühne und Publikum verstärkt, wahlweise auch von Lehrer und Schülern oder von Mächtigen und Machtlosen. Die Liturgie wird unweigerlich den Charakter einer Belehrung bekommen, sie wird dem alltäglichen Leben als Fremdkörper gegenüberstehen, anstatt das Leben symbolisch zu deuten und ihm eine Zielrichtung zu geben.