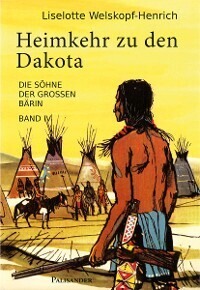Kitabı oku: «Heimkehr zu den Dakota», sayfa 5
»Lasst die Musik weiterspielen und die Mädchen weitertanzen. Holt nur die besten Männer heraus. Wenn wir uns lange genug arglos verhalten, werden die Dakota die Bretterbude überfallen, in der die Männer sich berauschen, und wir können die Angreifer fassen. Das ist besser, als wenn sie uns rings aus dem Dunkel beschießen. Wenn die Dakota eingedrungen sind, können wir sie umzingeln, so wie sie uns jetzt zu umzingeln meinen. Wir werden auf diese Weise rascher mit ihnen fertig und können noch dem Zug Hilfe schicken, wenn es notwendig wird.«
»Gibt es hier Männer, auf die wir uns bei einem solchen Streich unbedingt verlassen können?«
»Hau. Wenige, aber einige gibt es.«
»Du holst sie?«
»Hau.«
»Dann gehe ich in die Trink- und Tanzbude, wo gekämpft werden wird. Einverstanden? Wir treffen uns dort wieder, wenn es die Zeit noch erlaubt.«
»Hau.«
»Und ich?« rief der Stationsleiter. »Und ich? Brown! Ihr habt Grenzerfahrung! Was soll ich tun?«
»Ihr pustet eure Ölfunzel aus und haltet euch in eurer Bude im Dunkeln bereit, mit ein paar handfesten Kerlen zusammen, die Harry schickt.«
»Wir müssen mit Brandpfeilen rechnen«, sagte der Indianer.
»Also die Brunnen besetzen und die Wasserfässer füllen. Schlimmstenfalls gießen wir auch das Bier aus ...«
Der Stationsleiter sank auf seinen Stuhl und untersuchte, ob sein Revolver geladen war.
Joe und der Indianer verließen den Raum. Vor der Tür trafen sie den Maler und Henry. Joe unterrichtete die beiden. Der Indianer wollte sich nach dem letzten Wort, auf das er schon in Ungeduld verratender Haltung gewartet hatte, sofort auf seinen Weg machen, als ihn die Erwiderung des Malers noch festhielt.
»Ich besitze das Totemzeichen eines großen Dakotahäuptlings«, sagte Morris, »unter dessen Schutz ich somit stehe. Ob es nicht möglich wäre, zu verhandeln, ehe das Blutvergießen beginnt?«
Der junge Kundschafter wollte auf diesen Vorschlag, so überraschend er für alle kam, eingehen. Joe aber schnitt ihm das Wort kurz ab: »Du bist nicht gefragt, Harry, und zum Verhandeln ist es in dem jetzigen Stadium überhaupt zu spät. Es ist eine große Büffelherde in der Nähe. Die Dakota rasen sicher in der Befürchtung, dass wir ihnen wieder einmal die Büffel wegschießen könnten. Vielleicht lässt sich mit den Leuten reden, sobald wir gesiegt haben. Damit sie endlich Vernunft annehmen und meine Bahn hier in Ruhe lassen!«
»Ich gehe mit Langspeer zu einem Brunnen«, erklärte der Maler. »Wir halten uns dort zum Wasserschöpfen bereit. Ich schieße nicht auf die Dakota; das verbietet mir mein Freundschaftsverhältnis.«
»Macht, was ihr wollt.« Joe war nervös. »Ich jedenfalls sorge dafür, dass alle unsere Männer ihre Waffen bereithalten, auch die in der Tanzbude, und dass alle erfahren, auf wen sie zu hören haben.«
Er gab Harry einen Wink, zu tun, was besprochen worden war, und der Indianer verschwand im Dunkel zwischen Zelt und Buden.
Die Nachricht von dem bevorstehenden Kampf verbreitete sich im Stationslager wie ein Lauffeuer. Unruhe, ungewöhnliches Umherlaufen war nicht zu vermeiden. Joe konnte den Geiger nicht überreden, unter solchen Umständen weiterzuspielen. Harry musste verständigt werden. Er griff ein und schickte den Zigeunerprimas, mit dem Bill seinen letzten Hahnenkampf ausgefochten hatte. Die beiden Hahnenkämpfer maßen sich feindselig, aber als die Geige zu singen begann, fand Bill sich doch bereit, mit der langgewachsenen Lilly zusammen weiterzutanzen und dadurch noch vier beherzte Paare bei Musik und Tanz festzuhalten. Totenbleich und schwitzend vor Angst, schenkte der Wirt einen Brandy nach dem anderen aus und kassierte mit den Kellnern und Kellnerinnen zusammen, so schnell es sich nur irgend machen ließ. Er war ungewiss, wo die Kasse am sichersten sein könnte, und schleppte sie dahin und dorthin, bis er sie endlich wieder an den alten Platz brachte. Der Alkohol flößte den schon halb betrunkenen Gästen größeren Mut ein, und sie erfüllten die Bretterbude mit Verwünschungen und mit wildesten Versicherungen, was sie den verdammten Rothäuten alles antun wollten.
Unterdessen waren die Brunnen mit zuverlässigen Grenzern besetzt worden, und es wurden so viele Fässer wie möglich gefüllt.
Joe und der junge Indianer trafen sich wieder bei der Tanzbude. Harry hatte sich seine zwanzig Männer zusammengesucht. Der kampfgewandte Kellner war darunter und ein alter Trapper, mit dem Harka sich vor Jahren nach einer großen Büffeljagd über die Beute verständigt und zusammengefunden hatte.
»Wenig«, sagte Joe. »Wie viele Dakota kommen?«
»Hundert bis Hundertzwanzig.« Harry sprach leise und sehr schnell. »Ich werde eine List anwenden müssen. Ich habe eine Kriegspfeife, wie die Dakotahäuptlinge sie benutzen, um im Kampf das Zeichen zum Angriff oder zum Rückzug zu geben. Ich schleiche mich jetzt hinaus. In der Nacht können mich die Dakota nicht von ihren eigenen Kriegern unterscheiden. Ich werde sie in Verwirrung bringen, indem ich zu früh zum Angriff pfeife und dann mitten im Kampf zum Rückzug.«
»Ob das gutgeht? Aber du trägst deine eigene Haut zu Markte, und uns kann kein Schaden entstehen. In Ordnung ...«
Der Indianer war den Augen der Weißen gleich wieder entschwunden.
An einem der größten Brunnen, in der Nähe der Schank- und Tanzbude, saßen Morris, Harry, Langspeer und drei weitere Männer. Sie hatten sich in den Schatten gehockt, so dass sie weder vom Mondlicht noch von einem Schimmer aus der im Innern beleuchteten Bude getroffen wurden. Sie versuchten, den Gesang der Zigeunergeige und die heiseren Schreie des Hahnenkampf-Bill und seiner Tänzerin aus ihrem Gehör auszuschalten. Sie versuchten zu horchen und zu spähen, aber es gelang ihnen schlecht. Langspeer, der Cheyenne, hatte von allen noch das feinste Gehör und das schärfste Auge.
»Sie sind nahe«, sagte er nach einiger Zeit zu Morris.»Ich spüre es.«
Alle Nerven waren angespannt, alle Muskeln und Sehnen bereit. Ein unheimliches Surren ging durch die Luft. Dann flammten die ersten Brandpfeile auf dem Dach der Baracke auf.
In demselben Augenblick schrillte eine Pfeife nördlich des Lagers, und eine kräftige, weittragende Stimme erhob gellend den Kriegsruf der Dakota: »Hi-jip-jip-jip-hi-jaah!«
Ringsumher, aber doch noch ziemlich entfernt, erschallte das Kriegsgeschrei, dem Häuptlingsruf antwortend. »Hi-jip ... jaah!«
Die Tanzmusik brach ab, die Schreie des Hahnenkampf-Bill und seiner Tänzerin verstummten. Henry und seine drei – ihm nicht näher bekannten – Gefährten am Brunnen hatten die Büchsen und Flinten im Anschlag. Von Norden her schien der erste und wütendste Angriff zu erfolgen. Eine Gruppe gespenstischer Gestalten sprang durch das Dunkel. Da waren sie schon im Lager und drangen in Richtung des Brunnens und der Schank- und Tanzbude vor. Ein einzelner Anführer war ihnen weit voran. Henry und die drei Grenzer am Brunnen feuerten. Der Anführer fiel mitten aus einem Sprung zu Boden und überschlug sich dabei. Zwei weitere Indianer stürzten.
»Der erste war Harry«, sagte Langspeer zu Morris.
»Sie haben ihn erschossen!« Morris hob den Arm vor die Augen. Der Cheyenne aber sah, dass Harry wieder aufsprang und den weiter heraneilenden Angreifern voran die Schankbude erreichte. Die Dakota liefen am Brunnen vorbei, ohne sich überhaupt um die Schützen dort zu kümmern. Sie drangen hinter dem jungen Kundschafter, ihrem vermeintlichen Anführer, sofort in die Schankbude ein. Dort erschallte noch einmal das schrille Signal der Kriegspfeife. Dann entstand ein fürchterlicher Tumult, so dass die Wände zusammenzubrechen drohten. Das Dach begann zu brennen.
»Löschen!«, schrie Henry.
Er wollte ein Fass in Bewegung setzen, aber ein neuer Feind tauchte am Brunnen auf, ein Indianer, das Schlachtbeil in der Hand; in seinem Haarschopf steckten Falkenfedern. Henry erhielt einen Schlag und stürzte.
Morris sah schon das Beil über seinem eigenen Schädel schweben. »Geheimnisstab!«, schrie er auf. »Ich bin Geheimnisstab! Schone deinen weißen Bruder, Tashunka-witko!«
Der Indianer warf das Beil einem der fliehenden Grenzer in den Nacken und stürmte weiter. Zwei Dakotakrieger, die ihm folgten, nahmen die Feuerwaffen der Brunnenverteidiger mit.
In der Bretterbude, in der der Kampf im Gange war, befand sich Joe. Er hatte gesehen, wie die ersten Feinde die Tür öffneten und hineinfluteten wie Wasser, das einen Staudamm durchbrochen hat. Er erkannte auch Harry, der diese Gruppe führte, und nun im hellen Licht von den Irregeführten als ihr Feind erkannt werden musste. Harry war der einzige der Indianer, der nicht mit den Kriegsfarben bemalt war. Er hatte sich umgewandt und stieß den Dakota, der sich unmittelbar hinter ihm befand, mit dem Messer nieder.
»Kojote und Verräter!«, brüllten die nächsten auf und versuchten, sich gemeinsam auf ihn zu stürzen.
Von rings her fielen aber jetzt die Weißen über die eingedrungenen Indianer her, von denen die meisten keine Feuerwaffen hatten und Pfeil und Bogen im Nahkampf nicht gebrauchen konnten. Sie besaßen nur Messer und Keule und waren auch taktisch im Nachteil. Sie wurden zurückgedrängt. Durch die Schüsse und das Kampfgedränge wurden die Lampen zertrümmert. Es wurde dunkel in der Baracke, was den Indianern wieder zugutekam. Dann fielen die ersten brennenden Schalbretter der Decke herunter, und die Verwirrung vermehrte sich noch.
Draußen, vor der Bude, blies eine Häuptlingspfeife zum Rückzug. Joe wusste jetzt selbst nicht mehr, ob dies ein echtes oder vorgetäuschtes Signal war. Konnte Harry aus dem Haus hinausgelangt sein? Vielleicht durch das Dach? Die Indianer, die das Rückzugssignal vernommen hatten, kämpften mit aller Macht, um der Umklammerung im Saal zu entkommen. Aber an der Tür trafen sie auf neue Gegner, die sie wieder in den Saal hineindrängten. Das waren die zwanzig entschlossenen Kerle, die Harry zusammengerufen hatte. Die Bretterwand hielt dem Getümmel nicht mehr stand. Sie brach ein, und das zum Teil brennende Dach stürzte auf die Kämpfenden herunter.
Morris betrachtete sich vom Brunnen aus die Lage und sah ein, dass ein Löschen der brennenden Bretter im Gedränge der schießenden, schreienden, sich packenden und wälzenden Männer völlig unmöglich war. Auch Langspeer war dieser Meinung, und die beiden bückten sich zu Henry, der beim Brunnen noch am Boden lag. Sie stellten fest, dass er noch am Leben war; das Beil musste ihn mit der Flachseite getroffen haben.
Da Gewehr- und Revolverkugeln durch die Luft pfiffen, warfen sich Morris und Langspeer zu Boden. Die beiden vernahmen Joes kräftige Stimme, die durch den Höllenlärm drang, und sie hörten eine zweite, befehlende Stimme, die eines Indianers.
»Tashunka-witko!«, rief Langspeer dem Maler ins Ohr. »Er will Harry haben, tot oder lebendig! Er fordert ihn heraus, sich ihm zum Kampf zu stellen, und er fordert seine Krieger auf, Harry zu töten oder gefangenzunehmen. Dann wollen sich die Dakota zurückziehen. Ihr Angriffsplan ist gescheitert.«
Niemand benutzte mehr die Kriegspfeife. Die Dakota hatten die List begriffen, der sie zum Opfer gefallen waren.
Die Kämpfenden hatten inzwischen die brennenden Bretter ergriffen, um sie als Waffe gegeneinander zu benutzen. Dabei erloschen die Flammen allmählich. Joe brüllte zum Angriff. Tashunka-witko befahl den Rückzug.
Die Kämpfenden kamen allmählich auseinander. Das allgemeine Gedränge zerteilte sich in kleinere Gruppen. Keuchend noch vor Anstrengung und Erregung hatten die Männer doch schon wieder den Atem, um zu fluchen und zu drohen. Immer noch knallten Schüsse, und Morris blieb vorsichtshalber am Boden liegen, zog auch Langspeer zu sich her, als dieser sich erheben wollte. »Lass!«, sagte er. »Wir haben uns herausgehalten, und wir wollen nicht jetzt noch Blut vergießen.«
Das Geschrei und der Kampf zogen sich aus dem Lager hinaus. Es schien den Dakota zu gelingen, sich von den Weißen abzulösen.
Endlich wurde es still. Morris atmete leichter. Er hasste das Morden.
Joe tauchte beim Brunnen auf. Er schien zu bluten und trank durstig und hastig. »Was ist mit Henry?«, fragte er.
»Schlag auf den Kopf, aber er lebt noch.«
Joe ließ sich erschöpft zur Erde fallen, aber nur für ein paar Sekunden. Schon war er wieder auf, um die Männer, die noch kampffähig waren, zu sammeln und auf Wache einzuteilen. Ein Trupp von Wagemutigen sollte sich zu Pferd aufmachen und dem Zug zu Hilfe eilen, der wahrscheinlich ebenfalls bedroht war. Für diese Aufgabe meldeten sich vor allem Teilnehmer aus dem Trupp der zwanzig, die Harry ausgesucht hatte.
Joe kam noch einmal zum Brunnen zurück. »Hat einer von euch Harry gesehen?«, fragte er in die Dunkelheit und dem noch nicht aufgelösten Durcheinander.
»Zu Anfang ...«
»Unsinn. Jetzt, meine ich.«
»Nein.«
»Wo kann er denn nur stecken! Unter den Toten ist er auch nicht!«
»Vielleicht gefangen?«
»Der ergibt sich nicht. Der weiß doch, was ihm dann blüht.«
Joe lief wieder weg. Morris und Langspeer hörten, wie der Reitertrupp davongaloppierte, um dem Zug zu Hilfe zu kommen.
Es war durchaus möglich, dass entflohene Feinde in der Finsternis der Prärie draußen noch mit Pfeil und Bogen lauerten; darum verhielten sich die meisten im Lager ruhig und blieben so gut wie möglich in Deckung. Morris und Langspeer machten sich aber auf, um den schreienden und stöhnenden Verwundeten, Männern und Frauen, zu helfen, soweit sie es vermochten. Viel konnten sie nicht tun, es mangelte an allem. Die Baracke des Stationsvorstehers, wo sich das Sanitätsmaterial befunden hatte, war aufgebrochen und durchwühlt. Taylor II saß erschöpft auf einer übrig gebliebenen Treppenstufe und strich sich über den lockigen Skalp, der ihm erhalten geblieben war.
Bei der ersten Hilfe für die Verwundeten ließ es sich nicht vermeiden, dass Morris und Langspeer sich zeitweise trennten, um möglichst rasch an mehreren Stellen zu helfen. Die Lampen in Zelten und Baracken waren alle zerstört oder gelöscht, das Feuer erlosch. Es wurde ringsum dunkel, die Augen mussten sich wieder daran gewöhnen, den spärlichen Schimmer der Sterne aufzunehmen und die Finsternis aufmerksam zu durchdringen. Morris und Langspeer verloren sich zeitweise und verständigten sich dann wieder durch Zurufe.
Bei einem Verwundeten, dem Morris helfen wollte, hatte er ein merkwürdiges Erlebnis. Er hatte zwischen den Trümmern der eingestürzten Bretterbude einige Tote gefunden, zwei Weiße – ein Mann und eine Frau –, und vier Indianer. In der Nähe der vier toten Dakota lag noch ein verletzter Indianer, der vergeblich aufzukommen versuchte. Morris wollte sich seiner annehmen, konnte sich aber mit dem Mann nicht verständigen und traf auf erbitterten Widerstand. Da er auf diese Weise dem anderen nicht zu helfen vermochte, selbst aber in Gefahr kam, ließ er ab und zog sich aus den schwelenden Trümmern zurück. Dabei kam ihm jemand entgegen, jemand oder ein Etwas; es lief wie ein Mensch, starrte den Maler aus dem Dunkel aber mit einer Fratze an, die ihn zurückschauern ließ. Als er ein paar Schritte weitergelangt war, schaute er sich noch einmal um, weil er seinen eigenen Sinnen nicht traute, und meinte, von einem Gespenst geträumt zu haben. Da beobachtete er, wie die Gestalt mit dem Fratzengesicht dem Verwundeten aufhalf. Es huschte noch ein Indianer herbei, der im vollen Besitz seiner Kräfte zu sein schien, und dann waren die beiden samt dem Schwerverletzten verschwunden. Morris wusste nicht genau, wie und wohin.
Er rief nach Langspeer, und als er mit diesem zusammen nochmals durch die Trümmer ging, war nicht nur der Verwundete, sondern es waren auch die vier gefallenen Dakota verschwunden.
»Vielleicht gibt es unter uns hier einige, die den Dakota helfen, ihre Verwundeten und Toten wegzuschaffen«, mutmaßte der Cheyenne. »Sonderbar. Aber schließlich, warum sollten sie nicht? Ich glaube, es ist besser, wir haben morgen keine Gefangenen hier. Der Mob würde sie zerreißen.«
Morris und Langspeer arbeiteten an ihrem Hilfswerk weiter und blieben jetzt immer eng zusammen. Es war noch nicht viel Zeit verflossen, als beide aufhorchten. Ein dumpfes, mächtiges, unheimliches Dröhnen erfüllte Luft und Boden. Es schien näher zu kommen.
»Die Büffel!«, schrie Langspeer. »Die Büffel!«
Eine Stimme kreischte, als ob einer den Verstand verloren habe.
Langspeer suchte nach den Pferden. Sein eigenes und das des Malers fand er zwar nicht mehr, aber er griff dafür zwei andere am Zügel und führte sie zu Morris herbei. »Wenn die Büffel hierherkommen«, sagte er, »müssen wir Pferde haben, sonst sind wir verloren.«
»Gott behüte, die Büffel werden doch nicht ... Wir können auch Henry nicht im Stich lassen!«
Das Dröhnen nahm nicht ab. Es schien, als bebte der Boden eine endlose Zeit. Doch nahm die Herde nicht Richtung auf die Station.
»Irgend jemand jagt die Büffel«, sagte Langspeer. »Sonst galoppieren sie nicht mitten in der Nacht.«
»Vielleicht entschädigen sich die Dakota durch Jagdbeute für ihre Verluste hier. Konkurrenz können wir ihnen bei dieser Herde nicht mehr machen. Das hat Tashunka-witko doch erreicht.«
Als es endlich zu tagen begann, hätten die Menschen auf der Station am liebsten vor Freude geschrien, denn jetzt erst fühlten sie sich vor feindlichen Pfeilen sicher.
Aber bei Tageslicht wurden auch die Schäden, die entstanden waren, erst in vollem Maße übersehbar. Die Toten wurden zusammengetragen. Die Verletzten stöhnten und bettelten um Wasser und Hilfe für ihre Wunden.
Bleich, übernächtigt war Morris unterwegs, um an Menschenleben zu retten, was noch zu retten war. Die lange Lilly hatte das Schicksal ereilt. Halb verkohlt lag sie auf den Resten des Tanzbodens. Bill hockte bei der Toten, murmelte Flüche und wickelte sein Halstuch, das er um die blutende Hand gebunden hatte, eben wieder auf. Morris erbot sich, die Hand zu verbinden.
»Wenn ich den Harry zu fassen kriege, den Verräter«, murmelte Bill, während er Morris die Hand hinhielt, »dann hat das Schwein nichts mehr zu lachen.«
»Harry war es, der uns rechtzeitig gewarnt hat«, sagte der Maler.
»Der? Die Indsmen hat er gegen uns angeführt! Und wie!«
»Nein, nein, Bill, er hat sie mit Gefahr seines Lebens in die Falle gelockt!«
»Schöne Falle! Da!« Bill wies auf die Tote. »Da! In der Falle umgekommen! Aber ich weiß, was ich tun werde!«
»Um Gottes willen, Bill! Sprich erst mit Joe!«
»Ach, der! Kommt hergelaufen, und schon will er das Kommando führen! Nichts als Unglück bringt der uns! Damals das Gift, jetzt den Überfall.«
Morris hielt es für das beste, sich nicht weiter mit Bill auseinanderzusetzen. Nach einer solchen Kampfnacht mochten wohl vielen die Nerven reißen, und verrückte Parolen mochten umgehen, bis das vernünftige Urteilsvermögen wieder einkehrte. Der Maler band das Halstuch kunstgerecht um Bills verletzte Hand und ging.
Der Wind wehte und beugte das Gras in langen Wellen. Sand und Asche stäubten immer noch auf. Taylor II stand mit ein paar Bahnbediensteten beim Gleis und schaute die Schienen entlang nach Westen. Er wartete auf Nachricht von dem Zug. Joe war nicht im Lager. Er hatte sich dem Trupp angeschlossen, der dem Zug nachgeritten war.
Morris und Langspeer suchten von ihren Habseligkeiten zusammen, was noch zu finden war. Die Pferde waren verloren, ausgebrochen oder von den Dakota erbeutet. Dagegen fanden sich die Maultiere wieder ein.
Während sich alle diese Vorgänge im Stationslager abspielten, durchlebten auch die Bediensteten und Fahrgäste des Zuges keine ruhigen Stunden.
Als Morris, Joe und Henry am Abend ausgestiegen waren, um im Stationslager Quartier zu nehmen, hatte es sich Familie Finley möglichst bequem gemacht. Douglas stand wieder am Fenster, futterte nebenbei die Schokolade, die er jetzt nicht mehr verschmähte, und dachte sich, angeregt durch die letzten Gespräche mit Joe und Morris, aufregende Abenteuer aus, die er natürlich siegreich und möglichst als Retter seiner Familie und des ganzen Zuges bestand.
Als es früh Nacht wurde und die Sterne über der Prärie aufleuchteten, schnarchte Herr Finley in der Ecke.
Plötzlich ging ein scharfer Ruck durch den Zug. Die Räder standen still. »Was ist denn?«, fragte Ann Finley den Jungen am Fenster. »Hier kann doch nicht schon wieder eine Station sein?«
»Ist auch keine.«
Douglas freute sich über die Abwechslung, die durch das unvorhergesehene Ereignis eintrat. »Ma, vor der Lokomotive winkt einer mit Brandfackeln.«
»Allmächtiger!«
Herr Finley hörte auf zu schnarchen, öffnete blinzelnd die Augen, klappte den Unterkiefer, der ihm heruntergesunken war, wieder mit dem Oberkiefer zusammen und knurrte: »Könnt ihr denn keine Minute Ruhe geben!«
»Aber um Gottes willen, George! Brandfackeln!« Frau Finley packte hastig alles zusammen, was sie auf der langen Reise ausgepackt hatte.
»Der Zug brennt? Aber Ann, du hast wohl schlecht geträumt.«
Die Pfeife war in Gang. Herr Finley tat zwei Züge. »Wo sind wir denn eigentlich?«
»Im Wilden Westen, Pa!«
»Dummer Junge! Ich sehe übrigens keine Brandfackeln.«
»Der Mann ist damit zur Lokomotive gegangen, und da hat er sie ausgelöscht.«
»Ach, der wollte unterwegs einsteigen! Auch ’ne Methode, das muss ich sagen! Wirklich ›Far
West‹. Aber dann wird es ja bald weitergehen.« Es ging jedoch nicht weiter.
»George, wir müssen uns doch erkundigen, was los ist!«
»Wieso denn? Das Bahnpersonal hat uns zu unterrichten.«
Viele Passagiere flüsterten unruhig.
Dann gingen zwei der Bahnangestellten durch den Waggon und gaben bekannt, dass nicht der geringste Grund zur Aufregung bestehe. Eine riesige Büffelherde passiere die Gleise. Der Zug müsse leider warten, bis die Tiere abgezogen seien. Die meisten Fahrgäste nahmen diese Mitteilung mit stoischer Ruhe hin und richteten sich wieder bequem ein, um die angesagten Wartestunden möglichst angenehm zu überdauern.
Herr Finley jedoch, der sich prominent und als sehr erfolgreicher Geschäftsmann fühlte, betrachtete das Verhalten der Büffel und das Zurückweichen der Union Pacific, an der er beteiligt war, als eine Art persönlicher Kränkung.
»Das ist ja ... das ist ja ... also ich habe überhaupt keine Ausdrücke mehr!«, schrie er den Vertreter des Bahnpersonals an. »Warum fahren wir nicht weiter? Wem müssen Sie Haftpflicht bezahlen, wenn Sie einen Büffel überfahren? Oder wollen Sie Büffel jagen? Ich habe keine Worte mehr! Ich habe keine Stunde zu verschwenden. Wer ist denn hier das Rindvieh, die Büffel oder wir?«
»Die Büffel, Sir.«
Die Zugangestellten hatten Herrn Finley auf der langen Fahrt kennengelernt. Erst war er ihr Alpdruck gewesen, dann hatten sie sich darauf eingestellt, durch Ruhe mit ihm fertig zu werden. »Wollen Sie gestatten, Sir, dass ich Ihnen die Herde zeige?«
»Ich steige nicht aus.«
»Wird nicht unbedingt nötig sein. Ich stelle Ihnen mein Fernglas zur Verfügung.«
»Solche Scherze können Sie mit meinem Jungen machen, aber nicht mit mir!«
Douglas ergriff die Gelegenheit. »Bitte!« Er ließ sich das Glas geben und die Richtung zeigen. Bald fand er die Herde. »Pa! Ma! Pa! Ma! Das ist toll! Alles ist schwarz, alles wimmelt von Büffeln, wie Ameisen in einem Ameisenhaufen. Können wir nicht etwas näher heranfahren?«
»Davor eben sind wir gewarnt worden. Wenn wir erst in den Büffeln drinstecken, dann gibt es kein Vor und kein Zurück!«
»Wollen Sie mir vielleicht noch verraten«, schalt Herr Finley, »wozu die Union Pacific gebaut worden ist? Als Aussichtspunkt in einem Naturschutzpark oder als Eisenbahn?«
»Im Sommer kommt Buffalo Bill auch hierher, Sir, dann wird mit den Büffeln aufgeräumt. Das ist das letzte Mal, dass wir stecken bleiben, wahrhaftig!«
»Schwacher Trost, mein Lieber. Ob wir nun die Letzten sind, die stecken bleiben, oder die Vorletzten, jedenfalls stecken wir fest! Aber die Maschine bleibt unter Dampf?«
»Selbstverständlich. Die Dakota ...«
»Wer?«
»Ich meine ...«
»Was meinen Sie?«
»Eigentlich nichts.«
»Dakota haben Sie gesagt!«, stellte Douglas fest.
»Ach so, ja. Dakota jagen gerne Büffel.«
»Haben wir auch schon mal gehört. Vielleicht jagen sie bei der Gelegenheit auch gleich unseren Zug?«
»Nicht unbedingt anzunehmen, Herr ...«
Ann Finley bekam einen Hustenanfall.
»Haben wir Verbindung mit der Station?«
»Noch nicht.«
»Wer war denn das, der uns angehalten hat?«
»Ein Beauftragter der Station.«
»So, so. Wenn wir in diesem Jahr noch weiterfahren sollten, setzen Sie es in die Zeitung!« Herr Finley räkelte sich in seiner Fensterecke in der Absicht, wieder einzuschlafen. »Noch eins!«, bemerkte er zuvor. »Finden sich nicht ein paar Leute, meinetwegen von der Station oder vom Zugpersonal oder unter den Fahrgästen, die mal in diese Büffelherde hineinknallen und sie zum Laufen bringen?«
Der Bahnbedienstete wurde verlegen. Sein Kollege hatte inzwischen alle anderen Passagiere mit seiner Auskunft befriedigt und kam eben zurück.
Auf einmal waren aber aufgeregte Rufe zu vernehmen, deren Sinn Herr Finley erst erfasste, als Douglas aufschrie: »Ein Feuerschein am östlichen Horizont! Das muss das Stationslager sein!«
Frau Finley stöhnte und hustete unbeachtet vor sich hin.
»Dann wird es Zeit, dass wir mit allen, die eine Waffe bei sich haben, die Verteidigung des Zuges organisieren!« Die beiden Bahnbediensteten schauten sich gegenseitig an und blickten dann gemeinsam auf Herrn Finley.
»Meine Herren, ich bin weder ein Fallensteller noch ein Pelzjäger! Ich bin auch über die Vierzig hinaus! Suchen Sie sich andere Schützen. Es ist ein Skandal, dass Sie hier nicht einmal die persönliche Sicherheit der Fahrgäste garantieren können! Ein Skandal ist es! Douglas, geh sofort vom Fenster weg! So! Ann und Douglas, ihr legt euch flach hin. Ich aber werde mein Leben teuer verkaufen! Wo bleibt denn dieser Beauftragte der Station, der uns angehalten hat, dieser Mann mit den Fackeln?! Er wird doch wahrscheinlich mehr wissen, als dass eine Büffelherde im Wege liegt!«
»Sofort, mein Herr. Der Zugleiter übernimmt die Verantwortung!«
Die beiden Bahnangestellten stiegen aus, um zur Lokomotive zu laufen. Herr Finley kramte. »Ann, wo hast du meinen Revolver hingepackt?«
»Ganz unten in der Tasche musst du suchen.«
»Typisch. Das nächste Mal packe ich wieder selbst. Ann, so weine doch nicht. Ich kann nicht sehen, wenn du weinst. Du bist die beste, du bist die einzigartige Frau, und ich verteidige dich wie mein eigenes Leben! Da ist er ja, ein Glück – auch die Munition.«
Douglas wurde ungeduldig.
»Pa, die anderen Männer haben schon ihre Flinten bereit!«
»Aber sicher, Junge. Amerikaner lassen sich nicht so leicht unterkriegen. Diesen Rothäuten werden wir es zeigen!«
Der eine Bahnangestellte kam wieder zu Herrn Finley, diesmal in Begleitung eines hochgewachsenen Indianers. Der Indianer hatte das Haar, durch das sich graue Strähnen zogen, in Zöpfe geflochten. Das Stirnband aus Schlangenhaut hielt am Hinterkopf zwei Adlerfedern. Das Gesicht war nicht bemalt und wirkte gealterter als die kräftige, braunhäutige Gestalt. Im Gürtel steckten Messer und Revolver. Die Büchse trug der Indianer in der Hand.
»Das ist Top, ein erfahrener Scout des Stationslagers«, sagte der Bahnangestellte. »Wir können uns auf ihn verlassen!«
Frau Finley saß erschöpft auf ihrem Platz und starrte auf den Bahnangestellten und den Indianer, um aus der Ruhe, die von den beiden ausstrahlte, und aus den Worten des Weißen wieder Mut zu schöpfen. Aber plötzlich riss sie die Augen auf, sprang in die Höhe, und halb ohnmächtig wieder zurücksinkend, flüsterte sie: »Das ist er! Das ist er! Der Mörder!«
Der Bahnangestellte betrachtete die aufgeregte Frau und dann den Indianer.
Herr Finley räusperte sich. »Meine Frau ist reichlich nervös«, sagte er, und dabei zuckten seine Mundwinkel. »Sie verwechselt zwei Personen. Gehen Sie nur. Es ist alles in Ordnung.«
Der Angestellte und der Indianer entfernten sich, nachdem sie noch einmal gemahnt hatten, alles im Dunkeln zu lassen und sich nicht beim Fenster aufzuhalten.
Als die Familie wieder unter sich war, hauchte Ann: »Wie entsetzlich! Er ist es doch! Er ist es bestimmt!«
»Nun sei bloß still, Ann. Wie kannst du den Indianer, der vor dir steht, einen Mörder schimpfen! Er ist sehr gut bewaffnet, und wir sind in der Prärie. Die Bahnangestellten, das siehst du ja, taugen überhaupt nichts. Nicht einmal ein paar Büffel wagen sie zu vertreiben.«
»Dann ist es ja noch viel schrecklicher! Er wird uns doch nicht aus Rache umbringen. Lass ihn noch einmal rufen! Ich stelle meine Äußerung richtig! Ich habe ja auch wirklich nicht gesehen, ob er den Inspizienten damals erschossen hat. Es war nur so ein Gerücht ...«
»Eben. Aber lass das jetzt bitte beiseite! Du machst sonst alles nur noch schlimmer.« Herr Finley war sehr gefasst. »Ich habe ja bereits richtiggestellt.«
»Er ist es aber«, sagte Douglas. »Ich habe ihn auch wiedererkannt. Ob er unseren Zug und die Station an die Dakota verraten hat? Er führte doch damals so aufrührerische Reden.«
»Jedenfalls bitte ich euch beide, dich, Douglas, und dich, Ann, eurerseits überhaupt keine Reden zu führen, ehe wir nicht in Sicherheit sind! Für ein verfolgtes Insekt ist es am besten, sich zu verstecken.«
»Es sind doch genug Männer mit Flinten im Zug!«, begehrte Douglas wieder auf. »Du siehst ja, sie haben sich schon alle zusammengefunden.«
»Aber nicht, um sich eure antiquierten Zirkusgeschichten anzuhören!«
Herr Finley vermochte in der gegebenen Situation zwar weder zu schlafen noch zu schnarchen, aber aus Protest gegen das Verhalten seiner Familie schloss er die Augen und lehnte den Kopf an.
»Setze dich lieber vom Fenster weg!«, bat seine Frau. »Die Außenwand kann von einer Kugel durchschlagen werden!«
Der Angeredete gab keine Antwort mehr.
Der Zug wartete und wartete. Die Maschine blieb unter Dampf. Müdigkeit überfiel die Fahrgäste; sie begannen abwechselnd zu wachen und zu schlafen. Der Feuerschein in Richtung der Station war erloschen.