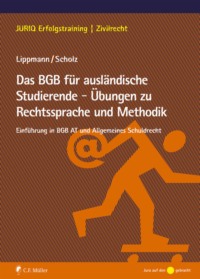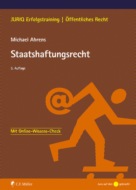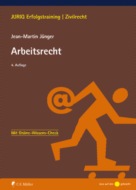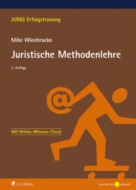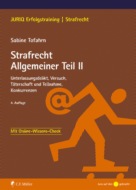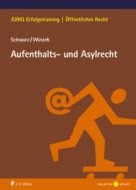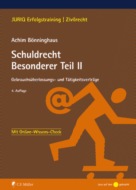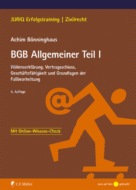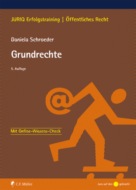Kitabı oku: «Das BGB für ausländische Studierende - Übungen zu Rechtssprache und Methodik», sayfa 11
2 › B. Die Willenserklärung
B. Die Willenserklärung
59
Dieses Kapitel ist der Willenserklärung gewidmet, die einen zentralen Stellenwert im BGB AT einnimmt.
Die natürlichen und juristischen Personen des Privatrechts nehmen am Rechtsverkehr teil, indem sie Rechtsgeschäfte tätigen. Es gibt einseitige und mehrseitige Rechtsgeschäfte. Ein einseitiges Rechtsgeschäft ist die Willenserklärung, die der Grundbaustein des BGB AT ist. In den Bestimmungen des BGB finden Sie oft die Wörter Rechtsgeschäft und Willenserklärung. Definiert werden diese Wörter im BGB aber nicht. In kurzen Texten wird daher erklärt, was darunter jeweils zu verstehen ist. Zentrale Norm für das Wirksamwerden der meisten Willenserklärungen ist § 130 Abs. 1 S. 1 BGB, die Sie hier lesen und verstehen lernen.
Sprachlich ist es in diesem Zusammenhang wichtig, die Bedeutung der beiden Nomen Wille und Erklärung ebenso wie deren Wortableitungen zu kennen. Sie lernen, wie man im Deutschen Nomen zusammensetzt und welche Besonderheiten es bei der Bildung dieser sogenannten Komposita gibt. Typische Nomen-Verb-Verbindungen und andere rechtssprachliche Kombinationen mit dem Kompositum Willenserklärung werden vorgestellt und geübt. Die Rechtswirkungen einer Willenserklärung können durch einen Widerruf entfallen. Dieser in § 130 Abs. 1 S. 2 BGB geregelte Fall wird zum Anlass genommen, den Unterschied von zwei identisch klingenden Wörtern, nämlich wider und wieder, zu erklären und zu üben. Dabei erweitern Sie gleichzeitig systematisch Ihren rechtssprachlichen Fachwortschatz. Zudem gewinnen Sie mehr Kompetenz bei der Verwendung von Pronomen und in der Satzgliedfolge, was Ihr Verständnis von Normen fördert.
Im letzten Abschnitt wenden Sie Ihre erworbenen Kenntnisse auf zwei Fälle an, die zum einen die Frage zum Gegenstand haben, ob bei fehlendem Erklärungsbewusstsein eine Willenserklärung vorliegt, und zum anderen, ob eine Willenserklärung nach § 130 Abs. 1 S. 1 BGB wirksam geworden ist. Die Falllösungen werden damit zwar komplexer, sind aber immer noch so gestaltet, dass sie lediglich einzelne Teilaspekte „echter“ Klausurfälle behandeln. In den Gutachten sollen Sie Lücken vervollständigen. Damit trainieren Sie nochmals Inhalt und Wortschatz.
2 › B › I. Übungen zu Wortschatz und Grammatik
I. Übungen zu Wortschatz und Grammatik
1. Übung Wortschatz
60
a) Ordnen Sie folgende Wörter aus dem Kasten zu den Begriffen Erklärung und Wille(n) im Wortnetz ein.
| etwas erklären – bereitwillig – erklärbar – willig – erklärt – willentlich – erklärtermaßen – der Willige – (un-)erklärlich – der erklärte Wille – zahlungs(-un-)willig – erklärlicherweise – willenlos – der Erklärende – eine Erklärung abgeben – böswillig – der Zugang einer Erklärung – etwas wollen – willensstark |

[Bild vergrößern]
b) Setzen Sie nun die Begriffe aus dem Kasten entweder mit Erklärung oder Wille(n) zusammen. Bei einigen Komposita müssen Sie ein Fugen-s einfügen.
Hinweis
Endet ein Nomen auf -ung, brauchen Sie bei einem Kompositum mit diesem Nomen als Bestimmungswort immer ein sogenanntes Fugen-s. Andere typische Suffixe am Nomen, die stets ein Fugen-s fordern, sind z.B. -schaft, -heit und -keit.
Beispiel
der Kündigungswille
| der Wille – der Beitritt – die Arbeit – die Äußerung – die Regierung – die Stärke – der Inhalt – das Einverständnis – die Handlung – der Widerruf – die Anfechtung – die Kündigung – das Bewusstsein – das Geschäft |
2. Übung Kombinationen mit dem Nomen Willenserklärung
61
a) Welche Wörter können mit dem Begriff Willenserklärung kombiniert werden, sodass sie rechtssprachlich sinnvoll sind? Kreuzen Sie an.
| Wortgruppe | sinnvoll | nicht sinnvoll | |
|---|---|---|---|
| Bsp. | der Zugang einer Willenserklärung | x | |
| (1) | eine Willenserklärung unter Abwesenden | ||
| (2) | insgeheime Willenserklärung | ||
| (3) | einverstandene Willenserklärung | ||
| (4) | eine Willenserklärung unter Anwesenden | ||
| (5) | ausdrückliche Willenserklärung | ||
| (6) | stillschweigende Willenserklärung | ||
| (7) | konkludente Willenserklärung | ||
| (8) | eine Willenserklärung abgeben | ||
| (9) | eine Willenserklärung unter Eingeladenen | ||
| (10) | scheinbare Willenserklärung | ||
| (11) | eine Willenserklärung zugeben |
b) Welche Kombinationen sind sinnvoll?
Eine Willenserklärung
(1) wird abgegeben.
(2) kommt an.
(3) ist vertraglich festgeschrieben.
(4) wird erklärtermaßen.
(5) geht zu.
(6) wird scheinbar.
(7) ist einem anderen gegenüber abzugeben.
(8) wird wirksam.
(9) besteht aus einem äußeren und einem inneren Tatbestand.
(10) ist nacheinander aufzugeben.
c) Ordnen Sie jeweils das richtige Verb aus dem Kasten zu.
| auslegen (2x) | erforschen | zugehen | erfordern | abgeben | haften |
(1) eine Willenserklärung . . . . .
(2) den wirklichen Willen . . . . .
(3) an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks . . . . .
(4) Verträge . . . . .
(5) eine Willenserklärung . . . . .
(6) ein Widerruf . . . . .
(7) Treu und Glauben . . . . . (es)
3. Übung Das Präfix und die Präposition wider
62
Hinweis
Das Präfix und die Präposition wider (+ Akk.) bedeuten beide gegen. Im Unterschied zu wider bedeutet das Adverb und Präfix wieder noch einmal, wie z.B. in wiederholen.
a) Sehen Sie sich folgende Zusammensetzungen mit wider an. In jedem Wort fehlen Buchstaben. Jeder Strich entspricht einem Buchstaben. Ergänzen Sie.
| Bsp. | der Wider_ _ _ _ch – der Widerspruch |
| (1) | widersp_ _ _ _lich |
| (2) | der Wider_ _f |
| (3) | widerr_ _en |
| (4) | widerruf_ _ _ _ |
| (5) | zum Wide_ _uf ber_ _ _tigt sein |
| (6) | wi_ _r (+ Akk.) |
| (7) | das Widerruf_ _ _cht |
| (8) | z_ _ider (nachgestellt, + Dat.) |
| (9) | einen W_ _erruf er_ _ären |
| (10) | widerl_ _en |
| (11) | widers_ _ _chen |
| (12) | _ _ _idern |
| (13) | widers_ _ _en |
| (14) | der Widerst_ _d |
| (15) | widerrecht_ _ _ _ |
| (16) | die Wider_ _ _e |
| (17) | die Widr_ _keit |
| (18) | wid_ _ _ |
| (19) | widerst_ _ _ en |
b) Markieren Sie in folgenden Sätzen die richtige Schreibweise.
Beispiel
Sie werden sofort wider / wieder zurückgerufen.
(1) Er widerruft / wiederruft seine Willenserklärung. (2) Wir sprechen uns gleich wider / wieder. (3) Sie hat die Widerrufserklärung / Wiederrufserklärung fristgerecht abgeschickt. (4) Ich widerspreche / wiederspreche Ihnen nicht. (5) Er wurde als Widerholungstäter / Wiederholungstäter verurteilt. (6) Sie können das jederzeit widerrufen / wiederrufen. (7) Sie werden sich sicher bald widersehen / wiedersehen. (8) Der Schaden ist nicht widergutzumachen / wiedergutzumachen. (9) Er hat einen Anspruch auf Widerherstellung / Wiederherstellung des früheren Zustandes. (10) Widrige / Wiedrige Umstände haben zu einer Verschlimmerung der Situation geführt. (11) Die deutsche Widervereinigung / Wiedervereinigung fand am 3.10.1990 statt. (12) Seiner Aussage zuwider / zuwieder kauft er das Haus nun doch nicht. (13) Der Zeuge war nicht glaubwürdig, weil seine Aussagen widersprüchlich / wiedersprüchlich waren.
c) Bilden Sie mithilfe der vorgegebenen Wörter bzw. Wortgruppen Sätze. Achten Sie auf die richtige Satzgliedfolge.
Beispiel
widersprüchliche Aussagen – hatte – gemacht – Frau Linke – bei der Verhandlung
Frau Linke hatte bei der Verhandlung widersprüchliche Aussagen gemacht.
(1) zulässig und begründet – gegen den Verwaltungsakt – nur dann – wenn – hat – er – Aussicht auf – der Widerspruch – Erfolg – , – ist
(2) der Versicherungsvertrag – des Widerrufs – aufgrund – nicht wirksam – ist
(3) nach § 355 Abs. 1 S. 2 BGB – kann – widerrufen – der Verbraucher – nur innerhalb von zwei Wochen (4) bei Haustürgeschäften – widerruflich – ist – des Verbrauchers – die Willenserklärung (5) auch bei Fernabsatzverträgen – zum Widerruf – der Verbraucher – ist – berechtigt (6) das Gegenteil – hat – behauptet – er – besseres Wissen – wider (7) der Unternehmer – den Verbraucher – muss – belehren – über sein Widerrufsrecht (8) doch – hat – gemietet – allen Belehrungen zuwider – sie – die Wohnung (9) fristgerecht – sie – erklärt – hat – den Widerruf (10) das Widerspruchsverfahren – im öffentlichen Recht – ist – gegen einen Verwaltungsakt – in der Verwaltungsgerichtsordnung – geregelt – und – verwechselt werden – mit dem Widerruf – nicht – im Privatrecht – darf (11) noch – ist – die Willenserklärung – widerruflich (12) widerlegt – seine Aussagen – vollständig – wurden (13) nicht – sie – widersprochen – , – man – deshalb – ausgehen – davon – , – sie – auch – schließen wollte – dass – hat – den Vertrag – kann (14) nichts mehr – hat – er – erwidert – , – zustande gekommen – deshalb – kein Vertrag – ist (15) der Versuchung – konnte – sie – nicht – widerstehen – , – zu kaufen – das Smartphone (16) der Widerstand – so groß – musste – das Projekt – gegen – , – dass – scheitern – es – ist (17) nur dann – ist – die Drohung – ist – ein Anfechtungsgrund – , – sie – wenn – widerrechtlich (18) keine Widerrede – , – ich – sonst – das Arbeitsverhältnis – kündige (19) wiedergutgemacht – trotz großer Widrigkeiten – er – den Schaden – hat (20) konnten – abhalten – nicht – sie – die widrigen Umstände – davon– , – zu unterschreiben – die Bürgschaftserklärung (21) mir – es – widerstrebt – , – zu bewerten – diese Klausur – vollbefriedigend – mit
2 › B › II. Übungen zum Textverständnis
II. Übungen zum Textverständnis
4. Übung Das Rechtsgeschäft
63
Lesen Sie folgenden Text zu Rechtsgeschäften und vervollständigen Sie die Tabelle unten.
Das Rechtsgeschäft
Rechtsgeschäfte sind Handlungen von Rechtssubjekten, die auf die Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet sind. Es gibt einseitige Rechtsgeschäfte und mehrseitige Rechtsgeschäfte. Einseitige Rechtsgeschäfte sind Rechtsgeschäfte, die nur eine Person vornimmt. Sie heißen Willenserklärungen. Zu den einseitigen Rechtsgeschäften oder Willenserklärungen zählen z.B. Angebot, Annahme, Kündigung, Anfechtungserklärung, Widerrufserklärung und das Testament. Mehrseitige Rechtsgeschäfte sind Rechtsgeschäfte, an denen mehrere Personen beteiligt sind. Hierzu gehören die Verträge.
| Rechtsgeschäfte | |
|---|---|
| . . . . .(1) | Mehrseitige Rechtsgeschäfte |
| z.B. Willenserklärung | z.B. . . . . .(2) |
5. Übung Anatomie einer Willenserklärung
64
a) Lesen Sie folgenden Text zu Willenserklärungen.
Die Anatomie einer Willenserklärung Im BGB wird nicht definiert, was eine Willenserklärung ist. Eine Willenserklärung ist die Äußerung (= Erklärung) eines Willens, der auf die Verwirklichung einer Rechtsfolge gerichtet ist. Das Nomen Willenserklärung ist ein Kompositum. Eine Willenserklärung besteht aus einer Erklärung und einem Willen.
65
Die Erklärung ist die äußere, die objektive Komponente der Willenserklärung. Die Person, die etwas erklärt, heißt der Erklärende. Die Person, die Adressat der Erklärung ist, heißt der Erklärungsempfänger. Der Erklärende verhält sich so, dass sein Wille für den Erklärungsempfänger erkennbar wird. Dieses Verhalten kann ausdrücklich oder konkludent bzw. stillschweigend sein. Konkludent ist ein Verhalten dann, wenn es so interpretiert werden kann, dass deutlich wird, dass das Rechtssubjekt eine bestimmte Rechtsfolge herbeiführen will.
66
Der Wille ist die innere, die subjektive Seite der Willenserklärung. Der innere Tatbestand besteht aus drei Komponenten: dem Handlungswillen, dem Erklärungsbewusstsein und dem Geschäftswillen.
Der Handlungswille ist der Wille, überhaupt eine Erklärung abgeben zu wollen. Wenn der Handlungswille fehlt, liegt keine Willenserklärung vor.
Wiederholen Sie, was Sie in Rn. 18 zur Analogie gelernt haben.
Das Erklärungsbewusstsein ist der Wille, eine rechtlich erhebliche Handlung vorzunehmen. Wenn eine Person nicht weiß, dass sie etwas rechtlich Erhebliches erklärt, fehlt das Erklärungsbewusstsein. Es ist umstritten, welche rechtlichen Konsequenzen es hat, wenn das Erklärungsbewusstsein fehlt. Nach einer Auffassung soll der Erklärende geschützt werden. Wenn der Erklärende gar nichts rechtlich Erhebliches erklären wollte, dann soll auch keine Willenserklärung (an die er gebunden wäre) vorliegen. Diese Auffassung wendet § 118 BGB analog an. Nach dieser Vorschrift ist eine Erklärung nichtig, mit der aus Empfängersicht etwas rechtlich Erhebliches erklärt wurde, der Erklärende das aber nicht ernst gemeint hat. Auch beim fehlenden Erklärungsbewusstsein wurde aus Empfängersicht etwas rechtliches Erhebliches erklärt, aber der Erklärende wollte das nicht. Da beide Situationen vergleichbar sind und das fehlende Erklärungsbewusstsein an keiner anderen Stelle im BGB geregelt wurde, soll analog § 118 BGB die Willenserklärung nichtig sein.
Die folgende Definition sollten Sie lernen und so verstehen, dass Sie sie in einer Klausur anwenden können.
Eine andere Auffassung will den Empfänger der Erklärung schützen. Der Erklärungsempfänger kann nicht wissen, ob der Erklärende Erklärungsbewusstsein hat. Sobald etwas erklärt wird, soll der Empfänger vertrauen können, dass eine Willenserklärung vorliegt.
Der Bundesgerichtshof (BGH) will sowohl die Interessen des Erklärenden als auch die Interessen des Erklärungsempfängers schützen. Es heißt in einer Entscheidung:

„Trotz fehlenden Erklärungsbewusstseins liegt eine Willenserklärung vor, wenn der Erklärende bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen und vermeiden können, dass seine Äußerung nach Treu und Glauben und der Verkehrssitte als Willenserklärung aufgefasst werden durfte, und wenn der Empfänger sie auch tatsächlich so verstanden hat. Sie kann (. . .) gemäß §§ 119, 121, 143 BGB angefochten werden.“ (BGHZ 91, 324 ff.)
Der Auffassung des BGH folgt die überwiegende Mehrheit der Juristen. Diese Auffassung wird daher auch herrschende Meinung (h.M.) genannt.
Der Geschäftswille ist der Wille, ein konkretes Rechtsgeschäft abzuschließen. Wenn eine Person mit ihrer Handlung das bestimmte Geschäft und dessen Rechtsfolgen gar nicht beabsichtigt, fehlt ihr der Geschäftswille. Wenn der Geschäftswille fehlt, liegt trotzdem eine Willenserklärung vor. Diese kann dann aber anfechtbar sein. Wie eine solche Willenserklärung angefochten wird, lernen Sie im Kapitel Anfechtung ab Rn. 192 ff.
b) Welche Antwort gehört zu welcher Frage? Ordnen Sie zu.

[Bild vergrößern]
67
c) Entscheiden Sie, ob in folgenden Situationen eine Erklärung als objektiver Tatbestand einer Willenserklärung vorliegt. Wenn ja, ist die Willenserklärung ausdrücklich oder konkludent abgegeben worden?
| Situation | Erklärung | ausdrücklich | konkludent | |
|---|---|---|---|---|
| Bsp. | Tobias fragt Annika, ob sie ihm ihr Auto leiht. | x | x | |
| (1) | Franziska schreibt Gustav, dass sie ihm gerne ihr Geschichtsbuch verkauft. | |||
| (2) | Theresa sieht auf der anderen Straßenseite Gertrud und hebt die Hand zum Gruß. | |||
| (3) | Als Martin von der Verkäuferin gefragt wird, ob er auch eine Salami kaufen will, nickt er. | |||
| (4) | Burghard hebt auf einer Auktion die Hand, um eine gute Flasche Riesling zu ersteigern. | |||
| (5) | Als Janek gefragt wird, ob er sein Handy für 10 € in Zahlung geben wolle, schweigt er. | |||
| (6) | Tanja legt im Supermarkt eine Tafel Schokolade auf das Band an der Kasse. |
68
d) Entscheiden Sie, welche Komponenten des Willens in folgenden Situationen vorhanden sind und ob die Handlung schließlich eine Willenserklärung darstellt.
| Situation | Komponenten des Willens | Willenserklärung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Handlungswille | Erklärungsbewusstsein | Geschäftswille | |||
| Bsp. | Rosemarie will ein neues Lehrbuch im Internet bestellen. Statt „1“ tippt sie versehentlich „11“ und bekommt elf Lehrbücher. | + | + | - | + |
| (1) | Der Geschäftsführer der G-GmbH unterschreibt Weihnachtskarten. Versehentlich unterschreibt er dabei das Bestellformular über einen neuen Schreibtisch. | ||||
| (2) | Hannah ist auf einer Auktion. Als sie Nadja hereinkommen sieht, hebt sie zum Gruß die Hand. Dabei gibt sie versehentlich ein Gebot ab. | ||||
| (3) | Der Verbrecher Viktor zwingt sein Opfer Otto, ihm mittels Internetbanking 10 000 € zu überweisen. O wehrt sich zwar, aber V führt seine Hand mit Gewalt über die Tastatur. O hat keine Chance und überweist das Geld. | ||||
| (4) | Johannes und Jana liegen im Bett. Er fragt sie, ob sie ihn heiraten wolle. Jana, die bereits schläft, nickt im Schlaf. |