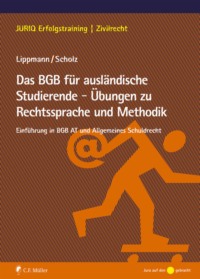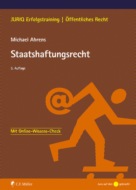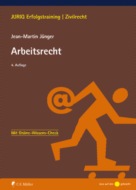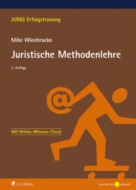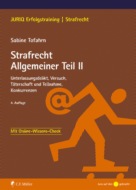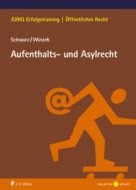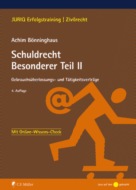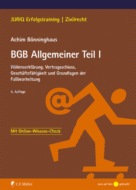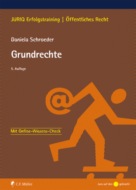Kitabı oku: «Das BGB für ausländische Studierende - Übungen zu Rechtssprache und Methodik», sayfa 7
1 › C. Einführung in den Gutachtenstil
C. Einführung in den Gutachtenstil
25
In Ihrem Studium des BGB AT und des Schuldrechts AT sollten Sie sich nicht darauf beschränken, die rechtlichen Konzepte dieser beiden Rechtsgebiete zu erlernen. Sie sollten ebenso in der Lage sein, die Rechtskonzepte auf Fälle anzuwenden. Diese Rechtsanwendung erfolgt im Jurastudium durch das Schreiben von Gutachten. Ein Gutachten ist ein Text, der einen ganz bestimmten Aufbau hat und besondere sprachliche Strukturen aufweist. Es ist zugleich die Prüfungsleistung, die an deutschen rechtswissenschaftlichen Fachbereichen zu erbringen ist.
Im ersten Abschnitt dieses Kapitels werden Sie mit dem Gutachten als Textsorte und dem Gutachtenstil vertraut gemacht. Das ist die Methode, mit der die Falllösung strukturiert wird. Um sich ganz auf diese Methode und ihre sprachlichen Besonderheiten zu konzentrieren, lösen Sie im zweiten Abschnitt Fälle, die sich auf das fiktive Flüssigkeitshaushaltsgesetzbuch aus Kapitel B beziehen. Damit sind Sie für alle weiteren Fallbearbeitungen in diesem Lernbuch gut gerüstet.
Für den Gutachtenstil ist es erforderlich, bestimmte sprachliche Strukturen zu kennen und diese korrekt benutzen zu können. Dazu gehören indirekte Fragesätze als Nebensätze, Hypothesenbildung mit dem Konjunktiv II, also der Möglichkeitsform, und die sichere Beherrschung kausaler Konnektoren. Außerdem ist es ratsam, die indirekte Rede, den Konjunktiv I, zumindest passiv zu beherrschen, so dass Sie den Sachverhalt richtig interpretieren können.
Die Spracherklärungen in diesem Kapitel haben demzufolge zum Ziel, Ihnen eine Einführung in die genannten Themen zu geben und sie Ihnen im Kontext zu veranschaulichen. Anschließend sollen Sie das Gelernte in zunächst einfachen allgemeinsprachlichen Übungen, später in anspruchsvolleren rechtssprachlich orientierten Aufgaben anwenden. Diese Übungen sind die Voraussetzung dafür, dass Sie in den folgenden Kapiteln den Gutachtenstil mit all seinen sprachlichen Besonderheiten selbständig richtig und sicher formulieren können.
1 › C › I. Der Gutachtenstil
I. Der Gutachtenstil
1. Übung Das Gutachten
26
Was ist ein Gutachten im rechtlichen Sinne? Unterstreichen Sie das Synonym.
| (1) Ein Bescheid. | (2) Die rechtliche Prüfung bzw. Würdigung eines Lebenssachverhalts. | (3) Eine Beweisaufnahme. | (4) Eine Klageschrift. | (5) Ein Urteil. |
2. Übung Vorbereitung eines Gutachtens
27
a) Lesen Sie, wie Sie ein Gutachten vorbereiten.
Das Gutachten im Jurastudium
Im Jurastudium muss der Jurastudierende Gutachten schreiben. Er bekommt einen Fall. Dieser Fall heißt Sachverhalt. In ihm wird eine Situation aus dem Leben geschildert. Am Ende dieses Sachverhalts steht meist eine Frage, die beantwortet werden muss. Diese Frage heißt Fallfrage.
Zuerst bereitet man die Lösung des Falles vor. Der Studierende muss die anwendbaren Normen finden und prüfen, ob der Tatbestand dieser Normen erfüllt ist. Auf dieser Grundlage kann er feststellen, ob die Rechtsfolge eintritt. Die Notizen hierzu heißen Lösungsskizze.
Nachdem die Lösungsskizze angefertigt wurde, wird die Lösung in einem Text aufgeschrieben. Dieser Text hat eine klare Struktur. Man wendet eine bestimmte Methode an, die Gutachtenstil heißt. Der Gutachtenstil erfordert neben der Arbeit mit dem Gesetz und dem Sachverhalt die Kenntnis bestimmter grammatikalischer Strukturen.
Die Vorbereitung der Falllösung – die Lösungsskizze
1. Schritt: Den Sachverhalt lesen
Zuerst liest man gründlich den Sachverhalt. Die Fakten, die im Sachverhalt geschildert werden, sind die Grundlage für die Falllösung. Es wird nichts hinzuerfunden. Man schaut, was passiert ist und welche Personen beteiligt sind. Manchmal ist es hilfreich, einen Zeitstrahl (eine Chronik) zu erstellen.
Das, was die beteiligten Personen gesagt haben und was sie denken, wird in der Regel im Sachverhalt in der indirekten Rede, d.h. im Konjunktiv I dargestellt. Der Jurastudierende muss daher den Konjunktiv I passiv beherrschen.
Beispiel
T ist der Auffassung, der Vertrag sei nichtig. S sagt, sie werde den Kaufpreis nicht bezahlen.
2. Schritt: Die anwendbaren Normen finden
Dann wird die Fallfrage gelesen, um herauszufinden, was genau zu beantworten ist. Es muss nun eine Norm bzw. die Normen gefunden werden, deren Rechtsfolge zur Frage passt.
Beispiel
Die Fallfrage lautet: „Ist ein Laptop eine Sache?“ Man muss nun die Norm finden, deren Rechtsfolge „Sache“ ist bzw. die das Wort Sache definiert. Dabei stößt man auf § 90 BGB. Dort steht: „Sachen sind körperliche Gegenstände.“ Die Rechtsfolge von § 90 BGB ist daher, dass eine „Sache“ vorliegt. § 90 BGB ist deshalb die Norm, die angewendet werden muss.
3. Schritt: Den Tatbestand der anwendbaren Normen bestimmen
Im nächsten Schritt werden die Tatbestandsvoraussetzungen der Normen herausgearbeitet, die in Schritt 2 gefunden wurden.
Beispiel
Der Tatbestand von § 90 BGB lautet „körperlicher Gegenstand“. Wenn ein körperlicher Gegenstand vorliegt, dann handelt es sich um eine Sache.
4. Schritt: Prüfung, ob der Tatbestand erfüllt ist
Dann untersucht man für alle Normen, ob nach dem Sachverhalt die Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, d. h. die Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Der Sachverhalt liefert die notwendigen Informationen. Man erfindet keine neuen Umstände und auch keine Fakten hinzu. Es kann sein, dass ein Sachverhalt Fakten enthält, die für die Falllösung nicht benötigt werden. Es gilt als Fehler, wenn diese überflüssigen Fakten in der Falllösung berücksichtigt werden. Man will prüfen, ob der Studierende das Wesentliche vom Unwesentlichen trennen kann.
Beispiel
Es wird also untersucht, ob ein Laptop ein körperlicher Gegenstand ist. Man stellt fest, dass man einen Laptop anfassen kann, dass er also ein körperlicher Gegenstand ist. Der Tatbestand von § 90 BGB ist mithin erfüllt. Wenn der Tatbestand erfüllt ist, tritt die Rechtsfolge ein. Somit kann festgestellt werden, dass ein Laptop eine Sache ist.
Hinweis
Allerdings verwendet man die Formulierungen „man untersucht“ und „man stellt fest“ im schriftlichen Gutachten nicht.
Die Notizen, die man macht, werden Lösungsskizze genannt.
b) Setzen Sie die richtigen Nomen aus dem Kasten im folgenden Text ein. Manchmal können Sie ein Wort mehrmals verwenden.
| die Rechtsfolge – der Tatbestand – die Norm – der Sachverhalt – die Fallfrage – (Tatbestands-)Voraussetzungen (Pl.) – das Gesetz |
Wie kommt man zu einer Lösungsskizze?
Etwas, was tatsächlich geschehen ist, nennt man einen . . . . .(1). Bevor Jurastudierende ein Gutachten schreiben können, brauchen sie einen solchen Lebens . . . . .(2). Ein Synonym für dieses Wort ist auch . . . . .(3). Am Ende steht meist eine Frage. Diese . . . . .(4) muss im Gutachten Schritt für Schritt beantwortet werden. Als Erstes sollte man im . . . . .(5) die . . . . .(6) suchen, die passt. Die . . . . .(7) dieser . . . . .(8) muss zu der Frage passen. Danach sieht man sich ganz genau die . . . . .(9) an und prüft, ob sie erfüllt sind. So hat man am Ende eine Lösungsskizze. Sie ist die Basis für das juristische Gutachten.
28
c) Lesen Sie folgenden Text zum Konjunktiv I im Sachverhalt.
Konjunktiv I im Sachverhalt
Der Konjunktiv I ist in der Rechtssprache bei der indirekten Rede unbedingt nötig. Wenn z. B. ein Jurist nach seinem wichtigsten Werkzeug gefragt werden würde und man wiedergeben möchte, was er geantwortet hat, dann würde man schreiben: Er sagte, dass ihm das Gesetz am wichtigsten sei, da er in ihm fast alle Regelungen finden könne. Durch den Konjunktiv I weiß also jeder, dass der Jurist zitiert wird.
In einem Sachverhalt wird man nur die 3. Person Singular und Plural finden. Man bildet den Konjunktiv I mit dem Verbstamm und der Endung -e für die 3. Person Singular.
Beispiel
er könne, sie wolle, er kaufe
In der 3. Person Plural lautet der Konjunktiv I in der Regel genauso wie der Indikativ. In diesem Fall verwendet man den Konjunktiv II.
Beispiel
sie könnten, sie wollten, sie würden kaufen
Das einzige unregelmäßige Verb im Konjunktiv I ist sein.
Beispiel
es sei, sie seien
d) Markieren Sie die richtige Verbform.
Beispiel
Paulina ruft Sascha an und teilt diesem erfreut mit, sie habe / hat die lang gesuchte Gedichtesammlung von Goethe günstig erwerben können.
Rudi antwortete, dass ihm das Haus zu teuer sei / wäre (1). Herr Siebald fragte, ob er zehn Flaschen Rotwein haben könne / könnte (2). Trotzdem stellt sich die Frage, wer recht hat / habe (3). Hannes bestellt / bestelle (4) bei EIKA ein neues Regal. Der Antiquitätenhändler vereinbart / vereinbare (5) mit dem Kunden, er solle / soll (6) das Porzellan gleich mitnehmen, könne / kann (7) es aber erst später bezahlen. Über den Preis werde / wird (8) man sich später einigen. Christa (C) bestellt für 159 € einen neuen Staubsauger im Internet. Statt des Staubsaugers erhält / erhalte (9) C eine E-Mail. Darin teilt ihr der Verkäufer (V) mit, er habe / hätte (10) seine EDV zu spät auf die neuen Preise umgestellt, weshalb im Internet die falschen Preise wiedergegeben worden seien / sind (11). Der Staubsauger könne / kann (12) nur zum neuen Preis von 189 € geliefert werden. C ist / wäre (13) sauer. Kann / Könnte (14) C die Lieferung des Staubsaugers gegen Zahlung der 159 € verlangen?
3. Übung Aufbau des Gutachtens
29
a) Lesen Sie, wie ein Gutachten aufgebaut ist und welche sprachlichen Besonderheiten es gibt.
Der Aufbau des Gutachtens
Auf Basis der Lösungsskizze schreibt man ein juristisches Gutachten, das die Falllösung darstellt. Ein Gutachten hat folgenden Aufbau:
| Der Obersatz | ||
| Zuerst wird ein sogenannter Obersatz geschrieben. Der Obersatz stellt das hypothetische Ergebnis bzw. die Ausgangsfrage dar. Er wird als eine indirekte Frage formuliert und spiegelt die Fallfrage wider. Es gibt zwei Varianten, den Obersatz zu formulieren. | Sprachlicher Hinweis für Variante 1: Diese Variante beginnt immer mit Fraglich ist, ob (…). Das Verb steht am Ende des Satzes und im Indikativ. Am Satzende steht ein Punkt. Man verwendet kein Fragezeichen. | Beispiel: Fraglich ist, ob ein Laptop eine Sache gemäß § 90 BGB ist. |
| Sprachlicher Hinweis für Variante 2: Konjunktiv II mit dem Modalverb können (könnte haben, könnte sein) | Beispiel: Ein Laptop könnte eine Sache gemäß § 90 BGB sein. | |
| Nennen der Voraussetzungen | ||
| Nach dem Obersatz müssen die Tatbestandsvoraussetzungen genannt werden. | Sprachlicher Hinweis für Variante 1: Konjunktiv II mit dem Modalverb müssen (müsste haben, müsste sein) | Beispiel: Dann müsste ein Laptop ein körperlicher Gegenstand sein. |
| Sprachlicher Hinweis für Variante 2: Diese Variante beginnt immer mit Voraussetzung ist, dass (. . .). Das Verb steht am Ende und im Indikativ. | Beispiel: Voraussetzung für eine Sache gemäß § 90 BGB ist, dass ein Laptop ein körperlicher Gegenstand ist. | |
| Subsumtion (= Anwenden des Sachverhalts auf die Voraussetzungen) | ||
| Nachdem die Voraussetzungen genannt wurden, wird im Rahmen der Subsumtion geprüft, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Es wird subsumiert. Alle Tatbestandsmerkmale einer Vorschrift sind zu prüfen. Oft kann man nicht einfach beantworten, ob die Tat-bestandsvoraussetzungen einer Norm erfüllt sind. Dann muss man im Rahmen eines neuen „kleinen“ Obersatzes, an den sich wieder Voraussetzungen und Subsumtion anschließen, prüfen, ob die Tatbestandsvoraussetzung erfüllt ist. Es entsteht dadurch eine Schachtelprüfung. | Sprachlicher Hinweis: Das Verb steht im Indikativ. Wenn ein Tatbestandsmerkmal schwierig zu subsumieren ist, dann formuliert man den neuen Obersatz mit: Fraglich könnte sein, ob (. . .), Fraglich ist allerdings, ob (. . .), Dazu müsste jedoch (. . .). | Beispiel: Ein Laptop ist gegenständlich und körperlich. |
| Ergebnis | ||
| Wenn alle Tatbestandsmerkmale geprüft wurden, wird die indirekte Frage aus dem Obersatz in einem Ergebnissatz beantwortet. | Sprachlicher Hinweis: Das Verb steht im Indikativ. Typische Einleitungen sind daher, deshalb, demzufolge, also, mithin. Das Verb steht immer direkt danach an Position 2 im Satz. | Beispiel: Daher ist ein Laptop eine Sache gemäß § 90 BGB. |
Charakter eines Gutachtens
Das juristische Gutachten folgt dem Prinzip, dass zuerst der Grund (der Tatbestand) erläutert und erst dann die rechtliche Konsequenz (die Rechtsfolge) niedergeschrieben wird. Es ist falsch, zuerst eine Folge zu nennen und erst danach den Grund hierfür aufzuschreiben.
Richtig: Der Laptop ist gegenständlich und körperlich (Grund). Der Laptop ist eine Sache (Folge).
Falsch: Der Laptop ist eine Sache (Folge). Der Laptop ist gegenständlich und körperlich (Grund).
Hinweis
Tabuwörter im Gutachten sind in den meisten Fällen weil, denn und da. Das folgt aus der Denkrichtung des Gutachtens: Von der Frage zum Ergebnis. Weil, denn und da charakterisieren jedoch in den meisten Fällen gerade die umgekehrte Denkrichtung vom Ergebnis zu den Voraussetzungen. Die Konjunktionen da und weil kann man nur dann im Gutachten benutzen, wenn zuerst der Grund genannt wird und erst danach die Folge. Beispiel: Da / Weil der Laptop gegenständlich und körperlich ist, ist der Laptop eine Sache.
Es wird Gutachten geben, in denen man kurze Sätze findet, die zuerst die Folge und dann den Grund nennen. Das ist bei unproblematischen rechtlichen Tatbestandsmerkmalen erlaubt. Alles Problematische muss aber unbedingt im Gutachtenstil geschrieben werden. Da es jedoch vielen Studierenden schwer fällt, die entscheidenden / problematischen Tatbestandsmerkmale von den unproblematischen zu unterscheiden, sollte alles im Gutachtenstil geschrieben werden.
b) Woraus besteht ein juristisches Gutachten? Unterstreichen Sie die vier passenden Begriffe.
| die Variante – die Position – die Meinung – die Fragestellung – die Sicht – die Haltung – das Gesetz – der Sachverhalt – die Subsumtion – der Fall – die Feststellung – das Statement – die Lösung – das Recht – die Konstatierung – die Diagnose – die Voraussetzung – die Kritik – das Resultat – die Rezension – die Wertung – die Besprechung – die Denkweise – der Obersatz – die Folge – die Aussage – das Ergebnis – die Überzeugung |
c) Wie ist das juristische Gutachten aufgebaut? Setzen Sie die Begriffe aus Übung 3b) in dem Prüfungsschema ein.
I. . . . . . . . . . . . . . . .(1)
II. . . . . . . . . . . . . . . .(2)
III. . . . . . . . . . . . . . . .(3)
IV. . . . . . . . . . . . . . . .(4)
4. Übung Kausal- und Folgesätze im Gutachten
30
a) Bestimmen Sie in folgenden Sätzen zunächst den Grund und die Folge. Bilden Sie dann Kausal- und Folgesätze mit deshalb.
Beispiel
Ich habe viel besser verstanden. Heute habe ich viele Fragen gestellt.
Heute habe ich viele Fragen gestellt. Deshalb habe ich viel besser verstanden.
| (1) | Das BGB ist schwer zu lesen. | Man braucht verschiedene Lesestrategien. |
| (2) | Ein Jurist muss ein Gutachten schreiben. | Ein Jurist muss einen Fall lösen. |
| (3) | Wie man ein richtiges Gutachten schreibt, kann man lernen. | Es werden hier viele Tipps gegeben. |
| (4) | Irgendwann kann jeder gute Jurist problemlos ein Gutachten schreiben. | Man sollte ein wenig Geduld haben und viel üben. |
| (5) | Bernd kann von Annika die Abnahme des Buches verlangen. | Annika ist der Käufer. |
| (6) | Es kann ein Kaufvertrag über einen Kanarienvogel geschlossen werden. | Gemäß § 90a S. 3 BGB sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend auf Tiere anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. |
Hinweis
Vergessen Sie nicht, dass Sie jederzeit ein Synonym für deshalb nutzen können, wie z.B. daher, darum, deswegen, aus diesem Grund, mithin oder folglich. Die Wortstellung ändert sich nicht.
b) Setzen Sie die kausalen Konnektoren weil, da, deshalb, daher, deswegen und denn in folgenden Sätzen ein. Achten Sie auf die Wortstellung.
Das war eine wundervolle Woche. Ich habe meine Zusage für ein Jurastudium in Saarbrücken bekommen, . . . . .(1) habe ich sofort meine beste Freundin angerufen. . . . . .(2) ich mich schon vor längerer Zeit um einen Studienplatz beworben hatte, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Bereits seit meiner Kindheit wollte ich immer im Ausland leben und studieren, . . . . .(3) ich mag fremde Kulturen und Sprachen. . . . . .(4) hatte ich mich auch für ein Studium des Europäischen Rechts entschieden. Ich wollte vor meiner Bewerbung gut über die Stadt informiert sein und ich recherchierte . . . . .(5) schon viel im Internet über das Studium, Saarbrücken und die deutsche Mentalität. Ich werde sicher keine großen Sprachprobleme in Deutschland haben, . . . . .(6) ich ein paar deutsche Kommilitonen hier an der Universität habe und einen Sprachkurs mache.
c) Vervollständigen Sie folgende Kausalsätze mit den vorgegebenen Wörtern. Konjugieren Sie die Verben.
| Kausalsatz | Einzusetzende Wörter | |
|---|---|---|
| Bsp. | Ich möchte in Deutschland studieren, weil ich gern im deutschsprachigen Ausland leben will. | Ausland – gern – deutschsprachigen – wollen – im – leben – ich – weil |
| (1) | Mein Jurastudium macht mir Spaß, ____. | abwechslungsreich – denn – es – sehr – sein |
| (2) | Viele Studierende haben ein bisschen Angst, . . . . .. | da – anstrengend – ein Jurastudium – können – sein |
| (3) | Jurastudierende müssen viel lernen, . . . . .. | am Ende – sie – schwierige – schreiben – denn – Prüfungen – müssen |
| (4) | Jurastudierende müssen bestimmte grammatikalische Strukturen kennen, . . . . .. | ein – schreiben – sie – Gutachten – weil – müssen |
| (5) | Es gibt keinen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises, . . . . .. | kein – da – das – Kaufvertrag – wirksamer – sein |
d) Formulieren Sie die Sätze aus Übung 4c) um und nutzen Sie die kausalen Konnektoren deshalb, daher, darum, folglich, aus diesem Grund oder deswegen.
Beispiel
Ich will gern im deutschsprachigen Ausland leben. Daher möchte ich in Deutschland studieren.
e) Formulieren Sie folgende Kausalsätze um. Benutzen Sie die Ihnen bekannten kausalen Konnektoren.
| Das ist im Gutachten tabu. | Das ist im Gutachten richtig. | |
|---|---|---|
| Bsp. | Man kann über einen Hund einen Kaufvertrag schließen, denn die Vorschriften des BGB sind auf Tiere anwendbar. | Die Vorschriften des BGB sind auf Tiere anwendbar. Daher kann man über einen Hund einen Kaufvertrag schließen. |
| (1) | Wasser ist keine Sache, da Wasser nicht körperlich ist. | |
| (2) | Antje hat gegen Christian einen Anspruch auf Zahlung von 200 €, weil beide einen Vertrag geschlossen haben. | |
| (3) | Der Verkäufer Jan hat auf seiner Internetseite angegeben, dass die Präsentation unverbindlich sei. Aus diesem Grund liegt kein Angebot vor. | |
| (4) | Der Kaufvertrag ist zustande gekommen, denn die Annahme wurde erklärt. | |
| (5) | Angebot und Annahme liegen vor. Deshalb ist der Kaufvertrag wirksam zustande gekommen. | |
| (6) | Der Kaufvertrag von Alex und Hanni über ein Grundstück ist nichtig, da er nur zum Schein abgeschlossen wurde. | |
| (7) | Eine wirksame Willenserklärung liegt vor, weil Herr Kandt eindeutig mit dem Kopf nickte. | |
| (8) | Dr. Schlau und Prof. Klug haben als Unternehmer gehandelt. Folglich liegt kein Verbrauchervertrag vor. | |
| (9) | Es gibt einen wirksamen Kaufvertrag, denn es liegt eine stillschweigende Annahme vor. |