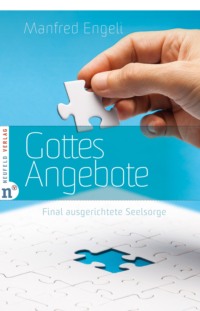Kitabı oku: «Gottes Angebote», sayfa 6
2.4.2. Entwicklungsbedingte Nöte und Lerndefizite
Neben den Lerndefiziten (z. B. mangelnde kommunikative Fertigkeiten) gehören auch Nöte in diese Kategorie, welche auf die Erblinie, Modelllernen oder Prägung zurückzuführen sind. Was aus den elterlichen Erblinien stammt, von den Eltern als Modell übernommen worden ist und was durch die empfangene Erziehung geprägt worden ist, lässt sich letztlich nicht genau auseinander halten; alles gehört zum „eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel“38. Einige Beispiele: egoistische Wertmaßstäbe, ein überstrenges Gewissen, Perfektionismus, das Fehlen gewisser Gefühle, ungute Gewohnheiten u. a. Hier ordne ich auch alles ein, was durch nicht oder ungenügend verarbeitete negative Erfahrungen ausgelöst worden ist: gewisse emotionale Reaktionen (z. B. situationsbedingte Ängste), Vermeidungsverhalten, Festlegungen, unbrauchbare soziale Strategien (z. B. alles unter Kontrolle haben39, „Angriff ist die beste Verteidigung“, Unehrlichkeit usw.), das typische Opfer-Verhalten u. a. Auch das Leiden an den Folgen getroffener Entscheidungen (z. B. Berufswahl, Partnerwahl o. ä.) gehört hierhin.
2.4.3. Bedürftigkeit und emotionale Defizite
Dieser Kategorie ordne ich vieles zu, was man als Persönlichkeitsnöte umschreiben könnte: mangelnde Frustrationstoleranz, Unfähigkeit zur Selbstkontrolle, Suchtverhalten, Willensschwäche, emotionale Unersättlichkeit usw. Hier gehören aber auch emotionale Defizite und das daraus entstandene Beziehungsverhalten hin (z. B. Selbstverwöhnung, klebrige Anhänglichkeit, das Helfersyndrom, Prahlerei usw.), ebenso die meisten sexuellen Nöte.
2.4.4. Geistliche Nöte
Hier ordne ich alles ein, was mit der religiösen Dimension des Menschen zu tun hat: Falsche Gottesbilder, eine negative oder unentfaltete persönliche Gottesbeziehung, unverarbeitete verletzende Erfahrungen mit religiösen Autoritätspersonen, hinderliche religiöse Prägungen, religiöse Ängste (z. B. die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen zu haben) usw. Aber auch alles, was mit Schuld und Vergebung zu tun hat, ordne ich hier zu: Als unvergebbar eingeschätzte persönliche Schuld, falsche Schuldgefühle, fehlende Selbstvergebung, Gewissensnöte, Unversöhnlichkeit usw. Die Probleme im Bereich der Bindungen und des Okkulten gehören ebenfalls in diese Kategorie: Seelische Bindungen an Menschen oder Orte, dämonische Belastungen, Flüche, die Auswirkungen okkulter Erfahrungen oder Praktiken u. a. Auch Störungen in der inneren Ordnung der Person40 gehören in diese Kategorie.
2.4.5. Und die Diagnose?
Ein Kategoriensystem zu besitzen, verleitet leicht dazu, Diagnosen stellen zu wollen. Ist das in der Finalen Seelsorge sinnvoll? Eigentlich können wir darauf verzichten. Der wichtigste Grund dafür ist ansatzbedingt. Wir wollen uns nochmals bewusst machen, dass die Diagnosestellung ein wesentlicher Teil des medizinischen Vorgehens ist – aufgrund der Diagnose wird die Behandlungsmethode festgelegt. Wie wir bereits festgestellt haben, geht der Ansatz der Finalen Seelsorge aber in eine andere Richtung. Unser Vorgehen ist dadurch charakterisiert, dass wir keine Standard-Behandlungen kennen, sondern uns als Gottes Mitarbeiter seinem Wirken anschließen wollen. Gott kennt die Ursache eines Übels zwar ganz genau, aber weil er einmalige Lösungen hat, scheint eine Diagnose im strengen Sinne für ihn nicht wichtig zu sein. Seine Situationsanalyse ist final ausgerichtet: Die Lösung ist ihm wichtiger als die Feststellung der Ursache oder die genaue Beschreibung des aktuellen Zustandes.41 Deshalb wollen auch wir der Versuchung widerstehen, nach den Ursachen zu suchen und der hilfesuchenden Person gegenüber unsere seelsorgerliche Kompetenz durch eine Diagnose unter Beweis stellen zu wollen. Laienseelsorgern fehlt meist der wissensmäßige Hintergrund, um eine sorgfältige Diagnose stellen oder eine von einer Fachperson gestellte Diagnose sinnvoll einordnen zu können.42
Welche Bedeutung hat die Diagnose für den Klienten und seine Angehörigen? Es ist leicht verständlich, wieso Angehörige immer wieder den Wunsch nach einer Diagnose äußern. Der Umgang mit der Not des Klienten bildet für seine Umgebung eine Herausforderung. Wenn man nun sein Verhalten als Symptome einer „Krankheit“ einstufen kann, schafft das Erleichterung. Die Etikettierung bringt aber gewisse Gefahren mit sich: Der aktuelle Zustand wird auf ungute Weise akzeptiert und als „Krankheit“ festgeschrieben. Nun erwarten die Angehörigen oft keine Veränderung mehr und die motivierende Hoffnungshaltung verschwindet. Die akute Not und das Leiden des „Kranken“ werden nicht mehr wirklich ernst genommen – es sind ja „normale“ Symptome. So begegnet man dem Klienten nicht mehr als Person, sondern als einem „Fall“. Dieses „Abgestempelt-Sein“ ist für die betroffene Person eine verletzende Erfahrung.
Es sind aber auch Gründe denkbar, weshalb der Klient selbst sich eine Diagnose wünscht. Einen möglichen Grund möchte ich durch ein Beispiel andeuten (Beispiel 12):
Ein junger Mann meldete sich bei mir mit der Frage, ob er nicht dämonisch belastet sei. Er bat mich mehrfach fast flehentlich: „Nicht wahr, ich bin doch dämonisch belastet!“ Nach der Überprüfung seiner Situation im Gespräch und im Gebet konnte ich seine Vermutung nicht bestätigen. Ich fragte ihn dann, weshalb ihm diese „Diagnose“ so wichtig sei, und bekam eine aufschlussreiche Antwort: „Dann wäre ich für meine Probleme gar nicht zuständig und müsste mich nicht darum kümmern. Ich könnte dann einfach warten, bis ich frei werde.“ Seine Not war, dass er erwachsen und eigenverantwortlich werden sollte; und dagegen sträubte er sich.
Welche Schlussfolgerungen können wir daraus ziehen? Eine Diagnose kann auch beim Klienten zu einem Motivationsverlust führen. Da es in uns immer zwei entgegengesetzte Kräfte gibt – wir wollen Veränderung und wir fürchten uns vor dem unbekannten Neuen und der größeren Verantwortung –, kann eine Diagnose fördern, dass man in der Not verharren will. Es ist wichtig, dass wir den Wunsch eines Klienten nach einer Diagnose ernst nehmen, aber das Gespräch über die dahinterstehenden Motive mit ihm suchen.
Daneben kann der Wunsch nach einer Einordnung des Erlebens aber auch mit der Angst und der Verunsicherung der hilfesuchenden Person zu tun haben: Sie kann ihr Erleben nicht einordnen. Sie hat alles getan, um aus ihrer Not herauszukommen, hat auch ihren Glauben eingesetzt, aber sie schafft es nicht. Dies erlebt die Person als Versagen, sie bekommt Schuldgefühle und macht sich Selbstvorwürfe. In solchen Situationen ist es ein Akt der Barmherzigkeit, dem Klienten zu erklären, was er erlebt. Auch hier wieder ein Beispiel: Jemandem, der eine depressive Episode durchlebt, zu sagen, dass diese Erfahrung wie jeder Tunnel ein Ende haben wird und dass es „normal“ ist, dass man im Tunnel den Himmel nicht sieht (d. h., nicht mehr glauben kann), schafft echte Entlastung und neue Hoffnung. Dabei habe ich jeweils versucht, auf ein plakatives Etikett zu verzichten.43 Dies ist besonders auch dann wichtig, wenn der Einsatz von Medikamenten angezeigt ist. Falls der Klient eine Diagnose mitbringt (z. B. durch den Hausarzt), gilt es im Gespräch zu klären, wie diese sich für den Klienten auswirkt, und auch darüber zu wachen, dass sich keine unerwünschten Auswirkungen der Diagnosestellung einstellen.
Impuls zur Vertiefung:
Bin ich im Ordnungsschema auf Nöte gestoßen, die ich einmal angehen sollte?
2.5. Gottes Angebote
Auf Gottes Angebote habe ich bereits immer wieder hingewiesen. Nun soll das bisher Gesagte in einem Überblick geklärt werden (vgl. Übersicht 9). Unter „Gottes Angeboten“ fasse ich alles zusammen: Gottes direktes Wirken an uns und unseren Beitrag, der immer auch von Gott angestoßen wird. Zwischen beiden besteht eine gegenseitig sich fördernde Wechselwirkung. Beim menschlichen Teil sollen die Zusammenhänge aufgezeigt werden zwischen dem Annehmen von Gottes Angeboten44, den Wegen, die uns im Glauben offen stehen45, und dem Lernprozess des Umsetzens im Alltag. Aufgrund dieser Klärung sollte es dann möglich sein zu erkennen, welches Gottes Angebote für die im Ordnungsschema der menschlichen Nöte erwähnten Beispiele sein könnten.
| Übersicht 9 |
 |
Weil Gott den Menschen nach seinem Bilde als freies, liebesfähiges Gegenüber schaffen wollte, ging er auch das Risiko des Ungehorsams ein. Im Sündenfall missbrauchte der Mensch seine Freiheit und erlag der Versuchung, sein zu wollen wie Gott. So zerbrachen alle Beziehungen, Mühsal, Not und Tod kamen in sein Leben und er geriet in die Sklaverei des Bösen. Gott gibt seine Ziele aber nicht auf. So sandte er seinen Sohn, der den Menschen durch seinen stellvertretenden Tod aus dem Verhaftetsein in der Sünde loskaufte, ihm die Freiheit wieder schenkte und ihn liebesfähig machte. Gott entschloss sich zu einer radikalen Lösung: Mit Jesus sollte eine neue Menschheit beginnen.
2.5.1. Gottes Teil – unser Beitrag
Die Erlösung und die Neuschöpfung sind Angebote und jeder Mensch muss sie für sich persönlich in Anspruch nehmen.46 Wer Jesus Christus als Herrn in sein Leben aufnimmt, bekommt das Anrecht, „Kind Gottes zu werden“47. Nach der Grundentscheidung der Bekehrung kann also ein Prozess beginnen, durch den der Mensch in die einmalige, individuelle Neuschöpfung hineinwächst, die für ihn geschaffen worden ist. Dies umschreibt die Bibel als „Heiligung“. Einerseits sollen wir uns nach dieser Heiligung ausstrecken, andererseits ist sie das Wirken des Heiligen Geistes an uns.48 Das Zusammenspiel zwischen göttlichem Handeln und menschlichem Beitrag ist letztlich ein Geheimnis, das wir nicht ganz durchdringen können. Mir hat der Vergleich mit einem Pingpong-Spiel geholfen: Gott ist der Meisterspieler, der uns Anfänger zum Spiel einlädt. Der Aufschlag kommt von ihm, schön hoch und in die Mitte unserer Spielhälfte, damit wir den Ball ganz sicher abnehmen können. Wenn wir den Ball zurückgeben, geht das Spiel weiter; wenn wir dies nicht tun, unterbrechen wir das Spiel. Gott bricht das Spiel seinerseits nie ab. Seine Anschläge sind das Gute, das er uns anbietet. Sein Angebot anzunehmen bedeutet, den Ball zurückzuspielen.
Bevor wir uns dem menschlichen Beitrag zuwenden, wollen wir den überwältigend großen Teil Gottes etwas ansehen. Sein direktes Handeln an uns beginnt mit der Bekehrung. Dort sind wir freiwillig in Jesu Erlösungswerk eingetreten und haben ihn eingeladen, mit seiner Kraft in uns wirksam zu werden. Für sein Handeln an uns durch den Heiligen Geist stehen ihm nun zwei Wege offen:
1)Gott verändert uns ohne unser Dazutun, sei es unmerklich, wie bei einer langfristigen Klimaveränderung, sei es schlagartig49, wie es bei der Auferstehung geschehen wird. Gottes „normaler“ Weg ist eher der wachstümliche; dieser führt zu dauerhafteren Ergebnissen.50 Sein Handeln geschieht „unter dem Strich“ unserer Bewusstheit; Gott arbeitet in uns, von unserem Mitwirken ganz unbehelligt, wie ein Chirurg während der Narkose des Patienten. In meiner seelsorgerlichen Erfahrung habe ich immer wieder erlebt, wie viel Gott in den Nächten an Menschen tut. Hier ein Beispiel aus meiner Praxis (Beispiel 13):
Die Frau hatte sich bei mir gemeldet, weil sie über den Verlust eines Kindes durch den plötzlichen Kindstod nicht hinwegkam. Sie war damit einverstanden, dass ich sie auf meine Warteliste setzte. Als wir nach fast einem Jahr mit der Arbeit beginnen konnten, kamen sogleich traumatische Erfahrungen aus der Kindheit auf den Tisch. Deren Aufarbeitung nahm uns ganz in Beschlag; vom eigentlichen Grund ihrer Anmeldung war nicht mehr die Rede.
Mitten in der Bearbeitung dieser schweren Erlebnisse sagte sie zu Beginn eines Gespräches: „Ich weiß nicht, was mit mir geschieht: Jede Nacht weint es in mir. Am Morgen bin ich aber nicht traurig und die Tage gehen ihren gewohnten Weg. Was ist das?“ „Ich weiß es nicht. Lassen Sie es einfach weinen; das scheint gut zu sein für Sie. Aber etwas können Sie tun: Jeden Abend stellen Sie das, was in der Nacht in Ihnen geschieht, unter Gottes Schutz und Herrschaft.“
Als sie nach drei Wochen wieder kam, berichtete sie: „Es weint nicht mehr; nach 14 Tagen hat es aufgehört.“ Wir verstanden damals noch nicht, was geschehen war. Einige Wochen später kam sie auf den ursprünglichen Grund ihres Kommens zurück: „Die Verarbeitung dieses Verlustes ist nicht mehr nötig. Nur etwas möchte ich noch tun: Meinem Mann eine lieblose Äußerung am Totenbett unseres Kindes vergeben.“ Das tat sie dann auch. Im Austausch verstanden wir, dass Gott sie den Trauerprozess unter seiner Obhut in den Nächten, also „unter dem Strich“, hatte durchleben lassen.
Er kann aber auch andere „Gnadenmittel“ für sein Wirken unter dem Strich einsetzen: die Kraft seines Wortes oder das Abendmahl.
2)Gott will uns in den Veränderungsprozess einbeziehen, indem er uns zum Pingpong-Spiel einlädt. Das göttliche Anspiel besteht in einem Anstoß, den wir beim Lesen von Gottes Wort, im Gebet51, durch das direkte Reden des Heiligen Geistes52, durch einen von Gott eingegebenen Gedanken53, einen Traum54, durch eine Predigt, ein Erlebnis, ein Naturschauspiel, das für uns zum Gleichnis wird, usw. empfangen. Das Wirken des Geistes ist unvorstellbar kreativ und vielfältig. Und dann hängt es von uns ab, ob wir diesen Anstoß als Gottes Reden ernst nehmen und aktiv werden. Wie dies konkret geschehen kann, möchte ich an einem persönlichen Beispiel aufzeigen (Beispiel 14):
Ich fuhr mit dem Fahrrad zur Christlichen Beratungsstelle. Diese morgendliche Fahrt hinunter zur Aare war für mich eine erfrischende Gebets- und Vorbereitungszeit im Zwiegespräch mit meinem Herrn. An diesem Morgen wurde ich unvermittelt an eine kürzlich erlebte Situation erinnert. Dazu kam das Wort: „Wenn du so reagierst, Manfred, dann ist das Stolz.“ „Stolz?“ „Ja, Stolz!“ Zuerst wehrte ich mich gegen dieses Urteil; aber dann begann ein innerer Weg des Verstehens; ich musste Jesus recht geben, es stimmte. Und jetzt? Ich wollte es gleich anpacken. Nun begann auf dem Fahrrad ein innerer Weg der Seelsorge an der eigenen Seele, auf dem ich Schritt um Schritt weitergeführt wurde: Ich bekannte Jesus diese Reaktionsweise als Schuld und bat ihn über all den Situationen, in denen ich mich so verhalten hatte, um Vergebung. Ich legte die dahinterstehende Haltung der Überheblichkeit im Namen Jesu ab und bekleidete mich mit der zu meiner Stellung als Sohn gehörenden Haltung der Demut. Ich bat, der Heilige Geist möge mich im Alltag an diesen Schritt erinnern, damit ich ihn treu umsetzen konnte. In den 20 Minuten Fahrzeit war der innere Weg abgeschlossen.
Wenn wir Gottes Anstoß aufnehmen und unsere Seele einen Weg führen, spielen wir den Ball zurück. Das Pingpong-Gleichnis weist darauf hin, dass Gott uns normalerweise nur den ersten Schritt zeigt und uns kein Gesamt-Programm bekannt gibt; nach dem Ausführen des ersten, wird er uns dann den zweiten zeigen. Das Spiel ist dann zu Ende wenn Gottes Ziel, z. B. die Integration der nächsten Portion an Neuschöpfung in unserem Leben, erreicht ist.
Den Zusammenhang zwischen Gottes Grundangebot (Neuschöpfung) und den einzelnen Angeboten (z. B. Vergebung empfangen, ablegen und anziehen usw.) können wir so verstehen: Jedes Einzel-Angebot, das wir mit einem Schritt im Gebet konkret annehmen, bildet einen Baustein für den Aufbau der Neuschöpfung. Gottes schrittweises Leiten hat zum Ziel, dass unsere Seele mitkommen und in seinen Frieden finden kann.55 Zu unserem Beitrag im Zusammenwirken mit Gott gehört auch die Bereitschaft zu lernen. Der Lernweg besteht darin, dass wir nach dem im Gebet vollzogenen Schritt die mit dem alten Verhalten verbundenen Gewohnheiten hartnäckig abbauen, damit sich die neuen aufbauen können.56
2.5.2. Heiligung
Die schrittweise Veränderung, die im Neuen Testament als Heiligung umschrieben wird, ist ein wachstümlicher Prozess; er verläuft aber nicht so gradlinig, wie wir uns dies wünschen. Die Veränderung unserer Person geschieht so, wie der Frühling kommt: Da gibt es milde Tage, wo alles sprießt, und dann kommen die Eisheiligen, wo einiges erfriert; aber der Frühling kommt! Dass Gott sein Ziel mit uns erreicht, dafür übernimmt Jesus Christus die Verantwortung.57
Den Veränderungsprozess der Heiligung, durch den wir immer mehr zu dem werden, wozu Gott uns eigentlich bestimmt hat, vergleiche ich mit dem schrittweisen Umzug vom alten Haus (der gefallene Mensch) ins neue Haus (die individuelle Neuschöpfung). Eine Skizze kann hier etwas Klarheit schaffen:
Abbildung 3: Heiligung

Heiligung ist der Lernweg vom alten ins neue Haus. In der Heiligung zu wachsen bedeutet, dass wir in immer mehr Bereichen unseres Lebens für immer längere Zeit ohne Rückfälle im neuen Hause zu leben vermögen. In der Realität unseres Lebens spielt sich dieser Veränderungsprozess so ab, dass wir in gewissen Bereichen bereits für längere Zeit im Neuen leben können, bis wir, z. B. unter Druck, wieder in die alten Gewohnheiten zurückfallen. Die Bereinigung dieses Rückfalles ermöglicht uns dann die Rückkehr ins Neue. In anderen Bereichen unseres Lebens dagegen haben wir vielleicht noch nie einen Entschluss fürs Neue gefasst, leben also noch ganz im Alten oder haben nur erste Vorschuss-Erfahrungen mit dem Neuen gemacht. Gleichzeitig kann es aber auch Bereiche geben, wo wir schon fest im Neuen verankert sind.
Nun braucht der kleine Haken im alten Haus noch eine Erklärung: Bildlich gesprochen tragen wir alle Hosenträger, die dort angehängt sind – es gibt also eine Kraft, die uns ins alte Verhalten zurückzieht. Wenn wir beim Umsetzen unserer Entschlüsse die Rückfälle jedes Mal treu bereinigen, nimmt die Zugkraft der Hosenträger mit der Zeit ab. Beim Wunsch, der Versuchung zu widerstehen, das Ziehen der Hosenträger also zu überwinden, kommt uns Gottes Gnade als Gegenkraft zu Hilfe: Jesus ermutigt uns zu widerstehen; er zieht uns aufs Ziel zu; er hilft uns nach einem Rückfall auch wieder auf und lädt uns zur Rückkehr ins neue Haus ein. Ganz gesichert wird das Leben im Neuen auf dieser Erde aber nie sein. Die alten Gewohnheiten bleiben in unserem Verhaltensrepertoire erhalten, die Rückfallmöglichkeit bleibt bestehen. Diese Tatsache zeigt, dass die Neuschöpfung auf dieser Erde „Stückwerk“ bleibt.58 Deshalb stellt Paulus fest: „Wir seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes.“59 Wir sehnen uns danach, ganz und unverlierbar im Neuen leben zu können. Dies wird aber erst durch die Auferstehung möglich werden, wo wir „in einem Nu, in einem Augenblick … verwandelt werden“60. Dann wird unser „irdisches Zelthaus“ abgebrochen und wir werden endgültig und unverlierbar “in unserer Behausung aus dem Himmel“61 wohnen.
Impulse zur Vertiefung:
Welche Angebote Gottes gelten für die im Ordnungsschema angeführten Nöte? Überlegen Sie sich, welchen Weg man zu deren Annahme einschlagen könnte.
Im vorherigen Kapitel haben Sie sich einige Punkte notiert. Nun können Sie in einem der Punkte Ihre Seele den Weg zum Frieden Gottes führen.
1 Wie bereits angedeutet, sind uns diese oft gar nicht klar bewusst. Sie haben sich durch Modelllernen und vielerlei Einflüsse in uns gebildet; sie sind oft nicht sehr kohärent und wir haben sie meistens nicht bewusst gewählt.
2 Vgl. dazu Übersicht 7.
3 Ein Beispiel: In meiner Doktorarbeit zum lauten Selbstgespräch konnte ich dieselben Funktionen nachweisen, die sich auch aus biblischen Texten ergeben, wo das Selbstgespräch erwähnt wird.
4 Vgl. die Begriffserklärung im Anhang.
5 Vgl. dazu Jes 55,8: „Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr.“
6 Vgl. dazu im Vorwort.
7 Siehe z. B. 1Mo 1,26–28; Ps 139,13–16; Eph 1,4–5.
8 Eph 1,12; Phil 3,11–14; Titus 3,7.
9 Vgl. dazu die Begriffserklärung im Anhang.
10 1Mo 2,16–17; 4,6–7; 2Mo 34,6–7; Kol 2,13–14.
11 Vgl. dazu Beispiel 1 in Abschnitt 1.3.1.
12 Jer 17,9 (LU); Ps 51,12; Hes 11,19–20; Mt 22,37–38.
13 Die Bedeutung des Modelllernens in der Bibel: Mt 11,29; Eph 5,1; 1Kor 11,1.
14 Eph 2,10; 3,20–21; Röm 6,4; 2Tim 1,7.
15 Vgl. dazu in Makarios die Kapitel „Gott lieben“ (S. 23), „… und deinen Nächsten wie dich selbst“ (S. 33) und „Konzepte für unsere Beziehungen“ (S. 41); ebenso: Röm 13,8.10; 1Kor 13.
16 Vgl. Mt 22,37–40 und Abb. 2.
17 Siehe 1Mo 1,31
18 Vgl. dazu Röm 2,15 und 7,18–19
19 1Mo 2,15–17; 3,1–4,16
20 Röm 5,12; 1. Joh 3,8
21 Röm 8,19–22
22 Joh 8,34–36
23 Röm 7,24 (LU)
24 Röm 5,19; 1. Joh 1,8
25 In 2Mo 34,7 wird auf Gottes Gnade hingewiesen, durch die der Segen auf 1000 Generationen, das Ungute aber nur auf 3–4 Generationen Auswirkungen hat.
26 Vgl. den Abschnitt 1.3.3.
27 Vgl. Röm 8,15–16; Eph 1,11–12; 1Petr 3,9.
28 Vgl. Beispiel 31 in Abschnitt 5.3.4.
29 Vgl. dazu Röm 2,1 und Jesu Warnung in Mt 7,3.
30 Dies gesteht Jesus am Kreuz sogar seinen Mördern zu: „Sie wissen nicht, was sie tun“ (Lk 23,34).
31 Vgl. Hebr 5,8.
32 Einige Beispiele: Lk 2,42-51; 4,28–30; Joh 2,3–4; Mk 3,31–32.
33 ICD-10 Kapitel V (F) / Klinisch-diagnostische Leitlinien, 2. Auflage; Bern 1993.
34 Z. B. bei psychosomatischen Störungen; vgl. Übersicht 30 im Anhang.
35 So kann z. B. mangelnde Liebesfähigkeit durch fehlende Modelle sowie durch eigene Liebesdefizite und verletzende Erfahrungen in der Kindheit bestimmt sein.
36 Vgl. Übersicht 30 im Anhang.
37 Vgl. Beispiel 39 in Kapitel 5.4.
38 1Petr 1,18.
39 Vgl. dazu Beispiel 31 in Abschnitt 5.3.4.
40 Vgl. dazu Abschnitt Geistsorge in Kapitel 5.3.8.
41 Einige Beispiele: Jes 57,18–19; Hos 14,5; Mk 10,17–22; Offb 2,2-5.
42 Die in Übersicht 30 im Anhang aufgeführten Symptome psychischer Störungen dienen nicht der Diagnosestellung; sie sollen dem Helfer erlauben, gewisse Phänomene richtig einzuordnen.
43 Ein weiter Grund, weshalb ich Diagnose-Etiketten zu vermeiden suche: Die Möglichkeit, mittels der Diagnose im Internet alles über seine „Krankheit“ zu erfahren, führt bei vielen Klienten zu Angst und Hoffnungslosigkeit. Sie sind durch die dort vermittelten Informationen überfordert und verunsichert.
44 Siehe Übersicht 3 in 1.3.1.
45 Siehe Übersicht 5 in 1.4.
46 Die Freiheit, die Gott uns lässt, ist Ausdruck unserer Gottesebenbildlichkeit. Vgl. Röm 8,21; 2Kor 3,17; Jak 1,25; 2,12
47 Joh 1,12.
48 Vgl. den Hinweis in 1Kor 6,11: „…ihr seid geheiligt worden … durch den Geist unseres Gottes.“
49 Vgl. z. B. Saul in 1Sam 10,6.9.
50 Vgl. das französische Sprichwort: „Le temps ne respecte pas ce qui a été fait sans lui.“
51 Vgl. z. B. Apg 10,9ff.
52 Siehe wieder Apg 11,12.
53 Auch wieder Apg 11,16 (vgl. dazu 10,46–48).
54 Vgl. z.B. Apg 16,9.
55 Gott allein kennt „den Weg des Friedens“ (Jes 59,8); siehe auch Lk 1,79.
56 Mehr dazu in Abschnitt 3.3.1., „Die Etappen der Veränderung“.
57 Vgl. Kol 1,21–22; Hebr 12,1–2a.
58 Auf diese Stückwerkhaftigkeit weist Paulus in 1Kor 13,9–10 (LU) hin.
59 Röm 8,23 (LU).
60 1Kor 15,52.
61 Aus 2Kor 5,1–2, wo Paulus von der leiblichen Auferstehung spricht.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.