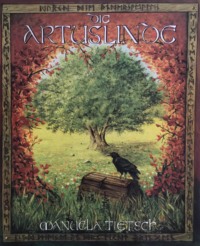Kitabı oku: «Die Artuslinde», sayfa 4
„Sei still, du Vogel! Da gibt es gar nichts zu lachen!“ Er fing den befremdeten Blick Brighids ein, die sich offenbar ein weiteres Mal wunderte, wie und daß er mit dem Vogel sprach.
Brigidh bemerkte wohl, an Talivans Gesichtsausdruck, daß er sich über ihr Befremden erheiterte. Manchmal war dieser Mann doch recht merkwürdig, er blieb jedoch eine gute Wahl! Sie ließ ihm keine Gelegenheit mehr, tiefer in den Wald zu reiten, und während sie sich der Burg zuwandten, schwatzte sie munter drauflos.
Endlich! Ich wagte wieder zu atmen. Das war knapp. Er mußte mich bemerkt haben! Ich dankte der Frau, die mich, ohne es zu ahnen, vor einer Entdeckung bewahrte. Ich lachte innerlich über den Blick des Narbigen, als die Frau zu ihm geritten war: So war also die Angewohnheit, die Augen nach oben zu rollen und die Mundwinkel genervt nach unten zu ziehen, keine Eigenart des 21. Jahrhunderts, es gab sie schon immer! Irgendwie empfand ich diese Tatsache tröstlich.
Ich schenkte den nachfolgenden Reitern kaum Beachtung, denn meine Gedanken kreisten schon wieder um den einen. Ich wüßte zu gerne seinen Namen! Woher hatte er all diese Narben? Hatte er sie im Kampf erhalten? Oder durch einen Unfall? Nein, dafür schienen sie mir doch zu gleichmäßig, als hätte ihm jemand ein Kreuz über das Gesicht gezogen. Und die Frau? War sie seine Ehefrau? Oder eine Geliebte? Ich stellte mir vor, wie er sie in die Arme nahm, sie unter seiner Berührung dahinschmolz. Ich war eifersüchtig! Unglaublich! Ich konnte es nicht fassen. Wie konnte ich eifersüchtig sein?
Doch dieser Mann war zu tiefer Liebe fähig, das fühlte ich! So zärtlich wie er seinen Raben kraulte und so wie er das Pferd behandelte, er mußte empfindsam sein! Ich ertappte mich, daß ich tatsächlich den Wunsch hegte, an Stelle dieser Frau zu sein. Unbegreiflich!
Mit den Augen folgte ich dem Rest der Gesellschaft, bis hinunter zur Burg, ehe ich meinen Blick ein weiteres Mal über das Burganwesen schweifen ließ. Da entdeckte ich, was ich zuvor übersehen hatte: den Garten. Zwischen einigen Laubbäumen, am Rande der Siedlung, sah ich die Obstbäume stehen. Mein Herz hüpfte vor Freude. Nun brauchte ich nur auf die Dunkelheit zu warten, um meinen Vorrat aufzufüllen. Ohne es bewußt zu steuern, suchten meine Augen nach dem Einen. Er ritt zwischen den Häusern zum Burgtor hinauf. Ein anderer Mann ging wild gebärdend neben dem Pferdekopf her, ehe der Narbige unversehens anhielt.
Talivan brachte Lluagor zum Stehen. Braddock baute sich vor ihm auf. Als Dorfältester mußte Braddock ihm die Schwierigkeiten der Bürger vortragen und mit ihm besprechen, oder ihn gegebenenfalls um Hilfe bitten. Er hatte nicht alles verstanden, was Braddock ihm erzählt hatte, sodaß er ihn wiederholen ließ.
„Herr!“, sagte dieser erneut. Talivan nickte ihm auffordernd zu.
„Als ihr im Wald gewesen seid, ist eine eigenartige Fremde zu den Frauen an den Brunnen gekommen. Dalia, Fand und Adna konnten keines ihrer Worte verstehen. Mit Gebärden zeigte sie ihnen, daß sie Essen haben wollte. Ihr Gewand leuchtete feuerrot, ebenso wie ihre Haare. Die drei glauben, daß es sich um eine Zauberin der schwarzen Seite handelt und sie haben schreckliche Angst vor ihr.“ Er stocherte mit den Zehenspitzen im Boden herum. „Besonders Adna, da sie die Frau ungebührlich lange anblickte. Sie sagt, der Stoff ihres Gewandes sei so fein wie ein Windhauch.“ Er blickte zum Burgtor. „Fand schickte die Frau hinauf zur Burg, doch sie floh in den Wald zurück, als wären tausend Krieger hinter ihr her.“
Braddock setzte an fortzufahren, wenn er einmal sprach, war er kaum zu bremsen, doch Talivan gebot ihm mit einer Geste Einhalt. Er sah sich unter den Umstehenden um und winkte Adna zu sich, als er sie entdeckte.
„Was hast du zu berichten?“
Adnas Augen waren kugelrund, und ihre Stimme bebte vor Aufregung, als sie sprach. „Herr, ich habe niemals einen solchen Stoff gesehen! Nicht einmal bei den hohen Damen.“ Sie schluckte überreizt.
„Glaubt ihr, daß sie mich jetzt verfluchen wird?!“
„Warum sollte sie das tun, vorausgesetzt, sie ist eine Frau mit Zauberkräften?“
„Weil ich ihr rotes Gewand so anstarrte?“
Talivan fiel der rote Fleck im Busch wieder ein. Er hatte sich also nicht getäuscht!
Irgendwie hatte ich ein merkwürdiges Gefühl. Die beiden Männer unterhielten sich jetzt schon eine Weile. Da konnte ich das Mädchen vom Brunnen erkennen, sie ging auf den Narbigen zu. Jetzt war ich mir sicher, über was sie sich unterhielten, mehr brauchte ich nicht zu sehen. Mich flach auf den Boden drückend, kroch ich so schnell ich vermochte, aus dem Busch heraus, tiefer in den Wald hinein. Als ich mir sicher war, daß sie mich von der Burg aus nicht mehr entdecken konnten, richtete ich mich wieder auf und lief geduckt weiter. Nach kurzer Zeit entdeckte ich einen Baum, in dessen Krone ich mich verstecken konnte. In etwa drei Metern Höhe drückte ich mich dicht an den Stamm. Zu meinem Glück konnte ich von hier aus den Busch und ein Stück des Weges sehen.
Raban flog laut krächzend von seiner Schulter auf und in Richtung Wald davon. Talivan sah ihm nach, wendete Lluagor und ließ ihn antraben. Er wollte zu dem Busch zurückreiten. Wahrscheinlich würde er nichts mehr vorfinden.
Da kam er bereits, der Ritter. Er ritt den Weg hoch, bis zum Busch hin. Er mußte mich also tatsächlich gesehen haben. Wie gut, daß ich so geistesgegenwärtig gewesen war, sonst hätte er mich jetzt gefunden.
Talivan hielt ohne Zögern vor dem Busch. Mit den Augen suchte er die Umgebung ab. Doch das hatte keinen Sinn, sie war längst über alle Berge. Er wendete Lluagor und ritt zurück in seine Burg.
Er kehrte um, und ich atmete erleichtert aus. Gerettet! Das war knapp. Ich war mir allerdings im Klaren darüber, daß mich nur der heutige Tag gerettet hatte, morgen konnte mich das Glück schon verlassen haben.
Ein unerwartetes sanftes Krächzen über mir, ließ mich erschrocken zusammenfahren und nach oben schauen. Da saß dieser Rabe und blickte mich neugierig an. Würde er jetzt seinen Herren rufen? Ich bewegte mich nicht, starrte nur zurück. Er watschelte wie ein Betrunkener auf dem Ast herum, während er weiter seine heiseren, kehligen Laute ausstieß, leise, als wollte er mich nicht erschrecken. Er hielt seinen Kopf schräg, wie ein Hund, derweil beobachteten mich seine kleinen, schlauen schwarzen Augen unentwegt. Ich hatte das vernunftwidrige Gefühl, als beobachtete mich jemand durch die Augen des Raben. So ein Unsinn! Ich versuchte, den durchdringenden Blick des Vogels nicht zu beachten und begann mit dem Abstieg. Er folgte mir gemächlich, Ast für Ast, ohne mich aus den Augen zu lassen, während er vor sich hinbrabbelte wie ein alter Mann. Als ich schließlich unten ankam, sprang er vor meine Füße auf die Erde. Ich hockte mich hinunter zu ihm, streckte zaghaft die Hand aus. Blitzschnell hackte er danach. Unerwartet krächzte er laut und durchdringend und flog auf, zurück zur Burg. Ich fühlte mich von diesem seltsamen Tier verraten. Sehnsüchtig blickte ich ihm nach.
Ich mußte mir dringend einen Schlafplatz in der Nähe suchen, denn in der Nacht hatte ich meinen Vorrat aufzufüllen. Außerdem sollte ich am Tage versuchen Bucheckern zu sammeln, eine gesunde und schmackhafte Nahrung. Schließlich fand ich einen mir geeignet erscheinenden Baum, auf dem ich mich häuslich einrichtete, denn die Nacht brach mit erstaunlicher Geschwindigkeit über den Wald herein. Ich versuchte, mein Unterbewußtsein auf Mitternacht einzustellen, da um diese Zeit, so hoffte ich, die meisten der Menschen hier schlafen würden, und die Gefahr entdeckt zu werden, sich verringerte. Wenn die Sonne schlafen ging, dann herrschte Dunkelheit, ob ich müde war oder nicht. Gewöhnlicherweise würde ich um diese Zeit zuhause mein Licht einschalten, mir einen Tee aufgießen, mich vor den Zeichentisch setzen und arbeiten. Was gäbe ich darum! Doch ich wollte nicht weiter darüber nachdenken, denn hier gab es keine Lichtschalter. Aber es gab einen außergewöhnlichen Mann!
Wahrscheinlich war es wirklich das Beste, ich schlief eine Weile, um für mein nächtliches Abenteuer frisch zu sein. Aber wie einschlafen, wenn doch die Gedanken im Kopf herumwirbelten, als herrschte dort oben Sturm? Außerdem knurrte ständig mein Magen, und die wildesten Ängste versuchten, meiner Herr zu werden. Das Bild des narbigen Ritters kam mir in den Sinn, wie er dort auf seinem braunen Hengst saß und in den Busch starrte. Wieso war er mir so sonderbar vertraut?
Ein lautes Geräusch unter dem Baum weckte mich wieder. Wildschweine wühlten geräuschvoll grunzend in der Erde. Mir wurde unheimlich zumute. Sie wühlten den Waldboden auf und durcheinander, schubsten sich gegenseitig von den besten Plätzen und bissen sich in die Ohren und Schultern, wohl um ihre Rangordnung zu bekräftigen. Ich wartete, bis die Tiere außer Hörweite waren, ehe ich mich von dem Baum herunterwagte. Der Gefahr, einem ungehaltenen Eber oder einer Bache über den Weg zu laufen, wollte ich mich nicht aussetzen. In der Dunkelheit sah der Wald völlig anders aus. Hatte ich vor dem Einschlafen gedacht, ich kannte mich inzwischen aus, so sah ich mich getäuscht. Ich brauchte ein Weile, um mich auszurichten. Der Vollmond stand ziemlich hoch, und Gott sei Dank war der Himmel klar, so daß ich mich schließlich doch zurechtfand. Wo ein Vorteil war, zeigte sich auch gleich ein Nachteil, der klare Himmel brachte eine eiskalte Nacht mit sich. Zitternd kletterte ich vom Baum. Hoffentlich fand ich diesen wieder, wenn ich zurückkehrte.
Langsam schlich ich zur Burg. Der Anblick, den sie mir im Mondschein bot, ließ mich einen Augenblick sprachlos verharren und genießen. Ein Bild wie aus dem Bilderbuch! Sie thronte oben auf dem Hügel, zu ihren Füßen hockten die Häuser der Bürger, und über allem leuchtete der Mond mit einem riesigen Vorhof. Ich lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf den Weg. Die Nacht schien mir eisig. Der erste Frost kroch über den Boden und mir war, als würde er ohne Umweg in mein Herz hineinkriechen. Plötzlich raschelte und knackte es laut hinter mir im Unterholz. Ich erstarrte. Was oder wer war das? Würde ich womöglich gleich den heißen Atem eines Drachen in meinem Nacken spüren?
Gab es in dieser Zeit Drachen? Würde ich all meinen unglaublichen Erlebnissen ein weiteres hinzufügen können? Mein letztes vermutlich? Gelähmt vor Angst zwang ich mich, den Kopf zu wenden. Da sah ich ihn... Keine zehn Schritte von mir entfernt stand ein gewaltiger Hirsch und putzte sein Geweih im Unterholz. Nur ein Hirsch! Ich atmete erleichtert auf. Mit einem Mal hob er seinen Kopf und blickte geradewegs in mein Gesicht. Ein Hirsch konnte gefährlich sein, gerade in dieser Jahreszeit, ich zwang mich, ruhig rückwärts zu gehen. Er behielt mich wachsam im Auge, während er den Kopf anhob. Für mich unerwartet, gab ein markerschütterndes Röhren von sich. Ich zuckte heftig zusammen, er stieß seinen weißen Atem aus. Meine Knie fühlten sich an wie Butter. Oh Gott, dachte ich, bloß jetzt nicht umkippen! Trotz meines Schocks schaffte ich es weiterzugehen. Als ich mich weit genug von ihm entfernt hatte, drehte ich mich um und lief hinunter zur Burg so schnell ich konnte.
Erst in der Deckung eines Busches hielt ich an, um zu verschnaufen. Ich zitterte heftig, doch nicht nur der Kälte wegen. Nach einer Verschnaufpause schlich ich weiter, immer in Deckung bleibend. Als ich endlich unter dem ersten Birnbaum stand, pflückte ich in aller Eile, bis der Rucksack halb gefüllt war, dann widmete ich mich einem Apfelbaum. Während ich erntete, aß ich mich an Birnen und Äpfeln satt.
Der Rückweg zu meinem Baum war beschwerlicher als ich dachte, denn der Rucksack war inzwischen richtig voll. Der Morgen graute schon, als ich wieder bei ihm eintraf. Den Baum samt schwerem Rucksack zu erklimmen, stellte mich vor eine erneute Schwierigkeit, nach drei Anläufen gelang mir jedoch auch dieses Unterfangen. Ich verstaute das Obst sicher, ehe ich mich in der Astmulde verkeilte, um noch ein wenig zu schlafen. Es gelang mir nicht. Ich war viel zu aufgeregt und verspürte eine gewisse Genugtuung, weil mir gelungen war, was ich mir vorgenommen hatte. Das erste Mal, seitdem ich unter der Linde erwacht war, empfand ich eine gewisse Zufriedenheit.
Während ich so dasaß, die Tierwelt unter mir beobachtend, und während das Morgenrot zu erglühen begann, beschloß ich, der Sicherheit wegen alle paar Nächte einen anderen Baum zu suchen. Die Aussicht darauf war wenig verlockend. Selbstverständlich mußte der Standort im Umkreis meiner Obstbaumjagdgründe bleiben und trotzdem weit genug von der Burg entfernt, um nicht wieder aufzufallen. Es war seltsam, wie wohl ich mich jetzt fühlte, nachdem ich mich satt gegessen hatte. An diesem Morgen erschien mir alles nur halb so schrecklich, und selbst die Gedanken, daß ich damit rechnete, weitere Tage so zubringen zu müssen, schreckten mich weniger. Ich begann den Tag mit neuer Kraft und voller Tatendrang.
7 Das Messer
Talivan hatte die letzte Nacht schlecht geschlafen. Seine Gedanken kehrten immer wieder zu der seltsamen Frau zurück, obwohl er selbst sie nie gesehen hatte. Und seit einer guten Woche auch kein anderer. Trotzdem beschäftigte sie ihn. Er war sich ihrer Blicke nur zu bewußt gewesen. Außerdem beunruhigten ihn die Ritter Mruad und Rioc. Ihr Besuch letzte Woche war unheilverkündend und bedrohlich für das Reich von Artus gewesen. Er wußte genau, daß sie die Lage auskundschaften wollten, und sie würden weitere Burgen aufsuchen. Rioc hatte er noch nie leiden können. Mruad war ein Mitläufer, doch gefährlich waren sie beide. Sie verkörperten Grausamkeit und Gefühlkälte.
Talivan sprach empfindsam darauf an, seit der Folterung. Er schüttelte sich unwillkürlich. Die beiden Ritter waren unberechenbar in ihrer Art, das machte sie um so gefährlicher. Nun zogen sie wie ein giftiger Lindwurm durchs Land und vergifteten jedes Herz, das sich ihren schändlichen Worten öffnete. Sein Magen verkrampfte sich bei dem Gedanken. Er war froh, daß er gleich einen Boten zu Artus gesandt hatte. Warum nur immer Neid, Mißgunst und Unverstand? Artus war ein guter und gerechter König. Talivan konnte nicht verstehen, aus welchem Grund jemand diesen König stürzen wollte. Sollte es denn immer wieder Kriege geben? Die Leidtragenden waren die Schwachen: die Kinder, Frauen und Alten und die Tiere. Ländereien wurden verwüstet, ohne Rücksicht, ohne Voraussicht! Dahinter stand Verlangen nach Reichtum. Dabei gab es wahren Reichtum doch allein im Herzen! Er konnte einzig bei sich selber anfangen, den Frieden zu leben! Er war froh, daß er durch seine frei denkende Familie und seine bedeutsamen Erlebnisse ein friedliches Denken in sich trug. Aus dieser Denkweise ergab sich seine Ehrfurcht vor jeglichem Geschöpf und jeglicher Lebensweise. Er schmunzelte. Nicht selten wurde er ob seiner weichlichen Denkweise schief angesehen. So dachten nur Frauen, keine Männer und erst recht keine Krieger! Aber er wollte kein Krieger sein, und das gab ihm das Recht so zu denken. Natürlich gab es nur eine Wahrheit, doch es gab viele Wege dorthin!. Gleiches Recht für alle. Im selben Augenblick wurde er sich der Widersinnigkeit dessen bewußt. Wo war denn das gleiche Recht für Unfreie oder Leibeigene? Sie kamen mit anderen Rechten auf die Erde als in den Adel Hineingeborene. Oder die Frauen? Wenn sie nicht genügend Rückgrat mitbrachten, dann hatten sie mancherorts weniger Rechte als ein Unfreier. Er konnte nicht glauben, daß dies in der Absicht der Schöpferkraft lag. Kein Mann war fähig, ohne eine Frau ein Kind in die Welt zu setzen, also gehörten sie doch untrennbar zusammen und hatten somit die gleichen Rechte. Ein bißchen Muskelkraft mehr machte die Männer glauben, über alles herrschen zu können, was schwächer war.
Talivan setzte sich in seinem Bett auf und reckte sich. In seiner Kammer war es kalt. Kein Wunder, denn der Winter kam unaufhaltsam näher. Er versuchte, seine vielen mißmutigen Gedanken zu vergessen. Heute war ein neuer Tag! Eine Gelegenheit mehr, aus seinem Leben das Beste zu machen. Raban saß wie immer oben auf dem Gestänge des Bettvorhangs. Er brabbelte leise vor sich hin. Als er merkte, daß Talivan ihm seine Aufmerksamkeit schenkte, hopste er hinunter auf das Bett und ließ sich von ihm unter dem Schnabel kraulen. Nach einer Weile gab ihm Talivan einen liebevollen Klaps, das sichere Zeichen, daß die Streichelstunde beendet war. Raban flog wieder auf das Bettgestänge, während Talivan nach seinem wollenen Untergewand griff. Die Luft war feucht, er sah seinen Atem. Schnell streifte er sich das Untergewand über. Während er seine Decke zur Seite auf´s Bett warf, schob er sich an die Bettkante, um seine Stiefel überzuziehen. Sein Obergewand greifend, hob er mit der anderen Hand seinen Gürtel auf, der von der Bettkante heruntergefallen war. Er knüllte alles zu einem Bündel zusammen und ging hinaus in den Gang, der zur Zeit völlig im Dunkel lag. In der Halle bereiteten unausgeschlafene Mägde und Knechte das Frühstück vor. Talivan grüßte sie freundlich, als er an ihnen vorbei hinaus in den Hof zum Brunnen ging.
Er zog seine Stiefel und das Untergewand wieder aus, um es mit den anderen Sachen auf den Brunnenrand zu legen. Er griff, die Luft anhaltend, nach dem Eimer Wasser, der für ihn bereitstand und goß ihn prustend über sich aus. Jetzt war er wach! Jemand reichte ihm ein Leinentuch zum Trocknen hin.
„Hier!“
Talivan lächelte seinen Bruder Gavannion an. Nachlässig wischte er sich erst sein Gesicht ab, ehe er flüchtig seinen Oberkörper und seine Arme, Lenden und Beine trocknete. Grinsend gab er Gavannion das Tuch zurück.
Gavannion konnte seine Gefühle kaum verbergen. Er hatte jeden Morgen erneut Schwierigkeiten, mit dem Anblick seines Bruders umzugehen. Ihm stieg die Galle hoch, doch er unterdrückte seine Rachegefühle. Er verstand Talivan nicht, der sich anscheinend mit allem abgefunden hatte.
Talivan zog sich an. Er kannte diesen Blick von Gavannion, doch er war nicht bereit, darauf einzugehen. Er wollte nur vergessen, weiter nichts. Rachegefühle halfen ihm nicht dabei, denn er hatte seine Peiniger nicht einmal gesehen. An wem sollte er also seine Rache verüben?
Gavannion zog sich ebenfalls einen Eimer Wasser herauf. Er entkleidete sich und wiederholte die Waschung.
Talivan reichte ihm das Leinentuch, während er sich die feuchten Haare aus dem Gesicht strich. „Hat irgendeiner ein Wort von Abreise verlauten lassen?“
Gavannion schüttelte den Kopf. „Sie fühlen sich sehr wohl!“ .
„Was muß ich denn tun, um sie rauszuekeln?“ Talivan schüttelte unwillig den Kopf, und seine Haare landeten wieder im Gesicht.
Gavannion, der sich anzog, war inzwischen bei den Stiefeln angelangt. Talivan zog eine Grimasse, was sein vernarbtes Gesicht unschön verzerrte. Gavannion blickte hastig zur Seite, weil er Angst hatte, daß Talivan den Schmerz sah, den er bei seinem Anblick empfand.
„Die fressen unsere Wintervorräte weg. Sodelb sagt nichts, ich sehe es an ihrem Blick. Außerdem lassen die Kerle die Mägde nicht in Ruhe!“ sprach Talivan weiter.
Gavannion schaute ihm ins Gesicht, er hatte sich jetzt wieder in der Gewalt. „Vielleicht können wir sie mit einer List fortlocken?“
Talivan zuckte die Schultern. „Darin bin ich nicht so gut.“
„Laß uns nachher darüber reden, wenn du zurück bist. Unter Umständen ist Morcant bereit, einen Köder zu fressen! Ich habe da schon einen Einfall.“
Sie gingen gemeinsam mit Verschwörermiene in die Halle zurück. Die Gäste lagen noch im tiefsten Schlummer, denn sie hatten wie üblich die Nacht durchgefeiert. Talivan fand diesen Brauch unsinnig und fragte sich, wer ihn wohl erfunden hatte. Sollten sich doch die mit irgendwelchen höfischen Gästen herumplagen, denen dies wichtig war. Er konnte es nicht ausstehen. Den Winter über zog die Rotte von Höflingen, jungen Rittern und Damen von Burg zu Burg, um sich durchzufressen und anderen Leuten auf die Nerven zu gehen. Er mußte dem eine Ende bereiten, denn seine Leute waren ihm wichtiger als diese Rotte.
Er beeilte sich, mit dem Essen fertig zu werden, damit er sich heute hoffentlich ersparte, einen von ihnen sehen zu müssen. Er hatte bestimmt bis weit in die Nacht zu tun, denn die Gerichtstage waren immer anstrengend. Doch das war er seinen Leuten schuldig, die oft weite Wege auf sich nahmen, um seinen Rat zu hören oder seine Rechtsprechung in Anspruch zu nehmen. Gestärkt verabschiedete er sich von Gavannion und ging in den Hof zurück. Die fünf Männer, die er zur Sicherheit mitnahm, warteten bereits. Sein Knappe Ganant stand mit Lluagor vor der Treppe. Er begrüßte ihn und die anderen freundlich, bevor er Lluagor eigenhändig sattelte. Mit einem Satz sprang er auf und ritt zügig hinaus.
Ich verbrachte die Tage jetzt tiefer im Wald, beobachtete die Natur, die Tiere, Pflanzen, und die Burg und ihre Bewohner. Jede zweite Nacht schlich ich hinüber und stahl mir meine Nahrung von den Bäumen. Ich hatte mir, selbst auf die Gefahr hin, daß Tiere meine Vorräte plünderten, ein kleines Loch gegraben, in das ich mein Obst legte. Der Baum, den ich inzwischen bewohnte, war mein vierter und der sicherste bisher. Ich hatte oben eine riesige Gabelung, auf der ich mich ausbreiten konnte. Kaum zu fassen, daß ich schon seit einer Woche hier war. Eine aufregende Woche in der Vergangenheit! Ich konnte es nicht glauben, egal wie greifbar mir alles erschien. Sicher war auf jeden Fall, daß ich nicht mehr lange so weitermachen konnte. Schade, daß meine verzweifelte Suche nach einer Höhle erfolglos war. Obwohl meine Angst, einen Bären aus seinem Winterschlaf zu erwecken, auch den Gedanken an eine Höhle in Frage stellte, war die Vorstellung trotzdem lockend.
Die Nächte waren mittlerweile empfindlich kalt, und jeden Morgen erwachte ich mit Reif auf meiner Decke. Die Kälte war grausam und unerbittlich. Sie kroch mir über die Füße, an denen ich lediglich Sandalen trug, bis hinauf in mein Herz. Und irgendwann gäbe es keine Äpfel und Birnen mehr. Gott sei Dank hatte ich im Wald Topinambur gefunden und eine Menge Bucheckern gesammelt, aber wie viele Tiere würden sich diese im Winter mit mir teilen wollen? Ein paar Brombeeren erweiterten meinen Speiseplan, doch die Brombeerzeit war schon längst vorbei. Ich wußte, daß die Indianer und wahrscheinlich auch die Wikinger sich Brot und andere Köstlichkeiten aus der Birke hergestellt hatten, doch wie sollte ich die Rinde vom Baum bekommen? Ich brauchte etwas Scharfes, Spitzes! Am besten ein Messer!
Wie sollte ich an ein Messer gelangen? Konnte ich es wagen, in der Nacht im Dorf unter der Burg nach einem zu suchen? Bestenfalls hatte jemand sein Messer draußen vergessen? Und möglicherweise fand ich eine Decke oder ähnliches, das mich warmhalten könnte. Mir war so erbärmlich kalt! Ich war ja schon dankbar, daß es in letzter Zeit nur zweimal geregnet hatte, denn bei Regen blieb mir lediglich, mich in ein möglichst dichtes Gebüsch im Wald unter großen Bäumen zu verkriechen. Der Gedanke, da drüben in das Dorf zu schleichen, mich viel näher, als mir lieb war, bei den Häusern und ihren Bewohnern aufzuhalten, und außerdem zwangsweise stehlen zu müssen, gefiel mir nicht. Ich hatte keine Wahl! Mein Überlebenssinn war geweckt. Meine Angst vor den Leuten hielt mich davon ab, ein weiteres Mal offen zu ihnen zu gehen, und ich konnte diese Angst nicht besiegen. Ich richtete mich so angenehm wie möglich auf meinem Baum ein, denn mir blieb noch eine Weile bis Mitternacht, meiner bevorzugten Zeit für Ausflüge dieser Art. Die Dauer des Wartens schien mir endlos. Wach in der Dunkelheit zu sitzen war schrecklich. Durch die grauen Wolkenfetzen konnte ich den Mond sehen, der inzwischen ziemlich hoch stand.
Ich schlich los. Mittlerweile kannte ich mich schon recht gut aus, sodaß mir das fehlende Licht des Mondes nicht allzuviel Schwierigkeiten bereitete. Ich hoffte und betete nur, daß mich kein Hund verriet. Vielleicht schliefen die Hunde tief und fest, so fest, daß sie mich überhörten. Übervorsichtig schlich ich von Haus zu Haus. Meine Hände ertasteten zitternd sämtliche Gegenstände in der Dunkelheit, ein Messer fand ich nicht. Beim sechsten Haus passierte dann das Schreckliche, ich hörte gerade noch das leise aber bedrohlich klingende Knurren, da schlug der Hund laut an. Der Schock setzte sich sofort in meine Glieder. Stocksteif stand ich da. Kurze Zeit später zeigte sich der erste menschliche Kopf im Türrahmen. Sämtliche Hunde begannen zu bellen. Ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen, doch mein innerer Antrieb rettete mich und ich lief los. Ich hörte, wie sich weitere Türen öffneten. Stimmen flogen von Haus zu Haus. Unvermutet hörte ich ein sirrendes Geräusch, nahe meinem Ohr. Um Haaresbreite flog ein Pfeil an mir vorbei, in die dunkle Nacht hinein. Ich schluckte. Das war knapp.
Ich lief so schnell ich konnte und klammerte mich an meine einzige Hoffnung, daß ich mich in der Dunkelheit inzwischen viel besser auskannte als die Bewohner des Dorfes. Ich wunderte mich, daß sie mir nicht die Hunde auf den Hals hetzten. Tatsächlich gelang es mir, den Wald heil und wohlbehalten zu erreichen. Ich schien noch einmal mit dem Leben davon gekommen zu sein. Sie mußten eine Heidenangst vor der Nacht haben! Hatten Heiden Angst? Ich lachte unvermittelt. Doch in Wahrheit verdrängte ich damit nur den tief sitzenden Wunsch, am liebsten loszuheulen. Das Lachen verschaffte mir Entspannung. Mit letzter Kraft zog ich mich auf meinen Baum und wickelte mich, wie immer zitternd, in meine ewig feuchte Decke ein. Ich verfluchte meine Ungeschicklichkeit! Wie konnte ich nur so unvorbereitet eine solche Schwierigkeit angehen? Irgendwann überwältigte mich dann doch die Müdigkeit. Ich fiel in einen unruhigen, traumreichen Schlaf.
Früh am Morgen wurde Talivan unsanft aus dem Schlaf gerissen. In der Halle wartete Braddock und ein paar Bürger. Er zog sich in Eile an, denn es hieß, daß es wichtig wäre. Sein morgendliches Bad mußte warten. Seine Laune war den Umständen entsprechend nicht die beste. Die letzten Nächte hatte er zudem schlecht geschlafen, da ihn zu viele Gedanken über zu viele Schwierigkeiten plagten. Außerdem hatte Ganant ihn nicht gerade feinfühlig geweckt, wahrscheinlich weil er hoffte, daß er endlich ein richtiges Abenteuer erlebte.
Braddock stand in der Halle und knetete unsicher seine Hände. Er sah ebenfalls unausgeschlafen aus.
„Was gibt‘s, was nicht Zeit bis nach dem Frühmahl hat, Braddock?“
„Herr, es ist wieder wegen diesem Weib! Die Frauen haben Angst. Sie ist im Dorf herumgeschlichen. Wollte wohl stehlen. In den letzten Nächten ist ständig Obst verschwunden, jetzt haben wir die Schuldige ertappt, sie konnte jedoch entfliehen!“ Braddock holte kurz Luft. „Die Frauen fürchten weiterhin, sie könnte uns verfluchen. Wir bitten Euch um die Erlaubnis, sie suchen und fangen zu dürfen.“ Ein entschlossener Zug legte sich um seine Lippen.
Sie hielt sich also bis zu diesem Zeitpunkt im Wald auf. Wie seltsam, er hatte angenommen, daß sie schon längst weitergezogen wäre. Wer war sie? Was wollte sie hier? Mehr denn je wollte er ihr Geheimnis ergründen. Welche Schwierigkeiten veranlaßten sie, hier zu bleiben? Oder verfolgte sie tatsächlich einen üblen Plan? Gehörte sie womöglich zu Rioc und Mruad? Es gab nur einen Weg, das herauszufinden, er mußte sie finden! Tatsächlich konnte er sich eines gewissen Jagdeifers nicht erwehren. Sein Blick fiel auf Braddock, der auf seine Antwort wartete.
„Laß zehn Männer im Hof versammeln, wir reiten gleich los.“
Braddock schien sichtlich erleichtert, daß er dieser Aufgabe entledigt war.
Raban setzte sich auf Talivans Schulter, während dieser sich an seinen Knappen wendete.
„Ganant, bitte wecke Gavannion, ich möchte, daß er mitreitet.“
Ganant nickte eifrig und rannte los.
Als hätte er Blut gerochen, tauchte plötzlich sein Vetter Morcant auf, seinen Bruder Cadoc im Schatten. Talivan wäre tausendmal lieber ohne ihn losgezogen, bedauerlicherweise ließ sich das jetzt wohl nicht mehr einrichten. Er fand keine Begründung, ihm die Teilnahme an der Suche zu verbieten.
Morcant trug wie stets sein anmaßendes Lächeln auf den Lippen. Seine Kleidung saß, ebenso wie immer, tadellos. Cadoc wieselte wie eh um Morcant herum.
„Nun Vetter! Ich höre, Ihr wollt auf die Jagd gehen? Doch gewiss nicht ohne uns!“ Fragte Morcant leise.
Talivan gab sich geschlagen. „Natürlich nicht ohne Euch! Ihr solltet Euch jedoch im Klaren sein, daß es sich hier nicht um eine Jagd, sondern um eine Suche handelt!“ Talivan lächelte aufgesetzt, was Morcant mit einem gehässigen, leisen Lachen beantwortete.
Wenn Talivan wüßte, wie Morcant ihn, seinen Vetter haßte, dann würde er nicht so leichtfertig mit ihm umgehen. Talivan besaß alles! Die Gunst des Königs, Reichtum, Freunde! Eines besaß er allerdings nicht mehr, und daß es dazu gekommen war, dazu hatte er, Morcant, sein Bestes gegeben. Leider war Talivan zäher als erwartet, sodaß er die Folterung tatsächlich überlebt hatte. Doch wie sah er jetzt aus! Ha! Ein scheußliches Abbild seiner selbst, und das verdankte er ihm, seinem treuen Vetter Morcant! Er wußte es nur nicht. Morcant lachte innerlich, wenn er an die entsetzten Blicke der Damen dachte, die Talivan das erste Mal erblickten. Gegebenenfalls sollte er ihm einmal erzählen, wem er sein jetziges Antlitz zu verdanken hatte. Wie gut, daß er wenigstens seine Genugtuung in der Hinterhand hatte. Auch ihn gafften die Weiber an, wenn sie ihn das erste Mal sahen, doch aus gegenteiligen Gründen. Er wußte um sein gutes Aussehen.
Talivan war bereits auf dem Weg nach draußen, als Gavannion um die Ecke kam. Während sie zusammen weitergingen, erklärte Talivan seinem Bruder, worum es ging. Als sie aus der Tür traten erschrak er, denn Morcant hatte seine Bluthunde anleinen lassen.
„Was soll das? Sagte ich nicht gerade, daß es sich nicht um eine Jagd handelt!? Ich will die Hunde nicht dabei haben!“