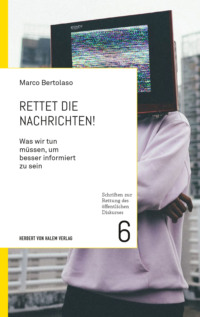Kitabı oku: «Rettet die Nachrichten!», sayfa 5
Ufo-Beweis nur durch die Tagesschau
Medienkritik ist in Deutschland ein Breitensport. Das ist aus Sicht des Journalismus manchmal anstrengend, aber es ist sehr gut so. Wie sonst soll die Qualität unserer Arbeit kontrolliert und verbessert werden? Die Nachrichten hatten da lange eine Ausnahmestellung, insbesondere die eingeführten Medien, im Marketingdeutsch ›die starken Nachrichtenmarken‹. Diesen besonderen Vertrauensvorschuss hat Ingo Schulze in seinem Wenderoman Simple Storys literarisch festgehalten. Einen der Protagonisten beschreibt er so:
»An Ufos glaubte er nicht, obwohl die Amerikaner auf Pro 7 nicht den Eindruck von Lügnern gemacht hatten. Keinesfalls wollte er die Existenz von Ufos ausschließen, sich aber erst dann ernsthaft mit ihnen beschäftigen, sollte er in der Tagesschau davon erfahren« (SCHULZE 1999: 81).
Das Vertrauen in die Nachrichten hat mit Handwerk und Ethos dieses journalistischen Zweigs zu tun, mit dem Bestreben wahrhaftig und umfassend zu berichten. Wenn wir ehrlich sind, spielt aber auch die Ästhetik der Darbietung eine Rolle mit den meist strengen und offiziösen Formaten, die in den elektronischen Medien etwas Zeremonielles oder gar Liturgisches haben.
Von all dem lebt der Nachrichtenjournalismus. Sollte das Vertrauen eines Tages bei einer Mehrheit verloren gehen, dann hätte dies katastrophale gesellschaftliche Folgen weit über den Medienbereich hinaus. Diese Sorge sollte alle umtreiben, die es gut mit einer demokratisch und rechtsstaatlich organisierten Gesellschaft meinen. Für Akteure mit der Absicht, autokratische oder diktatoriale Strukturen zu errichten, ist das genaue Gegenteil der Fall: Für sie wäre die Aushöhlung einer gemeinschaftlich anerkannten Informationsstruktur sehr nützlich, wie auch das diffuse Gefühl in der Bevölkerung, dass ›am Ende doch alle mehr oder weniger gleich lügen‹.
Traditionelle Links-Rechts-Kritik
›User generated discontent‹, so das schöne Wortspiel, ist nichts Neues. Schon lange vor den sozialen Medien haben die Redaktionen viel an kritischen Reaktionen bekommen. Für die alte Bundesrepublik galt allerdings: Egal wie stark der politische und gesellschaftliche Streit auch tobte, die meisten Menschen ärgerten sich beim Hören, Schauen und Lesen der Nachrichten vor allem über die beschriebenen oder zitierten Akteure, über deren Handlungen und Aussagen. Wenn die Redaktionen einmal selbst angegangen wurden, dann weil man ihnen Parteilichkeit unterstellte.
Das Schema der Vorwürfe (wohl nicht nur) an die DEUTSCHLANDFUNK-Nachrichten war, wir seien ›zu links‹ oder ›zu rechts‹, wir seien ›für die Palästinenser‹ oder ›für die Israelis‹ etc. Seit mehr als 25 Jahren reagiere ich auf solche Kritik, dem Medienwandel folgend zunächst per Post (mit Durchschlag für die Akten), per Fax, dann in E-Mails, bei Facebook und Twitter und immer wieder auch telefonisch. Lange konnte ich dabei bequem auf eine eherne Tatsache verweisen: Unsere Arbeit war meist für die Hälfte der Kritiker zu links oder zu palästinenserfreundlich und für die andere Hälfte zu rechts oder zu israelnah. Das war für mich ein willkommenes Indiz dafür, dass wir wohl alles in allem nicht so schlecht lagen.
In meinen Antworten habe ich immer wieder berichtet, dass es die vermutete parteipolitische Einflussnahme auf öffentlich-rechtliche Nachrichten nicht gibt. Nicht mehr gibt, um genau zu sein. Als junger Redakteur habe ich in den 1990er-Jahren noch die späten Ausläufer eines Systems beobachtet, in dem Journalisten der CDU, der CSU, der SPD oder der FDP nahestanden – nach allgemeiner Beobachtung nicht zu ihrem Nachteil.
Ich kann nicht beurteilen, wie oft und wie stark es heute noch zu politischem oder ökonomischem Druck auf lokale und regionale Medien kommt. Ohne Weiteres versichern kann ich jedoch zumindest aus meiner Erfahrung, dass das Bundeskanzleramt nicht morgens bei uns seine Wünsche für den Tag übermitteln lässt, auch wenn manche Menschen von diesem hartnäckigen Glauben nicht ablassen können.
Lediglich Willy Brandt rief an
Immerhin hat in den 1980er-Jahren mit Willy Brandt ein ehemaliger Bundeskanzler und SPD-Chef in unserer Redaktion angerufen. Er wollte am Morgen nach einer für ihn wenig erfreulichen Wahl von dem Redakteur der Presseschau erfahren, ob es denn wirklich keine für die Sozialdemokraten positiven Kommentare gegeben habe. »Nein, Herr Bundeskanzler, nicht einmal die Frankfurter Rundschau«, so die Antwort, die mein Kollege bis zu seiner Rente immer wieder gerne erzählte. Parteipolitische Interventionen ›von oben‹ sind mir zumindest für die vergangenen Jahrzehnte nicht bekannt. Ebenso pauschal wie mutig wage ich die Behauptung, dass dies im übrigen Spektrum der bundesweiten Medien einigermaßen ähnlich sein dürfte, also auch bei Privatsendern und Zeitungen. Auch hier sind die Redaktionen kaum noch parteipolitisch einzuordnen. So weit, so gut, könnte man meinen. Doch inzwischen haben wir es mit anderen Problemen zu tun.
›Lügenpresse‹ und ›Systemmedien‹
Seit mehr als zehn Jahren hat sich der Ton verändert und verschärft. Eine wachsende Zahl von Menschen übt an den Nachrichten nicht mehr nur Kritik nach einem Links-rechts-Schema innerhalb des politischen Systems. Sie greifen den Informationsjournalismus im Ganzen an, gemeinsam mit einem System, als dessen verfilzten Bestandteil sie ihn sehen. In Radikalität und Begründung erinnert diese Komplettablehnung an so unterschiedliche Perspektiven wie die von RAF-Zirkeln auf die ›kapitalistischen Medien‹ oder von Menschen in Diktaturen auf die staatlich kontrollierte Presse. Wir werden konfrontiert mit einem Vorstellungsgebäude, in dem angeblich alle etablierten Parteien gleich ticken, ob sie nun regieren oder in der Opposition sind.
Die Vermutung dieser Kritiker ist, dass Abgeordnete und Funktionärinnen als Kartell das Überleben der eigenen Kaste verfolgen, Hand in Hand mit Industrie und Finanzkonzernen, zum Schaden ›des Volks‹. Wer diese Sichtweise teilt und an die Medien denkt, der sieht eine ›Systempresse‹ vor sich. Er unterstellt einen ›politisch-journalistischen Komplex‹ voller gegenseitiger Abhängigkeiten, voller Komplizenschaft und Kumpanei.
In dieser Lesart ist es das Ziel öffentlich-rechtlicher Medien, der wichtigen Verlage und privaten Fernsehsender, die bestehende Machtordnung zu erhalten und damit die eigenen Posten, Privilegien und Pfründe. Wer so denkt, für den sind die Informationsmedien nicht mehr eine vierte Gewalt, die Regierung, Gesetzgeber und Gerichte kontrolliert. Sie sind die ersten Schurken. Immer wieder wird in diesem Zusammenhang der Begriff ›Mainstream-Medien‹ gebraucht. Ich nutze ihn nicht, um Verwirrung zu vermeiden. Im deutschsprachigen Raum handelt es sich um einen Kampfbegriff, in der englischsprachigen Welt werden damit vielfach schlicht die etablierten Massenmedien bezeichnet.
Auf Grundlage der beschriebenen Systemkritik begann Ende des 20. Jahrhunderts in vielen westlichen Ländern der neuerliche Aufstieg populistischer Parteien. Auf dieser Basis eskalierte auch in Deutschland die Kritik an den Informationsmedien bis hin zu den ›Lügenpresse‹-Rufen und zu massiven Drohungen, denen auch einige meiner Kolleginnen und Kollegen ausgesetzt waren und sind. Wegmarken, die in den Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer seismologische Ausschläge hinterlassen haben, waren die Euro-Krise, der Russland-Ukraine-Konflikt, die Aufnahme der Flüchtlinge 2015, die Kölner Silvesternacht und zuletzt der staatliche Umgang mit der Corona-Krise.
Medienkritische Bestseller
Aus Sicht der Systemkritiker bedarf es keiner politischen Einflussnahme mehr auf die Nachrichten, weil sie die Redaktionen ja für den Bestandteil eines Kartells halten. Im Journalismus werden nicht nur Mitläufer und Opportunisten vermutet, sondern Gesinnungstäter, und zwar linke. Sie gehören in dieser Vorstellung wie die politisch-ökonomische Elite zu einem »links-rot-grün-verseuchten 68er-Deutschland«. Davon sprach der AfD-Co-Vorsitzende Jörg Meuthen auf dem Stuttgarter Parteitag 2016 um dann auch noch das berühmte »leicht versifft« anzufügen (VON ALTENBOCKUM 2016).
Diese Kritik am Journalismus findet sich auch theoretisch verdichtet und zwischen zwei Buchdeckeln. Das ist ein weltweites Phänomen, für das ich aus den USA James O’Keefe erwähnen möchte: Seine Kritik an den etablierten Medien trägt den Titel American Pravda (O’KEEFE 2018). Ein regelrechtes Literaturgenre dieser Art hat sich auf dem deutschsprachigen Markt entwickelt. Auf Anhieb fallen mir da Udo Ulfkotte und Gerhard Wisnewski ein. Ulfkottes Gekaufte Journalisten – Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken (ULFKOTTE 2014) beschreibt den Systempressevorwurf. Wisnewski hat einen Almanach entwickelt, man könnte auch sagen ein Geschäftsmodell. Er bringt jeweils für das Vorjahr Verheimlicht, vertuscht, vergessen heraus, ein »anderes Jahrbuch« mit all dem, was angeblich in den vergangenen zwölf Monaten nicht in den Zeitungen stehen durfte.
Wir reden hier von Bestsellern, die in bestimmten Gruppen Aufmerksamkeit bis hin zur Verehrung genießen. Ihr Echo schallt mir auch in unserer Hörerpost entgegen. Ich habe diese und ähnliche Bücher gelesen, weil mich jede Kritik an den Nachrichten interessiert. Allerdings fand ich die Argumentation meist enttäuschend. Nach meiner Überzeugung brauchen die Nachrichten bessere, letztlich auch härtere Kritik, um voranzukommen.
Bei Ulfkotte liest man etwa, dass die Idee des Euro auf einer Bilderberger-Konferenz beschlossenen wurde mit dem Ziel einer »Amputation der deutschen Identität« (ULFKOTTE 2014: 258). Bei Wisnewski werden wir im Jahrbuch 2020 auf den Gedanken vorbereitet, dass der Brand von Notre-Dame kein Unglück gewesen sein könnte. Waren Islamisten oder Satanisten am Werk? Oder doch eher der französische Staat, der ›heiß abgerissen‹ hat, um sich die Sanierung eines maroden Weltkulturerbes von Spendern finanzieren zu lassen? (WISNEWSKI 2020: 82-93). Wo wir schon bei Flammen sind: Vielleicht waren auch die verheerenden Brände im Amazonas eine Inszenierung von Ökologen (WISNEWSKI 2020: 189)? Das sind nur zwei von vielen haarsträubenden Beispielen.
Ich musste bei der Lektüre immer wieder an Angela Merkel ist Hitlers Tochter (ALT/SCHIFFER 2018), denken, eines der Bücher über Verschwörungstheorien, in dem auch Ulfkotte und Wisnewski genannt werden. Wisnewski wiederum gibt seinen Lesern diese Botschaft mit:
»Erstens: alles, was als ›Verschwörungstheorie‹ gebrandmarkt wird, enthält etwas Wahres. Zweitens Jeder, der als ›rechts‹ abgestempelt wird, hat etwas Wahres gesagt. Drittens, alles und jedes, das/der auf dem Globus stigmatisiert und als ›rechts‹ gebrandmarkt wird, nützt seinem Volk und damit allen Völkern« (WISNEWSKI 2020: 271).
Abgesehen von meinem klaren inhaltlichen Widerspruch würde ich gerne darauf hinweisen, dass solch eine Aussage in meinem Verständnis den Abschied von logischem, kritischen Denken bedeutet und den Rückzug in hermetische Rechthaberei.
Enttäuschte Freunde
Albrecht Müller ist ebenfalls ein Bestseller-Autor. In seinen Büchern wie Meinungsmache (2010) und auf dem von ihm mitgegründeten Webportal, den Nachdenkseiten, findet sich immer wieder Kritik an den etablierten Medien. Müller hat eine lange politische Karriere hinter sich als enger Mitarbeiter der Bundeskanzler Willy Brandt und Helmut Schmidt, als Mitglied des Bundestages für die SPD. Aus seinen Texten lese ich manchmal ein ›früher war es besser‹ heraus, manchmal die Ablehnung der herrschenden Verhältnisse durch den Aussteiger. In Meinungsmache verrät er ironischerweise, dass er in seiner Zeit im Kanzleramt selbst viel damit zu tun hatte, »Strategien der Meinungsbeeinflussung (zu) entwickeln« (MÜLLER 2009: 9).
Maren Müller, Volker Bräutigam und Friedhelm Klinkhammer haben insbesondere die Nachrichten im Visier. Die Gründerin des Vereins Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien und die beiden NDR-Ruheständler haben der ARD-Tagesschau das Buch Zwischen Feindbild und Wetterbericht (2019) gewidmet. Ihr aktivistisches Wirken manifestiert sich nicht nur in Buchform, sondern umfasst kaum noch zu zählende Programmbeschwerden. Nach meinem Eindruck liegt bei diesen drei Kritikern Enttäuschung vor über einen Sender und seine Hauptnachrichtensendung, die ihnen eigentlich viel bedeuten.
Während es bei Albrecht Müller in Meinungsmache stark um eine aus seiner Sicht neoliberale Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik geht, greifen Maren Müller, Bräutigam und Klinkhammer immer wieder eine angeblich NATO- und USA-hörige, gegen Russland gerichtete Berichterstattung über internationale Fragen an. Diese Kritikpunkte verbinden viele der nachrichtenkritischen Stimmen aus unterschiedlichen Lagern. Die Argumentation zum Umgang der Medien mit Russland hat Ulrich Teusch zusammengefasst. Immer wieder Russland, so heißt ein Kapitel seines Buchs Lückenpresse (TEUSCH 2018: 93ff.). Die Frage wäre eine eigene Arbeit wert, warum es in Teilen der deutschen Gesellschaft so viel Empathie mit Russland gibt, was grundsätzlich gut ist, aber so wenig Einfühlungsvermögen in die Lage Polens oder der baltischen Länder, um nur diese Beispiele zu nennen.
Zu den ›enttäuschten Freunden‹ unter den Buchautoren zähle ich in jedem Fall den Medienwissenschaftler Uwe Krüger und den Journalistenkollegen Tom Schimmeck. Krügers einschlägiges Werk trägt den Titel Mainstream. Warum wir den Medien nicht mehr trauen (2016). Bei Schimmeck habe ich Am besten nichts Neues (2010) im Sinn. Beide kritisieren heftig, wollen den bestehenden Informationsjournalismus aber verändern und verbessern, nicht abschaffen.
Meine Vermutung ist, dass die Leitmedien das Vertrauen des Publikums von Udo Ulfkotte und Gerhard Wisnewski kaum wieder gewinnen können, was auch immer sie unternehmen werden. Den Austausch mit den Leserinnen und Lesern der anderen Genannten halte ich dagegen für erfolgversprechend und geradezu empfehlenswert. Das gilt selbstverständlich auch für den Dialog mit den Autoren selbst.
Anhaltende Zweifel an der Unabhängigkeit
Nun stellt sich die Frage, warum so unterschiedliche Formen der Kritik am Informationsjournalismus jeweils eine so beachtliche Resonanz erhalten. Vordergründig könnte die Antwort lauten: Die Medien sind tatsächlich mächtig und ihre Nachrichtenangebote sind es erst recht. Selbstverständlich kommen täglich Fehler vor und es gibt an der Arbeit von Journalistinnen und Journalisten immer etwas auszusetzen. Wer sich mit den Medien anlegt, kann daher grundsätzlich mit Zuspruch rechnen. Ziel von Ratschlägen, Kritik und Angriffen werden schließlich auch Schulen und Kirchen, Unternehmen und Gewerkschaften. Also, alles halb so wild?
In diese Richtung geht auch ein anderer Gedanke: In Deutschland steht bei einer Reihe wichtiger Themen eine überschaubare Minderheit einem breiten Konsens gegenüber. Umfragen aus den letzten Jahren zeigen, dass es beständige gesellschaftliche Mehrheiten gibt für die EU und die Ehe gleichgeschlechtlicher Paare, gegen Kernkraft, für den Kohleausstieg und so weiter. Es kann also nicht überraschen, dass die Mehrheit der Menschen im Journalismus ähnlich tickt. Der Mainstream-Vorwurf richtet sich aus dieser Perspektive betrachtet nicht in erster Linie an die Medien. Er ist vielmehr ein Vorwurf von Minderheiten an die Mehrheitsgesellschaft, der am Journalismus abgearbeitet wird. Also, alles nicht so schlimm?
Auf solchen beruhigenden Gedanken sollte sich der Informationsjournalismus besser nicht ausruhen. 2021 veröffentlichte die Stiftung Neue Verantwortung eine auch mit öffentlichen Mitteln finanzierte Studie zur digitalen Nachrichtenkompetenz in Deutschland. Sie belegt anhaltende Zweifel in der Bevölkerung an der Unabhängigkeit des Journalismus (MESSMER/SÄNGERLAUB/SCHULZ 2021). Nur die Hälfte der mehr als 4.000 repräsentativ Befragten wusste danach, dass Nachrichten über einen Bundesminister ohne dessen Genehmigung veröffentlicht werden dürfen.
Wiederum nur die Hälfte konnte sagen, dass Bundestagsabgeordnete nicht entscheiden, worüber der öffentlich-rechtliche Rundfunk berichtet. 24 Prozent vertraten die Einschätzung, dass die Bevölkerung in Deutschland von den Medien systematisch belogen werde. Ebenfalls ein Viertel der Antwortenden hielt den »Lügenpresse«-Vorwurf für gerechtfertigt. Und 35 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Staatsministerin für Kultur und Medien der Bundesregierung unterstellt sei, weitere 40 Prozent antworteten hier mit »weiß nicht«.
Die Ergebnisse sind aus meiner Sicht dramatisch. Sie ergänzen die schon genannten und ebenfalls beunruhigenden Erhebungen zum Medienvertrauen. Lassen Sie uns dem nachgehen. Werfen wir einen näheren Blick auf einige Erscheinungsformen der Entfremdung zwischen einem Teil der Gesellschaft und den Nachrichten.
Nicht mehr repräsentativ? –
Wenn Menschen sich nicht wiedererkennen
Seit Jahren gehen einige Menschen in Sachsen regelmäßig zur Pegida-Kundgebung. Sie beschimpfen Migranten, begrüßen die Machtausübung von Wladimir Putin. Sie verunglimpfen die parlamentarische Demokratie, deren Repräsentanten – und die Medien.
Im Ruhrgebiet haben Menschen die Arbeit verloren. Die Produktion ihres Betriebs wurde nach Asien verlagert. Manche von ihnen können die Miete kaum noch zahlen, seitdem ein Immobilienkonzern die ehemalige Bergarbeiter-Siedlung gekauft hat. Sie gehen nicht mehr wählen oder machen ihr Kreuz bei Populisten. Die Lokalzeitung bestellen sie ab, dem WDR vertrauen sie nicht mehr.
Bei einer Reihe von Rechtsanwälten oder Ärztinnen im Taunus oder in München stören wirtschaftliche Probleme den Alltag nie. Im Gegenteil, hier stehen SUVs mit Schweizer Autobahnvignette vor der Haustür für die Fahrten zum Genfer See, nach Zürich oder Lugano. Manche dieser Menschen vermuten, dass es in der Europäischen Union immer auf Kosten der deutschen Steuerzahler zugeht. Von Union, SPD und Grünen haben sie sich auch deshalb abgewandt, weil Deutschland ab September 2015 viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Ihre Abos von FAZ und Süddeutscher Zeitung sind gekündigt.
Hinter diesen Milieuskizzen stehen zumeist keine konkreten Menschen, die ich persönlich kenne. Doch auf Grundlage der Rückmeldungen aus der Gesellschaft, die mich bei der Arbeit erreichen, halte ich sie für einigermaßen realistisch.
Ähnliches lässt sich in anderen westlichen Demokratien mit freien Medien beobachten, sehr deutlich in Frankreich. Dort treibt der ›Front National‹, inzwischen in ›Rassemblement National‹ umbenannt, schon lange etablierte Parteien und Medien vor sich her. 2018 begannen dann die Proteste der sogenannten ›Gelbwesten‹, der Gilets Jaunes, mit der Ablehnung höherer Steuern auf Diesel und Benzin. Immer lauter und manchmal auch sehr gewalttätig wurden weit weg von Paris Frauen und Männer, von denen viele wirtschaftlich kaum noch klarkommen. Sie brauchen – Umweltschutz hin oder her – das Auto, weil es in der Provinz keine Alternativen mehr gibt. Denn über die vergangenen dreißig Jahre sind ihnen nicht nur Arbeitsplätze, die Post, die Bankfilialen und die Arztpraxen abhandengekommen. Man hat ihnen auch die Regionalbahnstrecken stillgelegt. Viele der Gilets Jaunes misstrauen dem staatlichen Fernsehen, aber auch privaten Medien. Sie fühlen sich öffentlich falsch dargestellt.
Populismus und Medienkritik
Mit diesem holzschnittartigen Ausflug in die Soziologie ziele ich auf den Zusammenhang ab zwischen gesellschaftlichem Unbehagen, Leistungsdefiziten politischer Systeme und der Kritik am Nachrichtenjournalismus. Weitere drei Beispiele nur noch in Kurzfassung:
Das marode Parteiensystem Italiens war in den 1990er-Jahren Geburtsort des ›Berlusconismo‹, der frühen Variante des stark über Medien agierenden modernen Populismus. Inzwischen bestimmen dort mit der Lega, den ›Fünf Sternen‹ und nun auch noch mit den derzeit aufstrebenden ›Fratelli d’Italia‹ gleich drei unterschiedliche populistische Bewegungen die Szene. In Großbritannien und den USA gilt ein Mehrheitswahlsystem. Deshalb hatten Populisten es dort sehr schwer, als alternative neue Kraft in die Parlamente zu kommen. Also blieb ihnen nur, eine der beiden großen Parteien zu unterwandern. Das ging in den USA schneller und hat nach der ›Tea Party‹-Bewegung im Jahr 2016 erst den republikanischen Kandidaten, dann den Präsidenten Donald Trump hervorgebracht.
Im Vereinigten Königreich war der Prozess lang und quälend. Er hat nach Jahrzehnten einer EU-feindlichen Bewegung innerhalb der Konservativen Partei und dem Druck der 1993 gegründeten UK Independence Party um Nigel Farrage zum Brexit-Referendum geführt und zu der Regierung von Boris Johnson.
Auch in diesen drei Ländern wurde der Aufstieg der Populisten begleitet und ermöglicht durch Kritik an den klassischen Nachrichtenmedien, insbesondere den liberalen. In Großbritannien gab es von Anfang an mächtige Zeitungen, unter anderem aus dem Murdoch-Konzern, die diesen Kurs unterstützten. In den USA bildete sich ein Milieu heraus, in dem zunächst neurechte ›Talk Radios‹ mit Protagonisten wie Rush Limbaugh oder Sean Hannity den Boden für die populistische Wende bereitet haben, dann ab 1996 auch der den Murdochs gehörende TV-Sender Fox News.