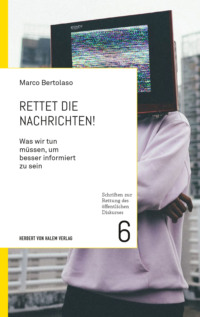Kitabı oku: «Rettet die Nachrichten!», sayfa 4
Banalisierung und Personalisierung
Die Vermischung bedeutet, dass die unterschiedliche Relevanz von Bundestag und Boulevard vom Absender nicht mehr klar gekennzeichnet wird. Die verbliebenen harten Nachrichtenthemen wiederum erleben Banalisierungen: Sachliche Auseinandersetzungen werden personalisiert, sie werden im Wettbewerbsmodus geschildert oder nach dem Sieg-Niederlage-Schema einfach gehaltener Sportberichterstattung. Oft erinnert die simpel gestrickte Dramaturgie an Seifenopern. Solche nachrichtliche Berichterstattung kennt ›die Guten‹ und ›die Bösen‹. Jeder Held braucht einen Gegenspieler. Große Corona-Helden wie Christian Drosten bekommen neben einem Alexander Kekulé sogar noch einen Hendrik Streeck entgegengestellt.
Schon vor etwa fünfzehn Jahren kamen die Kommunikationswissenschaftler Georg Ruhrmann und Roland Göbbel zu dem Schluss, die Fernsehnachrichten seien in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer unpolitischer geworden. Nachrichten würden nun stärker als Dienstleistung verstanden, sie seien bildlastiger geworden und der Trend gehe zur Boulevardisierung (RUHRMANN/GÖBBEL 2007).
Als ehrenwertes Motiv und als theoretischer Überbau für Infotainment wird manchmal die These bemüht, dass die bittere Medizin von Bundestag und Nahost mit einem Löffel bunter Geschichten besser runtergeht. In meinen Augen schwingt da etwas Manipulatives und Erzieherisches mit. Aber, über die gute Absicht kann man diskutieren, selbst wenn ich empirische Belege für die positive Informationswirkung noch nicht gesehen habe. Allerdings, warum muss das eine Einbahnstraße sein? Man könnte schließlich das Argument drehen und von Unterhaltungsangeboten fordern, stärker als bislang politische und gesellschaftlich relevante Informationen zu vermitteln.
Nach meiner Einschätzung ist es für die Nachrichten sinnvoller, weiter auf die ›harten‹ relevanten Themen zu setzen, sie dann aber für das jeweilige Publikum gezielt aufzubereiten, ihre Bedeutung zu vermitteln und dafür eine anschauliche Sprache zu finden. Das gelingt immer wieder, setzt aber Kreativität, Talent und Aufwand voraus. Gute Beispiele sind die öffentlich-rechtlichen Nachrichtenangebote für jüngere Menschen wie 1 Live vom WDR oder Deutschlandfunk Nova.
Junk News und Gesprächswert
Ein anderes Licht auf dasselbe Problem wirft das Konzept der ›Junk News‹ oder ›Junk Food News‹. Der Begriff stammt aus den 1980er-Jahren und geht zurück auf Carl Jensen, der in den USA das Project Censored gegründet hat. Die gemeinnützige Organisation sucht eigentlich nach den vergessenen, den unterdrückten Nachrichten, so wie es in Deutschland die Initiative Nachrichtenaufklärung macht. Project Censored weist aber inzwischen auch auf solche Themen hin, die alles andere als vergessen sind und trotz geringer Relevanz ein großes Nachrichtenecho erhalten. Buntes, Prominentenberichte, Sex and Crime, also die schon genannten Elemente des Infotainments, werden hier angeprangert.
Carl Jensen kritisiert in dieser Hinsicht auch die rituellen Wasserstandsmeldungen, etwa von der Börse, die er ›Jo-Jo-Nachrichten‹ nennt, oder den nicht immer reflektierten Journalismus der Jahrestage. Solche ›Junk News‹ vermüllen die Informationslandschaft und verstopfen die üblichen Nachrichtenkanäle. Sie nehmen Raum ein und binden Aufmerksamkeit – Ressourcen, die für Relevanteres nicht mehr zur Verfügung stehen. Nennen möchte ich hier auch die ›Aufregerthemen‹, die ihren Weg Tag für Tag aus den sozialen Medien in die Nachrichten finden. Den Begriff ›Junk News‹ hat der amerikanische Fernsehjournalist Tom Fenton als Titel seines Buchs übernommen, in dem er nicht weniger als »The Failure of the Media in the 21st Century« beschreiben will (FENTON 2009). Er beklagt vor allem einen Niedergang der Auslandsberichterstattung mit gravierenden Folgen für die internationale Politik insbesondere der USA.
Gestützt wird die Praxis von Infotainment und ›Junk News‹ regelmäßig durch den Hinweis auf den Gesprächswert als Nachrichtenkriterium. Gemeint ist, vereinfacht gesagt, dass all das, worüber die Menschen sprechen, auch in die Nachrichten gehört. Das Ziel soll sein, dass das Publikum in der Bahn oder in der Arbeitspause mitreden kann. Das will ich nicht einfach abtun. Wenn es eine Sturmflut gibt oder eine Hitzewelle, dann wird jede Nachrichtenredaktion das breit aufgreifen. Aber warum sollte ein Familienstreit in der britischen Königsfamilie auf einer Ebene mit der Debatte über eine Steuererhöhung behandelt werden?
Wenig Verständnis habe ich offen gestanden für das wachsende Ausmaß an konstruiertem Gesprächswert. Ich meine von Medien erzeugte Themen, die dann mit der Begründung in die Nachrichten sollen, dass Menschen über diese Medienprodukte sprechen. Mir erschließt sich der Vermarktungskreislauf. Mir leuchtet aber nicht ein, warum B-Prominente, Menschen, die für das Bekanntsein bekannt sind, die ihren Status nur durch das Fernsehen erhalten haben, genau deshalb auch noch nachrichtlich begleitet werden sollen. Auch wenn es polemisch wirken mag, so möchte ich hier gerne auf eine beinahe naturgesetzliche Regel hinweisen, die der Philosoph Thomas Grundmann aufgestellt hat:
»Sobald die Kategorien des Interessanten, Unterhaltsamen und Akzeptablen bei der Bewertung von Meinungen und Positionen die Oberhand über die Wahrheit gewinnen, vermehrt sich Bullshit nahezu ungebremst« (GRUNDMANN 2018: 9).
Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat einmal im Gespräch mit Kollegen gesagt, dass ein vor der Haustür sterbendes Eichhörnchen in diesem Augenblick für die eigenen Interessen relevanter sein kann als Menschen, die in Afrika sterben (PARISER 2011). Die legitime Bedeutung von nahen und nahegehenden Informationen ist unbestritten. Für Facebook ist das ein großartiges Geschäftsmodell, so wie es das für Boulevardmedien immer schon war. Und doch frage ich mich besorgt: Was mag aus den für mich eigentlichen Nachrichten werden, wenn sie auf Plattformen mit der von Zuckerberg beschriebenen Relevanzstruktur angewiesen sind?
Eine mögliche Antwort auf diese Frage stammt schon aus dem Jahr 2005: News vs. Entertainment: How Increasing Media Choice Widens Gaps in Political Knowledge and Turnout. So der Titel eines Aufsatzes, den Markus Prior damals veröffentlicht hat. Der Titel deutet die These schon gut an. Grundlage war eine repräsentative Meinungsumfrage in den USA. Sie ergab, dass die wachsenden Möglichkeiten an die persönlich bevorzugten Medieninhalte zu gelangen, tendenziell Politikinteressierte noch kundiger macht, aber politkferne Menschen eben auch die Chance gibt, diese Themen völlig zu umgehen (PRIOR 2005).
Über ein Missverständnis
Aus vielen Diskussionen weiß ich, dass meine Sicht auf den Informationsjournalismus als überheblich verstanden werden kann – missverstanden, wie ich finde. Mir ist klar, dass die meisten Medien sich nicht wie die öffentlich-rechtlichen Anbieter durch einen Beitrag finanzieren. Sie sind auf ein Publikum angewiesen, das direkt oder indirekt über die Werbung zahlt. Und selbstverständlich halte ich den klassischen Nachrichtenjournalismus nicht für perfekt, sonst hätte ich kein Buch geschrieben mit Anregungen zu seiner Veränderung.
Ich habe auch nichts gegen Reichweitenorientierung. Ich bin sehr dafür, wertvolle Information so zu gestalten, dass sie möglichst viele Menschen erreicht. Stephen Cushion hat es in seinem Buch über Nachrichten und Demokratie völlig richtig formuliert:
»[…] if news only appeals to a select few, its democratic value is limited to an elite sphere as opposed to a far wider constituency of citizens. Or, put more bluntly, journalism should be able to remain popular without being populist« (CUSHION 2012).
Wir alle brauchen Unterhaltung. Manches Fernsehangebot rechtfertigt sich schon allein dadurch, dass es Menschen in unserer Moderne der Vereinzelung in ihrer Not der Einsamkeit hilft. Mir ist bewusst, dass das Bunte ewiger Bestandteil der Medien ist. Damit und mit Konzerten hat der Rundfunk im frühen 20. Jahrhundert begonnen, nicht mit Politik. Noch viel älter ist diese Tradition im Bereich der Zeitungen: In Gustav Freytags 1852 uraufgeführten Lustspiel Die Journalisten streiten sich Redakteure einer Provinzzeitung, warum denn neben »Wäsche vom Boden gestohlen, Drillinge geboren, Konzert, Vereinssitzung, Theater« auch noch »die große Seeschlange« ins Blatt muss, eine immer wiederkehrende »abgedroschene Lüge«. Die Begründung des zuständigen Redakteurs lautet: »Sie passte gerade, es fehlte an sechs Zeilen« (FREYTAG 1977: 19).
Die Vermischung von Unterhaltung und Information, und das ist mein Punkt, geht aber oft einher mit der Reduzierung des wertvollen und begrenzten Raums für Nachrichten. Sie trübt den Blick auf die wichtigen Themen und unterspült so die Fundamente der gesellschaftlichen Debatte. Über die Jahre habe ich meinen Frieden gemacht mit Servicethemen oder den sogenannten ›News to use‹, wenn sie denn wirklich nützliche Alltagsinformationen transportieren. Es spricht nichts gegen eine letzte Meldung, über die Menschen schmunzeln können und die eine emotionale Entlastung bringt.
Dennoch will mir nicht einleuchten, warum der dominante Bereich der Unterhaltung auch noch in die Sphäre der Nachrichten eindringen soll, warum wichtige, manchmal lebenswichtige Themen mit Unterhaltung vermischt werden. Ich habe auch nicht verstanden, warum es anmaßend sein soll, einem breiten Publikum möglichst viel nachrichtliche Informationen zukommen zu lassen. Ist es nicht eher arrogant, Menschen im Wesentlichen nur Unterhaltung zuzutrauen und sie mit ›Brot und Spielen‹ abzuspeisen?
Nachrichten-Mimikry und ›News Washing‹
Zurück zur Unschärfe des Nachrichtenbegriffs. Dazu tragen sicher auch die verschiedenen Kopien bei, die uns im Alltag begegnen. Die als seriös wirkende News-Ästhetik wird gerne nachgeahmt, zum Beispiel für Boulevardmagazine. Dort werden dann Beiträge über Hollywood und Familiendramen so präsentiert, als wäre es die Tagesschau. Nicht selten wirkt das dann wie eine Tagesschau unter Ecstasy-Einfluss. Auch solche Magazine werden gleichwohl in der Jahresbilanz mancher Sender unter ›Information‹ aufgeführt.
In der Werbung sind die Nachahmung von Nachrichtenformaten oder das Spiel mit Elementen aus der Nachrichtenwelt ebenfalls beliebt. Das kann man in vielen Werbespots erleben. Man kann es im Supermarkt im Einkaufsradio hören oder an Reklame in Zeitung und Internet ablesen, die von redaktionellen Inhalten kaum unterscheidbar ist. Die verschiedenen Ausprägungen dieser Mimikry tragen dazu bei, Medienkonsumenten zu täuschen und das Gefühl für echte Nachrichten zu unterlaufen.
Die Motive für die vielfältige Imitation der Nachrichtenformate versteht man vermutlich am besten, wenn man sich den enormen Erfolg des Informationsjournalismus im 20. Jahrhundert vor Augen führt. Insbesondere an den dominierenden Massenmedien, erst dem Radio, dann dem Fernsehen, kamen die Mächtigen nicht vorbei. Niemand konnte sie ignorieren, der ein Produkt bewerben wollte, ob es sich dabei nun um eine Politikerin oder ein Gesetz, um eine Lebensversicherung oder um Schokolade handelte. Für die Gesellschaft ist dieses ›News Washing‹ schädlich. Besonders gravierend ist dabei das systematische Simulieren von unabhängigem Informationsjournalismus durch die PR aller möglichen Akteure.
Die News-Channels
Ambivalent fällt die Bilanz für die ›News-Channels‹ aus, die für einige Jahrzehnte prägend waren. Auch wenn ihre Bedeutung schon länger schwindet, während die der digitalen Informationsplattformen stetig wächst: In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts markierten die Sender doch im Radio und vor allem im Fernsehen einen Triumph der Nachrichten, die eigene, ausschließliche Kanäle bekommen hatten.
Das Phänomen ist global, kultur- und systemüberschreitend. Die ästhetische DNA von CNN hat sich weltweit durchgesetzt, einschließlich der Fanfaren, der Anchormänner und -frauen, der geteilten Bildschirme bei Zuschaltungen und manchem mehr. Unverzichtbar scheint das Dauertickern von Informationen sehr unterschiedlicher Art und Relevanz über ein Laufband im unteren Bildschirmbereich zu sein. Ob in China oder Russland, ob in Chile oder Nigeria, überall bedient man sich dieser Stilmittel, sogar beim nordkoreanischen Staatsfernsehen.
Aus nachrichtlicher Sicht waren und sind die ›News Channels‹ jedoch auch problematisch. Sie geben ein Versprechen kontinuierlicher Aktualität und Relevanz, das niemand einhalten kann. Die Kanäle hatten und haben 24/7 einen immensen Bedarf an Inhalten, sodass die Qualität der Ware beim besten Willen wechselhaft sein muss. Experten werden aufgefahren, reich an Zahl und Fachgebieten. Ihre Aufgabe ist die Einordnung und Erklärung. Manchmal scheint ihr Auftrag aber eher, Neuigkeitspausen durch Spekulation auszugleichen, damit es keinen Druckabfall gibt und keinen Abriss des Spannungsbogens.
Oft habe ich mich geärgert über diese Versuche, aus jedem Nachrichtentag einen 11. September zu machen, auch weil damit eine Sozialisierung des Publikums einherging: Viele Menschen verloren vor lauter Hektik die Geduld für das Entwickeln einer Nachrichtengeschichte. Dem Publikum verschwammen vor lauter Banalem die Grenzen der Relevanz bis zum Dschungelcamp und zur internationalen B-Prominenz. Aus Sicht der Branche mag das egal sein. If they are watching, who cares if there’s no new news? So heißt jedenfalls ein Kapitel aus Newsflash (2004: 112ff.), einem Buch über das TV-Nachrichten-Geschäft von Bonnie Anderson, die lange für NBC News und für CNN gearbeitet hat.
Nachrichten-Satire und Newsgames
Angelehnt an die Gestaltungselemente der ›News Channels‹ sind verschiedene Satire- und Comedysendungen entstanden. Die heute-show des ZDF hat ein großes Publikum, genauso wie das US-Original The Daily Show und ähnliche Formate in aller Welt (vgl. HARSIN 2018). Ähnliches gibt es im Radio, wie zum Beispiel der Wochenrückblick Satire deluxe des WDR. Sehr erfolgreich sind Internetangebote, die sich im Stil nachrichtlicher Berichte an der Grenze von Satire und Comedy bewegen. Im deutschsprachigen Raum ist als erstes Der Postillon zu nennen. Eine gewisse Zahl von Menschen findet über diesen Weg den Zugang zur Aktualität, manchmal vor allem über diesen Weg.
Zur gesellschaftlichen Bedeutung gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Die einen fürchten, dass nicht jede und jeder erkennt, dass es sich um ›Fake News‹ in unterhaltender Absicht handelt. Außerdem wird eine manchmal sogar systematische Verächtlichmachung der politischen Klasse beklagt. Die anderen freuen sich, dass mit Nachrichteninhalten kreativ gearbeitet wird und dass neben der Unterhaltung auch ein Informationswert übrigbleibt, gerade für nachrichtenferne Gruppen. Das Magazin von Jan Böhmermann, das im ZDF seit einiger Zeit nach der heute-show läuft, zeigt, dass das Genre lebendig ist und sich weiterentwickelt.
Verschiedene Medien experimentieren seit einiger Zeit mit dem Format der Newsgames. Die Idee ist, mit solchen Hybriden die Anziehungskraft der erfolgreichen Computer-Spiele für die Vermittlung von Nachrichteninhalten zu erschließen. Zwei Beispiele unter vielen: Das New-Yorfe-Times-Projekt The Voter Suppression Trail macht die Probleme und Ungerechtigkeiten des amerikanischen Wahlsystems erfahrbar. Mit Syrian Journey aus der Welt der BBC kann eine Flucht aus Syrien (ein wenig) nachempfunden werden.
Cornelia Wolf und Alexander Godulla haben das Potenzial der Newsgames untersucht (WOLF/GODULLA 2018). Ihr Zwischenfazit lautet, dass es diese Informationsangebote bislang nicht schaffen, weite Kreise zu erreichen. Ein Grund dafür ist, dass die meist jüngeren Nutzerinnen und Nutzer an die technisch deutlich aufwendigeren Produktionen mit höherem Erlebniswert der Gaming-Industrie gewöhnt sind. Offen ist, ob der wachsende Bereich der ›Augmented Reality‹ auch für die Information neue Möglichkeiten schafft, etwa im Sinn des Immersiven Journalismus.
Nachrichten: Ein Kosmos mit vielen Galaxien
Was sind eigentlich Nachrichten? Mit dieser Frage sind wir in das Kapitel gestartet. Das Konzept ist begrifflich unscharf, gleichermaßen verbunden mit der alltäglichen Kommunikation wie mit dem Journalismus. Nachrichten gehören zum ältesten Bestand menschlicher Kultur und Traditionen. Inzwischen sind sie auch mit einem Handwerk verbunden, einem journalistischen Beruf, der aber weder ein Patent besitzt noch Monopolansprüche.
Journalistische Nachrichten bilden einen Kosmos mit vielen Galaxien. Je nach Medium, Zielgruppe und Qualitätsanspruch, je nach den zur Verfügung stehenden Ressourcen können die Angebote Lichtjahre voneinander entfernt sein. Nachrichten sind werbefrei, durch Werbung finanziert, oder sie bestehen schlicht aus Werbung. Sie werden nach bestem Wissen und Gewissen frei recherchiert und zusammengestellt, sie entstehen aber sehr oft auch interessengeleitet oder unter dem Druck von Mächtigen und Ideologien jeder Art. Manchmal werden sie mit der Pistole im Rücken geschrieben, im übertragenen Sinne oder buchstäblich.
Vieles ähnelt den Nachrichten nach dem ›Look and Feel‹ zum Verwechseln, ist aber doch etwas anderes. Manchmal ist es Propaganda, manchmal Unterhaltung. Vielleicht ist es Werbung oder PR. Hin und wieder ist es auch Satire oder Comedy. Ich spreche da gerne von Nachrichtoiden, bei denen nur die Form etwas mit Informationsjournalismus zu tun hat. Mit der Verantwortung der Redaktionen für diese Nachrichtoiden werden wir uns noch beschäftigen, genauso wie mit dem besonderen Selbstverständnis der westlichen Nachrichtenkultur, unserer Nachrichtenkultur.
Dieser Nachrichtentradition fühle ich mich verbunden, allerdings in einem Verhältnis des ›Ja, aber‹. Worin meine Bedenken bestehen, was aus meiner Sicht zu tun ist, davon erfahren Sie mehr im zweiten Teil des Buchs. Ich selbst verwende ›Nachrichten‹ und ›Informationsjournalismus‹ weitgehend synonym. Mir ist klar, dass jede Art der Kommunikation Informationen vermittelt. Ich benutze den Begriff nicht streng wissenschaftlich, sondern in Abgrenzung zu journalistischen Formen, bei denen Unterhaltung oder anderes im Vordergrund steht. Dies entspricht meiner Vorstellung von Nachrichten, die über die 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau hinausgeht, sich aber deutlich von Unterhaltungs- und Meinungsjournalismus, von Magazinen und Talkshows abgrenzt.
Es bleibt dabei: Auch nach 30 Jahren im Beruf traue ich mir keine Definition in drei Sätzen zu. Insofern nehmen Sie bitte dieses Buch im Ganzen als meinen Versuch der Annäherung an einen angemessenen Nachrichtenbegriff.
Nicht mehr geliebt? – Die Sache mit dem Vertrauen
›Gescheiterte Existenzen‹. So nannte der deutsche TV-Kleinbürger Alfred Tetzlaff in Ein Herz und eine Seele die Journalisten. In der Silvesterausgabe 1973 der in der alten Bundesrepublik beliebten WDR-Soap schimpfte er weiter: Journalist werde eben, wer zu faul oder zu dumm sei für einen richtigen Beruf. Das traf damals den Nerv eines Teils der Gesellschaft und so ist es auch heute wieder. In den Jahrzehnten dazwischen erlebte das Ansehen des Journalismus ein ungewöhnliches Zwischenhoch. Dazu haben so unterschiedliche Faktoren beigetragen wie der Mythos ›Watergate‹, die Akademisierung des Berufs und die deutlich verbesserten Verdienstmöglichkeiten.
Es müssen nicht alle die Menschen mögen, die ihr Geld mit Nachrichten und Berichten verdienen, so wie auch nicht jeder die Zahnärztin oder den Airbuspiloten sympathisch finden muss. Eine für alle drei Berufe wichtigere Währung ist das Vertrauen. Mit dem Vertrauen in die Medien beschäftigen sich zahlreiche Untersuchungen. Der Digital News Report des Oxforder Reuters Institute ist ein weltweit anerkanntes Barometer für die Entwicklung des Informationsmarkts. In der Ausgabe 2020 erfahren wir, dass im Schnitt der untersuchten Länder nur noch 38 Prozent der Befragten »den meisten Nachrichten meistens vertrauen«, vier Prozentpunkte weniger als 2019 (NEWMAN 2020). Das Institut unterhält auch ein spezielles Forschungsprojekt zum Vertrauen in die Nachrichten, dessen erster Zwischenbericht mit der Feststellung beginnt: »Trust in news has eroded worldwide« (TOFF et al. 2020).
Die Ergebnisse für Deutschland fallen zumeist etwas günstiger aus als in anderen Staaten. Hierzulande fühlt die Universität Mainz den Puls alle zwölf Monate innerhalb einer Langzeitstudie. Für 2020 wurde ein gestiegenes Vertrauen in die Medien festgestellt (JAKOBS 2021). Die Vermutung der Forschungsgruppe bei der Veröffentlichung im Frühjahr 2021: Den Medien scheint es gelungen zu sein, in der Corona-Krise mit Orientierung zu punkten. Allerdings wird dies verbunden mit einer Warnung:
»Es stellt sich […] die Frage, wie sich Medienvertrauen und Medienzynismus, Mediennutzung und der Glaube an Verschwörungserzählungen mit dem Abklingen der Corona-Pandemie und in der Zeit nach der Krise weiterentwickeln werden. Medien und Journalisten sollten nicht davon ausgehen, dass die Vertrauenszuwächse dauerhaft sein werden […]« (JAKOBS et al. 2021: 161).
Daher werfe ich einen Blick zurück auf die Anfang 2020 veröffentlichten Ergebnisse der Studie für 2019, also noch ohne Corona-Einfluss (SCHULTZ 2020), Damals war das Ergebnis, dass 43 Prozent der Befragten den etablierten Medien in wichtigen Fragen vertrauen. Die Zustimmung blieb damit einigermaßen konstant. Gestiegen war allerdings die Zahl derjenigen, die ihr Misstrauen zu Protokoll gaben, und zwar auf 28 Prozent. Die Gruppe derjenigen, die sich zwischen diesen beiden Lagern einordnen, war mit 29 Prozent so klein wie noch nie in den bisherigen Umfragewellen. Das Fazit der Mainzer Forschungsgruppe: Das Vertrauen ist stabil, doch die Polarisierung wächst (SCHULTZ et al. 2020: 323).
Ist das Glas nun halb voll oder halb leer? Mich jedenfalls beruhigt der Gedanke nicht, dass nur etwa jede und jeder zweite Befragte den klassischen Medien vertraut, selbst wenn die traditionell stark überdurchschnittlichen Zustimmungswerte für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland erfreulich sind. Beruhigend finde ich auch nicht, was ein Blick auf internationale Untersuchungen zeigt, zum Beispiel das jährliche »Vertrauens-Barometer« der US-Kommunikationsagentur Edelman.
Hier war das im Frühjahr 2021 veröffentlichte Ergebnis der weltweit durchgeführten Umfrage wie folgt: 59 Prozent waren der Ansicht, dass Journalisten die Bevölkerung absichtlich mit Falschinformationen und Übertreibungen hinters Licht führen. Ebenfalls 59 Prozent glaubten, dass die meisten Informationsmedien sich stärker darum kümmern, eine Ideologie oder eine politische Position zu unterstützen, als die Öffentlichkeit zu informieren (EDELMAN 2021: 25).