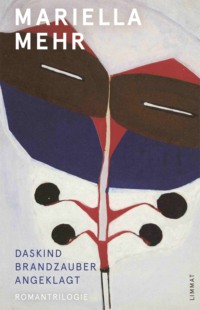Kitabı oku: «Daskind - Brandzauber - Angeklagt», sayfa 5
9
Das Gebrüll erstarb so plötzlich, wie es, nach einer Schrecksekunde bleierner Stille, durch die Fabrikhalle gedrungen war. Vielleicht hätte es immer im Dunkeln leben sollen, denkt Daskind, das den Daumen, den Zeigefinger und den Ringfinger der rechten Hand des schreienden, dann verstummten Arbeiters auf den Zementboden fallen sah. Der dem Kind zulächelte und dabei die für die Arbeit an der Blechschneidemaschine notwendige Vorsicht vergaß. Vielleicht hätte es den Augen verbieten sollen, das Erstaunen in den Augen des Verletzten zu sehen, ehe er schrie, dann verstummte und sich wie eine Marionette mit einer langsamen, stillen Bewegung zu Boden gleiten ließ. In kurzen Stößen floss das Blut, sammelte sich zu einem scharlachroten See um den Mann, dessen eben noch lächelndes Gesicht fahl wurde, der jetzt mit geschlossenen Augen dalag, stumm, gekrümmt wie ein Ungeborenes im Mutterleib.
An diesem Sonntagmorgen hatte Kari Kenel Daskind bei der Hand genommen, war mit ihm zum Bahnhof gegangen und in den Zug gestiegen, den er jeden Morgen nahm, um zur Arbeit zu fahren. Er musste die Sonntagsschicht beaufsichtigen, die in Sonderproduktion eine Serie verschieden großer Wannen für das Bezirksspital anfertigte. Es war einer jener Sonntage, an denen man die Vögel besonders fröhlich zwitschern zu hören meint, der Himmel wölbte sich in einem gleichmäßigen, etwas milchigen Blau über der Landschaft. Als der Zug einfuhr, empfing die beiden ein Blasorchester, das sich auf dem Perron zum Jahresausflug eingefunden hatte. Kari Kenel, mit seiner von Enttäuschungen vergifteten Vergangenheit, brachten auch die schmetternden Trompetentöne von Ich hatt’ einen Kameraden keinen Sonntagsfrieden. Daskind aber schwang sich auf den Rücken eines roten Milans und träumte. Hopste, als müsste es sich trotz der sommerlichen Hitze warm halten, unruhig auf der Stelle, tanzte zu den Klängen der Bläser mit nichts als sich zum Gefährten. Nahm sich vor, mit den Träumen aus Schwarz und Schmerz keine Nachsicht mehr zu haben.
Der Weg vom Bahnhof zur Fabrik führte an einer Wildrosenhecke vorbei, die Kari Kenel seinen geheimen Garten nannte. Hundsrosen, deren Duft besonders schwer und süß in der Luft schwebte, wenn sich ein Gewitter ankündigte. Sie nutzte Kari Kenel für die Veredlung seiner eigenen Pflanzen, obwohl unter Züchtern das Ansehen dieser bescheidenen, aber lieblichen Rose gelitten hatte, seit man über einfachere und erfolgreichere Methoden verfügte.
An solchen Tagen fühlte sich Daskind beinahe sicher. Ein Stück des fett und wächsern an der Seele haftenden Zorns hatte sich aufgelöst, ließ ihm ein Fenster zur Welt. Daskind fühlte Boden unter den Füßen. Aus den Augenwinkeln betrachtet es die schwere, an diesem klaren Morgen verlässlich wirkende Gestalt des Pflegevaters, probiert ein Gefühl aus, das Vertrauen heißen könnte. Weltvertrauen. Der Versuch gelingt nicht ganz, doch Daskind lässt sich nicht beirren. Es weiß, dass jeden Tag ein neues Ich aufkeimen kann, während ein anderes stirbt. Wie die Hundsrosen am Weg, einige erblühen, andere sterben ab. Daskind kennt sich da aus. Im Sterben. Im Sterben vor allem.
Aber manchmal geschieht’s, dass Daskind ohne Netz auf dem Seil tanzt. Dass es die gebotene Vorsicht vergisst. Dann kann auch ein Morgen wie dieser zur Katastrophe werden, wenn Daskind nicht aufpasst, die Zeichen übersieht, die jene Dinge ankündigen, von denen Daskind wissen müsste, dass sie jederzeit in sein Leben einbrechen, es in die kälteste Finsternis stoßen können. Daskind im papierdünnen Gewand.
Die Fabrikhalle vibriert vom Lärm der Maschinen. Von den Sägeblättern wirbelt Metallstaub auf, ein metallisch süßer, heißer Geruch dringt in die Lungen. Die Maschinen werden von Männern in blauen Überkleidern bedient. Der Staub überzieht ihre Gesichter. Sie sehen aus, als trügen sie silbern glänzende Masken. Ihre Augen hinter den gelben Brillen sind nicht zu sehen. Vorsichtig gleiten die Hände den Sägeblättern entlang, sie führen die großen, flachen Blechstücke mit fließenden Bewegungen über den Tisch. Die Sonne dringt durch die Fensterfront in die Halle, staubige Lichtbahnen ziehen durch den Raum. Das Kreischen der Maschinen zerreißt dem Kind fast das Trommelfell. Trödelt einer der Arbeiter, geht das Schrillen seiner Maschine in ein stotterndes Gewimmer über, das bald darauf mit einem miauenden Klagelaut erstirbt.
Nachdem der Mann dem Kind zugelächelt hat und die drei Finger seiner rechten Hand über den Zementboden gerollt sind, greift das Sägeblatt ins Leere, ehe der Klagelaut erstirbt. Wie auf ein verabredetes Zeichen verstummen auch die andern Maschinen, starren zwölf Augenpaare Daskind an, nicht den verletzten Mann. Bis einer der Arbeiter aufspringt, mit schweren Schritten die Halle durchquert, sich zum Ohnmächtigen hinunterbeugt, den Sirenenknopf bedient und hilflos stammelnd nach Kari Kenels Händen greift, als könne der das Unglück ungeschehen machen. Aber das kann Kari Kenel nicht, nicht er und kein anderer, nicht dieses Unglück, das vom Kind heraufbeschworene. Ein verstörter Ausdruck in den Augen des Pflegevaters, der sich rasch in Zorn verwandelt. Dann eine Bewegung, fast spielerisch. Daskind wirbelt durch die Luft, stürzt in wattige Nacht.
Da sitzt ihnen der Schrecken doppelt in den Gliedern, den Arbeitern. Erst der verletzte Mann, dann Daskind, das, die Arme schützend um den Kopf geschlungen, zwischen den Blechstücken liegt. Einer streicht dem Kind mit der Hand über die Stirn, dem Kind, das durch eine Nacht treibt, die kein Ende nimmt. Daskind träumt, dass es ganz und gar bei Gott ist, oder beim Satan, man kann das nie recht auseinanderhalten in der Nacht, die kein Ende nimmt. Beißt sich die Zunge wund, um nicht zu schreien. Hat einen roten Geschmack von zersägtem Blech auf der Zunge. Einen Essiggeschmack, saugt sich daran fest.
Kari Kenel wusste nicht, wie ihm geschah. Diese ohnmächtige Wut hatte er noch nie gefühlt, hatte nicht gewusst, dass ein Mordbube auch in ihm steckt. Nun hingen ihm die Arme wie große Schinken am Körper. Das hatte Daskind aus ihm gemacht, dieser hergeholte, stumme Balg, zu dem er keinen Zugang fand, an das er trotz allem gefesselt blieb. In Idaho hatte er vor langer Zeit ein zusammengewachsenes Paar gesehen. Von der Taille bis zu den Füßen waren die beiden unzertrennlich, sie bewegten sich zusammen auf drei Beinen. Gut aufeinander eingespielt, überwanden sie die täglichen Schwierigkeiten, die eine solchermaßen aufgezwungene Gemeinschaft mit sich brachte. Aber Kari Kenel erinnerte sich an den sehnsüchtigen Blick des einen Zwillings, wenn er sich nach der Vorstellung um den Bruchteil einer Sekunde später verbeugte als der andere. Sehnsucht und ein verzweifelter Hass lag in dem scheinbar freundlichen Gesicht. Einmal hatte sich Kari vorgedrängt, hatte die groteske Vorstellung des Zwillingspaars ganz nah auf sich einwirken lassen. Während die beiden auf drei Beinen über die Bühne steppten, traf ihn plötzlich ein Blick, der mörderischer nicht hätte sein können. Zu den Klängen einer Harmonika schrie sich der Verkrüppelte seinen Hass von der Seele, Kari Kenel konnte den Hass riechen, den Hass und die Not. Es war, als würde auf der Bühne Gott in den Boden gestampft, dieser unbegreifliche, sonderbare Gott, der einige mit Schönheit segnete und andere an Leib und Seele verkrüppelte. So erging es ihm oft beim Kind, dass er eine ohnmächtige, verzweifelte Wut spürte, die Sehnsucht, sich des Zwillings zu entledigen. Diese Sehnsucht war durch nichts zu besänftigen, auch nicht durch die Tränen, die er, über das nackte Gesäß des Kindes gebeugt, weinte, wenn er zuschlug. Die Sehnsucht war ein scharfer Luftzug im Gehirn, der alle andern Gefühle auf einen Haufen zusammenfegte, bis es einsam wurde im Kopf vor Kälte. Der Kälte folgte die Wut, eine Wut, an der er jetzt fast erstickte. Sie war anders beschaffen als alle Gefühle, die er kannte. Sie pflügte sich durch den Körper in die Fäuste, Kari Kenel konnte die Gelenke knacken hören, bevor er blitzschnell zum Schlag ausholte. Er war auf eine anstößige Weise in dieser Wut gefangen und fühlte gleichzeitig, dass er sich mit jedem Atemzug selbst verwundete, dass Daskind, weit von ihm entfernt, an andern Orten durch eine andere Nacht schwamm, er würde nicht mithalten können, nie würde er mithalten können mit dem Kind, das ihm so fremd geblieben war.
Es gab Zeiten, da hatte Kari Kenel Grund zur Hoffnung gehabt. Ärzte hatten Daskind untersucht und behauptet, es sei nicht wirklich stumm, es sei, im Gegenteil, sehr wohl imstande, seinem Alter entsprechend zu reden. Das war kurz nachdem Kari Kenel darauf bestanden hatte, Daskind zu sich nach Hause zu holen. Ermutigt durch die Ärzte, setzte sich Kari Kenel mit dem Kind in die Besenkammer, wo ein großer Stapel alter Zeitungen aufgeschichtet lag. Geduldig reihte er Buchstaben um Buchstaben zu einfachen Wörtern aneinander, bald war der Riemenboden mit ausgeschnittenen Buchstaben übersät. Aber Daskind schaute verstört auf die Wörter, als wären sie gefräßige Tiere, die jederzeit nach ihm schnappen konnten. Kari Kenel bemühte sich, sanfte Wörter zu finden, Wörter, die keine Angst verursachen sollten. Aber Daskind schien die Wörter nicht wirklich zu sehen, es lebte in einem Universum zwischen den Wörtern, sprang mit seinen Blicken an den Wörtern vorbei in eine geheimnisvolle Welt, die, so vermutete der Pflegevater, keiner Sprache bedurfte. Kari Kenel holte Blumennamen aus dem Gedächtnis hervor, von denen er wusste, dass sie Daskind kannte. Rosen, Margeriten, Ringelblumen und Königskerzen erstanden in der Kammer, doch Daskind tastete sich trotzig an ihnen vorbei in seine Welt, die keine Blumen kannte. Kari versuchte es mit den Vögeln, die er auf seinen Waldspaziergängen, Daskind an der Hand, mit Pfiffen, Trillern und Zirpen herbeilockte. Entmutigt sah er zu, wie Daskind teilnahmslos vor sich hin starrte.
An jenem Abend hatte Kari Kenel das erste Mal zugeschlagen, dem Kind befohlen, sich über den Stuhl des Immergrünen zu legen, eigenhändig das Hemd über das Gesäß des Kindes gestreift und den Gürtel aus den Schlaufen seiner Arbeitshose gezogen. Hatte ihn erst prüfend durch die Luft zischen lassen, dann ausgeholt und geweint. Wer sein Kind liebt. Wer sein Kind sprechen hören will. Der Züchtigung ging eine kurze Aussprache mit Frieda Kenel voraus. Die Daskind nie züchtigte, es nie berührte, nicht im Zorn, nicht in Zärtlichkeit. Die an der Nähmaschine saß und dem Zischen des Ledergurts lauschte, den Atem anhielt, die Hände ruhig im Schoß. In der Küche kaute der Immergrüne an einem Stück Käse, trank dazu dunkles Bier aus der Flasche und wischte sich nach jedem Schluck mit dem Handrücken den Schaum von den Lippen. Wartete auf seine Beute, die ein andrer ihm zurichtete. Er roch förmlich, wie die Gier von seinen Lenden Besitz ergriff, gelb wie die tabakfleckigen Finger, die er in die Öffnungen des Kindes bohren würde.
Nach zwanzig Schlägen, die Daskind auf Geheiß des Pflegevaters mitzuzählen hat, wischt sich Kari Kenel, wie der Immergrüne unten in der Küche den Bierschaum, die Tränen mit dem Handrücken aus dem Gesicht. Wortlos verlässt er das Grünezimmer, schlurft die knarrende Treppe hinunter, wo er dem Immergrünen auf halber Höhe begegnet. Daskind auf dem Stuhl rührt sich nicht. Du hast mir Schande gemacht, hatte der Mann gemurmelt, bevor er das Zimmer verließ. Daskind wusste nichts von Schande, stumm hatte es die Schläge erlitten, nach keinem Grund gesucht. Seine Welt steckte voller Unbegreiflichkeiten, nach Erklärungen zu suchen war müßig, wenn eine strafende Hand die andere ablöste. Eine kalte Brise erfasst es. Daskind versucht, vom Kummer zu leben. Es wird gut daran tun, sich darin einzurichten, weiß Daskind. Das Leben ist eine nie heilende Wunde, die man sich selbst zugefügt hat.
Nach Kari Kenel versuchten die beiden Nonnen, dem Kind die Namen von Blumen, Vögeln oder süßen Speisen zu entlocken. Daskind blieb stumm, so sehr sie sich bemühten. Selbst Schwester Guido Marias sanfte Art, dem Kind das Sprechen beizubringen, blieb vergeblich.
Man hätte den Balg lassen sollen, wo er war, hieß es im Dorf. Daskind sei hier unglücklich, meinten einige freundlicher Gesinnte. Aber schon bald nahm man das stumme Kind hin, wie man ein Unwetter, eine kurze Unpässlichkeit hinnahm oder streunende Katzen, die man nur des Spaßes wegen, sie wegrennen zu sehen, mit Steinen vom Hof verjagt. Wenn selbst die Seelenärzte nicht helfen konnten, waren andere Mächte im Spiel. Dem Teufel ab dem Karren, man hatte es immer gewusst. Daskind hörte die Hinundherworte, die kleinen Wortbomben. Es lernte, nicht zusammenzuzucken, wenn sich die Dörfler bei seinem Anblick bekreuzigten. Wenn es von andern Kindern durch die Dorfstraße gejagt wurde, flüchtete sich Daskind in die Leere, die sein Gehirn jederzeit erzeugen konnte. Wenn Bannflüche nichts nutzten und die Wirklichkeiten durcheinandergerieten, hatte Daskind keine Gewalt über die Hände, die nach dem Tod griffen.
Keller wollte Daskind wie eine Laus zertreten. Schon immer. Seit dem Tag, als Daskind ins Haus geholt wurde. Alle hatten sie eine Strafe für Daskind, das fremde. Auch der Sigrist und Derpensionist, die Freudenstau, die auch. Und die Kinder, die es von ihren Eltern lernten. Daskind fühlte sich in der Falle. Später, dachte es, würde möglicherweise vieles anders, auch Daskind konnte gerettet werden, versprach Daskind dem Kind, es solle sich den Tod zum Sklaven machen. Aber solchen Befehlen ist schwer nachzukommen. Daskind weiß noch nichts von der Geduld des Wartens. Kennt den verkapselten Zorn zu wenig, noch trägt der Hass kein bestimmtes Gesicht. Das wird sich ändern, sagt es dem Kind ins Ohr, und dass der Hass ein strahlender Stern sei, ein schwarzes Licht hinter der Angst, die es quält.
10
Das Herz des Wals wiegt 500 Kilo, sagt Kari Kenel zum Kind. Der Wal liegt auf einem langen, mit Planen ausgekleideten Eisenbahnwagen. Wäre das aufgerissene Maul nicht, das von Eisenstäben gestützt wird, könnte man meinen, das Tier schliefe. Wie ein riesiger, schwarz geteerter Neger, lacht der Gemeindepräsident, dem das Dorf dieses Ereignis zu verdanken hat. Sein Arm verschwindet im aufgerissenen Rachen. Die Kinder an den Händen ihrer Mütter sind ängstlich. Wissen nicht, ob sich das riesige Tier nicht doch plötzlich bewegt, aufersteht vom Tod, der ihm von Männern mit großen Harpunen zugefügt wurde. Tapfer schreien sie im Chor nach Mister Haroy, es hallt durch den Bahnhof, als würde eine Horde Wilder den Geist des toten Tiers beschwören. Daskind schreit nicht mit. Wagt sich näher an den Leib, will dem Tier in die Augen schauen. In den Augen des Wals muss seine Heimat zu sehen sein, meint Daskind, eine Landschaft aus Farben und Licht, mit geheimnisvollen Höhlen, von regenbogenfarbenem Licht durchflutete, moosüberwachsene Korridore, durch die ein Schwarm schwereloser, friedlicher Tiere dahingleitet, ein ruheloses, einander umwerbendes Gedränge aus kühlen, wendigen Leibern. Aber in den Augen des Wals ist die Heimat nicht abzulesen, die Daskind meint. In den Augen des Wals sieht es die Augen seiner Widersacher, und in deren Augen wiederum die Augen der Widersacher hinter diesen Widersachern, Jahrmillionen zurück, und immer der lachende Töter hinter dem lachenden Töter hinter dem Töter. Ein Schachteltraum bindet Daskind an den toten Wal. In diesem Traum sind sie beide Gejagte, Daskind findet sein Entsetzen in den Augen des Wals wieder, seine Angst und den hilflosen Zorn, der jedem Töter entgegenbrandet und doch, kurz vorm Zuschlagen, ungenutzt verebbt.
Daskind und der Wal sind eine Insel inmitten des Lachens und Schreiens. Die andern hauen dem Tier kameradschaftlich auf die präparierte Haut, stellen sich neben den Wal, ihn mit der einen Hand berührend, die andere in der Hüfte, als ob sie die Sieger wären. Tun, als hätten sie das Tier erlegt, jeder den andern in der Haltung übertrumpfend. Tun, als bedrohe sie das Tier noch immer, besonders die Kinder, die in gespielter Angst zurücktreten, wieder vorpreschen, Mister Haroy skandierend um den Wagen tanzen, bis sie vom wütenden Gellen der Eltern zurückgerufen werden, sich anständig aufzuführen, das sei ein feierlicher Augenblick. Aber die Kinder lassen sich nicht zähmen. Sie beschießen den Kadaver mit unsichtbaren Harpunen, können ihre Lust am eingebildeten Töten kaum unterdrücken.
Bis der Gemeindepräsident in die Hände klatscht, weil er eine Ansprache halten will. Er wirft sich in die Brust, wartet, bis auch das übermütigste Kind an der Hand der Mutter den Mund hält, breitet die Arme aus. Als Dank für das Vertrauen der Gemeinde, der er seine Wahl verdanke, habe er diesen Anlass ermöglicht. Es sei ein hartes Stück Arbeit gewesen, die Veranstalter zu überreden, einen kurzen Halt in ihrem Dorf einzuschalten. Die Reiseetappen des toten Wals seien von langer Hand vorbereitet gewesen, aber er habe doch den Wunsch gehabt, der Dorfjugend diesen einmaligen Anblick eines Riesenwals von sage und schreibe – er wiederholt ‹sage und schreibe› noch mehrere Male – 23 Metern Länge zu bieten. Man sei der Jugend etwas schuldig, wolle man sich ihrer als künftiger treuer Bürger vergewissern. Natürlich habe er eine bestimmte Summe aus der Gemeindekasse erbitten müssen, einen nicht unbedeutenden Anteil habe noch Moritz Schirmer beigesteuert, man solle ihn hochleben lassen. Sogleich brechen die Kinder in ein ohrenbetäubendes Gebrüll aus, das mehrstimmige Hurra und Bravo wird von den Wänden zurückgeworfen, bis der Gemeindepräsident erneut in die Hände klatscht. Man solle nun auch der tapferen Männer gedenken, die diesen riesigen Wal erlegt und im Kampf mit dem Tier auf hoher See ihr Leben riskiert hätten. Der Wal wiege lebend ganze 55 Tonnen, 55 Tonnen geballter Kraft, der die mutigen Männer mit nichts als ihren Harpunen entgegengetreten seien. Aber der Mensch habe vom Herrgott auch einen Verstand mitbekommen, der mache wett, was ihm an Kraft fehle, um solch ein Untier zu erledigen. Schon wieder brandet der Beifall durch den Bahnhof, den nicht anwesenden Helden zu Ehren und dem Verstand, den sie alle vom Schöpfer erhalten haben. Die Ehrung will kein Ende nehmen, schulterklopfend feiert der Mut seine Stunde, die sonst verschlossenen Gesichter leuchten dem Redner entgegen, der sich zufrieden die Hände reibt.
Daskind lässt die Hurrarufe, das Gejohle und Gestampfe hinter sich, hat sich an den Schulter an Schulter stehenden Dörflern vorbeigezwängt und den Bahnhof verlassen. Das Dorf war menschenleer. Unschlüssig blieb Daskind stehen, wusste nicht recht, welchen Weg es nehmen sollte. Im Chalet Idaho, wusste Daskind, wütete Frieda Kenel mit ihren Pfannen, die Einzige, die sich nicht zu der um den Wal versammelten Menge gesellt hatte.
Das Chalet gehörte zu den besonderen Gefahrenzonen innerhalb der großen Gefahrenzone, in der Daskind lebte. Auch dann, wenn nur Frieda Kenel anzutreffen war. Die Pflegemutter. Ein langes Wort, denkt das mutterlose Kind, dem die vier Silben höhnisch durch den Kopf rollen, wie Marmeln in die falsche Richtung. Sind nicht aufzuhalten, die Silben im Kopf.
Daskind ist sich selbst ein vielfaches Wesen: Seiltänzerin, Menschenfresser, Rübezahl, Schneewittchen, Rosenrot und mehr. Der Trauer ist nicht standzuhalten, wenn dem Kind die Welt eindringt, die es nicht begreift. Dringt das Gift durch die Poren, durch alle Körperöffnungen, breitet sich fremde Welt aus im Kind, spürt sich Daskind zerfranst.
Über dem Kind kreist ein Mäusebussard. Ein Krähenschwarm versucht, ihn mit schrillem Gezeter abzudrängen. Die Straße zieht eine schnurgerade Linie durch die Landschaft, sie endet am Horizont. Durch die dünnen Schuhsohlen ist die Wärme des Asphalts zu spüren. Teergeruch vermischt sich mit dem Duft der blühenden Magerwiesen, die sich zu beiden Seiten der Landstraße ausbreiten. Gedankenlos kaut Daskind an einer Margeritenblüte, der säuerliche Geschmack überzieht den Gaumen mit luftiger Haut.
Lange wandert Daskind auf der Straße. Nun hat es den östlichsten Rand der Harch erreicht. Hinter dem letzten Dorf sind links der Straße die Kiesgruben am Hang zu sehen. Graue, ausgeschabte Wunden, um einen schrundigen Krater verteilt, der mit milchig schimmerndem Wasser gefüllt ist. Auf der Wasseroberfläche schwimmt Abfall. Eine tote Ratte streckt ihren aufgedunsenen Bauch in den Himmel. Über den beiden Gruben erstreckt sich ein langer Hügelkamm, der fast zur Gänze für den Kiesabbau freigegeben wurde. Baumstümpfe ragen in die Höhe, die gefällten Stämme haben eine tiefe Schleifspur in den Hang bis hinunter zur Straße gefressen.
Daskind sitzt am Kraterrand, die Füße baumeln über dem Wasser. Es könnte sich fallen lassen, denkt es, das Wasser würde in die Lungen eindringen, ihm den Atem nehmen. Es hat gehört, dass man beim Ertrinken als letztes Musik hört. Da es an Musikerinnerungen keine große Auswahl hat – außer Pflegemutters Fernimsüd vielleicht noch ein paar Kindermelodien, Zählreime und Spottlieder –, ist das keine Verlockung.
Träge schwimmt die Rattenleiche auf dem Wasser. Daskind angelt mit einem Stock nach ihr, erzeugt immer größer werdende Kreise um den Kadaver. Es schlägt nach ihm, erst gleichgültig, ungenau, dann bricht plötzlich die Wut durch. Daskind zerpflügt mit seinem Stock das Wasser. Die Ratte wird lebendig, schnappt mit ihren spitzen Zähnen nach den Füßen des Kindes, reißt ihren Raubtierrachen auf. Sieben Feuerzungen greifen nach dem Kind. Aus den Vorderbeinen werden grüne Drachenflügel, dann wächst dem Tier Kopf um Kopf aus dem Rumpf, erst sind es nur große Beulen, die platzen, ledrige Köpfe freilegen, die sofort ihre Mäuler mit den sieben Feuerzungen aufreißen, auf Daskind starren, das ums Leben kämpft. Schwerfällig erhebt sich der Drache aus dem Wasser, zieht einen engen Kreis über dem Krater. Daskind kann seinen fauligen Atem riechen, und den ledrigen Geruch seiner schuppigen Haut. Der lange Drachenschwanz peitscht die Wassermasse, die jetzt über den Kraterrand schwappt, mit einer gefräßigen Wellenbewegung Daskind erfasst, über ihm zusammenbricht, es in den Abgrund reißt. Da will Daskind schreien, aber seine Stimme gehorcht ihm nicht, es bleibt stumm. Verzweifelt greift es nach dem Drachenschwanz, zieht sich daran hoch, kriecht über den schartigen Kamm des Schwanzes zum Rücken, hält den Hals des Drachen umklammert. Der schwingt sich mit dem Kind auf dem Rücken hoch in die Luft, die von Fabelwesen erfüllt ist. Ihr Kreisen erzeugt ein melodiöses Sirren, dass im Kind die Wut abstirbt wie ein dürrer Ast an einem noch gesunden Baum. Lächelt Daskind. Der Himmel ist ein blaues Land, grenzenlos, Daskind kann endlich atmen.
Höher und höher steigt der Drache, Daskind schwimmt jetzt im gleißenden Licht der Sonne, fühlt sich in der Hitze gut aufgehoben. Bis sich ein schwarzer Schatten vor die Sonne schiebt. Da fürchtet es sich einen Augenblick lang, denn es hat gelernt, dass Überraschungen meist aus dem Hinterhalt kommen, zuschlagen, ehe man sich’s versieht. Doch dieser Schatten ist freundlich, ist der Wal, der sich in einem weiten, fröhlichen Bogen in die Höhe katapultiert, dann in einer eleganten Abwärtsbewegung am Rand des Horizonts verschwindet. Daskind auf dem Rücken des Drachen kann den orgelnden Lockruf des Wals hören, kann an diesem Samstagnachmittag die Sprache der Wale verstehen. An diesem Tag geht Daskind nicht unter. Ein Wal und ein Drache haben dem Kind den Tag gerettet.
Die rechte Straßenseite säumt Schirmers fruchtbarer Obstgarten. Hier reifen der Reihe nach Kirschen, Zwetschgen, Äpfel, Birnen und Nüsse, die Schirmer im eigenen Boot über den See in die benachbarte Kleinstadt bringt. Wenn die Früchte reif sind, achtet der Bauer darauf, dass sich kein Kind an einer Frucht vergreift. Dabei hilft ihm Zorro, der schwarze Dobermann mit den blutunterlaufenen Augen. Wenn der durch den Obstgarten jagt, wenn sich dem Hund das Fell über dem Rücken sträubt und er mordlustig die Zähne fletscht, hechten die Kinder über den Zaun, bleiben keuchend einen Augenblick stehen, ehe sie die Straße entlang zurückrennen.
Bauer Schirmer hat noch einen zweiten Verbündeten. Einen Stier, den er manchmal, nur so zum Spaß, mit einem Gewehrschuss über die Weiden hetzt, damit die Kinder vor Schreck erbleichen. Sein Gesicht glänzt vor schwarzer Freude, wenn eines der Kinder am Drahtzaun hängen bleibt und nur in allerletzter Minute die schützende Seite erreicht. Besonders, seit sein Sohn unter der Erde liegt. Das hat der Schirmer nie verwinden können. Hat lange mit Gott gehadert, die Schuld dem Mädchen gegeben, der Anni Bamert, dem sündigen Fleisch.
Weil Moritz Schirmer die umliegenden Kirchen mit großzügigen Legaten versorgt, übersieht man seine Bosheit. Und die Eltern wagen nicht, sich zu beschweren, einige von ihnen sind bei Schirmer hoch verschuldet. Unvorsichtig, sich mit dem Bauern anzulegen. Besser ist es, Schirmer noch beflissener, noch unterwürfiger zu grüßen.
An Schirmers stattlichen Besitz grenzt die gemeindeeigene Allmend mit der Kromenkapelle, die 1693 von Landammann Johann Krieg als Dank für die Bewahrung vor Raubüberfällen errichtet worden und der Heiligen Muttergottes von Loreto geweiht ist. Das Innere der Kapelle ist eine Nachbildung des heiligen Hauses von Nazareth, der Santa Casa, die nach der Legende Engel nach Loreto getragen haben. Über dem Engelsfenster, durch das der Engel Gabriel bei der Verkündigung eintrat, hatte sich ein Bienenschwarm niedergelassen und bildete eine schützende, dunkle Traube um die unsichtbare Königin. Das geschäftige Summen der Bienen erfüllte den rechteckigen Raum, als das Kind eintrat. Und im Summen der Bienen vermeinte es noch etwas von der Weite zu spüren, in die es mit dem Drachen aus dem Traum eingetaucht war wie in ein unverständliches Glück.
Stufen und Gitterschranke trennen den Raum mit dem Tonnengewölbe in das westliche Schiff mit dem Altar und den östlichen Chor, der ursprünglich im Hause von Nazareth die Küche mit einer Kaminnische, dem Santo Camino, bildete. Über der Nische ist die heilige Mutter mit dem Kind zu sehen, beide in kostbare, bestickte Gewänder gekleidet, einander liebevoll haltend. Ihre Gesichter und Gliedmaßen sind schwarz wie mattes Ebenholz, Mutter und Sohn lächeln sich zu.
Daskind setzt sich auf die Stufen. Die Arme um beide Beine geschlungen, kauert es lange vor dem Bild aus einer Welt, die ihm verschlossen bleibt. Warum nur ist so viel traurige Gewissheit im Kind? In einem Alter, das ein bunter Rausch sein könnte. Und da ist er wieder, der Zorn, der sich aus seinem Innern nach außen frisst, ein Ungeheuer, die Nachtseite des Drachen. Kann Daskind nicht an sich halten, muss Luft in die Lungen pumpen und schreien. Schreit den Zorn ins Gesicht von Mutter und Kind, schreit sich die geschundene Seele aus dem Leib. Bis es widerhallt von den Wänden, zu einem einzigen, schwarzen Schrei wird, während Daskind tanzt und stampfend den geheiligten Boden bearbeitet. Das will es nicht sehen, Daskind, diese Liebe im Gesicht der Mutter und die Liebe in den Augen des Kindes, das nicht. Bricht Hass aus im Kind ob der Liebe, die es sieht. An der es nicht teilhaben kann. Ist krank, Daskind, vor Lieblosigkeit krank. Winterkind.
Dann wieder Stille. So viel Kraft ist nicht im Kind, um all das Klagen, das Entbehren, das Nichtverstehen mit einer schützenden Haut aus Hass zu überziehen. Gehen die Schreie des Kindes in ein Wimmern über, in ein Katzengewimmer, das nicht mehr aufhören will. Sein Körper möchte sich teilen, auseinanderbrechen, den Zorn freigeben, diesen Klotz in der Mitte, an dem es erstickt. Doch es bricht nicht auseinander, noch nicht, im Gegenteil, der hässliche Klotz wird schwerer und schwerer, auch wenn sich Daskind kaum weiterschleppen kann unter seinem Gewicht. Der unsichtbare Buckel des Kindes, das kein Kind sein darf. Das nur eine Traumstunde lang den Drachen ritt.
Kindern, die nachts weinen und schreien, legen die Mütter in der Harch den «Schlaf» unters Kissen. Sie finden den Auswuchs der Rosengallwespe in den Hundsrosensträuchern. Soll der «Schlaf» seine Kraft behalten, darf er nicht berührt oder übers Wasser getragen werden. Wenn das Mondlicht in die Kinderstube fällt oder das Hemd des Kindes dem Mondlicht ausgesetzt ist, dann ist das Nachtweinen, so nennen sie es, unvermeidlich. Oder wenn sie beim Eintreten zuerst das Kind betrachten statt andere Dinge. Wenn der «Schlaf» seine Kraft verliert, gibt man den Nachtweinenden Bockshornsaft, oder man legt ihnen betäubenden Nachtschatten, wilden Hopfen und Spreu aus dem Schweinestall in die kleinen Betten. Einige beräuchern das Kind mit brennendem Zaunmoos, oder sie geben ihnen getrockneten Hühnerkot in die Milch. Das Moos vom Dach eines Kuhstalles dient zum Beräuchern nachtweinender Mädchen, das Moos vom Dach eines Ochsenstalles zum Beräuchern der Knaben. Oder man trägt die nachtweinenden Kinder in den Stall und legt sie auf das noch warme Lager eines Tieres. Wenn ein Kind das Nachtweinen hat, so soll die Mutter abends beim Gebetsläuten Hafer in ihre Schürze geben, darüber das Kind halten und dreimal sprechen: «Du Nachtmutter, gib deinem Ross ein Futter, dass dein Kind schreit und meines schweigt.» Drei Steinchen, während des Läutens unter der Dachtraufe aufgehoben und – ohne sich umzusehen – unter das Kissen des Kindchens gelegt, sollen auch helfen. Manche Mütter legen das weinende Kind auf ein Fell über der Türschwelle, schreiten dreimal darüber und sprechen dabei die Worte: «Welche dich geboren, die hat dich auch befreit.» Damit der Bann hilft, dürfen aber die Mütter nach Sonnenuntergang nichts mehr ausleihen. Wenn sie es nicht vermeiden können, muss es sich der Leihende gefallen lassen, dass ihm ein Stück von seinem Hemd abgerissen und dem Kind unter die Matratze gelegt wird. Manche Frauen waschen sich bei Sonnenaufgang die Brüste mit Weihwasser und lassen die Kinder nachts an den geweihten Brüsten einschlafen.
Dem Kind hilft keine Mutter. Wenn ein Kind wie Daskind nachts weint, hängt höchstens ein gleichgültiger Mond am Himmel, vielleicht schreit ein Kauz. Oder ein Hase hoppelt erschrocken ins Gebüsch. Wie jetzt, am östlichen Ende der Harch, als das Kind endlich die Kromenkapelle verlässt und nichts mehr anzufangen weiß mit den Sekunden.