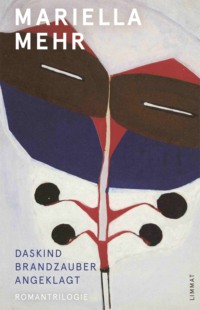Kitabı oku: «Daskind - Brandzauber - Angeklagt», sayfa 4
7
Als die Pfarrkirche aus Anlass der Restaurierung auch einen restaurierten Schutzheiligen bekam, der heller glänzte als der alte und, so schien es jedenfalls den Betrachtern, Beelzebub noch mutiger bekämpfte, organisierte das Dorf ein Fest. Von überall her kam das Volk, Gläubige und Ungläubige, um den heiligen Michael bei Gebeten, Bier und Würsten zu feiern. Kräftige Männer trugen den Bannerträger Gottes auf einer Lade durch die Straßen, hell glänzte das aufgefrischte Gold auf den weit ausladenden Flügeln des Erzengels, auf dem heiligen Schwert Gottes brach sich das Licht der Frühsommersonne und löste sich in eine Vielzahl tanzender Farbpartikelchen auf. Das Schwert selbst schien zu tanzen, schien tänzelnd seinen Weg zu suchen, hinab in die Eingeweide Luzifers, des von Gott Abgefallenen, der sich, künstlich mit Grünspan überzogen, gar jämmerlich verteidigte und vergeblich das Maul aufriss, um den obersten Himmelsstreiter zu verschlingen. Das Volk jubelte seinem Schutzpatron zu, Schulkinder streuten Wiesenblumen: Margeriten, Wegwarte, Johanniskraut und Ringelblumen.
Nach einem feierlichen Hochamt und der offiziellen Einweihung der Kirche durch den Bischof ging man zu den weltlichen Freuden über. Vom Dröhnen der Michaelsglocke begleitet, machte sich das Volk über die Tische her, besetzte die Holzbänke und Stühle, die den Kirchplatz füllten. Bald ging das verordnete fromme Jubilate in ein bierseliges Lachen und Johlen über. Die Härchler nutzten jede Gelegenheit, um sich ausgiebig zu betrinken. Während der Fastnachtszeit gab es keine Wirtschaft in der Harch, die nicht von Schlägereien und Randalen zu berichten wusste. Hinter Masken und Hexenfratzen tobten sich Genusssucht und Streitlust aus. Man hieb mit Säublattern aufeinander ein, schlug sich mit hölzernen, dem Morgenstern ähnlichen Knüppeln die Schädel blutig. Vor allem aber soff einer den anderen unter den Tisch, um hinterher, grölend und torkelnd, irgendein Hundsloch aufzusuchen, wo sich der gewaltige Fastnachtsrausch ausschlafen ließ. In der Harch war die Fastnacht Männersache, ein archaischer Trieb schletzte die Männer in Horden durch die Straßen und Kneipen, bis nichts mehr ganz blieb. Das bekamen auch die Frauen zu spüren, wenn sie sich, angeekelt vom wilden Treiben, nicht hingeben wollten. Da wurde nicht lange gefackelt, die Frau mit Gewalt aufs Kreuz gelegt und grob genommen. An der Fastnacht lernten sie die Männer erst richtig kennen, die fremden und die eigenen, denn beim Kopulieren war man nicht wählerisch, auch des Nächsten Weib genoss an diesen Tagen keine Schonzeit. Es schwängerte der Nachbar des Nachbarn Weib ebenso, wie er sich an der eigenen Frau, den Mägden oder an halbwüchsigen Mädchen verging. Hinter den holzgeschnitzten Masken hoben sich die Gesetze auf, der Alkohol riss alle Dämme nieder. Da nützte keine Predigt, kein gut gemeinter Aufruf der Gemeindebehörden, Fastnacht ist Fastnacht, dachten sich die Härchler, man könne danach noch immer die Scherben wegkehren.
Auch die Kinder wurden von dem groben Treiben nicht verschont. Durch ihre Träume geisterten noch lange, nachdem die Fastnacht von der Fastenzeit abgelöst worden war und das Dorf der Erlösung durch den Auferstandenen entgegenharrte, Hexen, Gnome und Trolle.
Das Einweihungsfest gelangte erst zur vollen Reife, nachdem der Bischof, den Dorfpfarrer im Schlepptau, seine Kinder im Herrn verließ. Dabei tat sich der Gräbertoni besonders hervor. Mit wuchtigen Faustschlägen auf die Tischplatte begleitete er seine obszönen Lieder, bis Jakob Gingg dem Treiben Einhalt gebot. Das hätte er lieber nicht tun sollen, der Sigrist, das nicht, denn einem besoffenen Gräbertoni, nüchtern eine Seele von Mensch, ist in diesem Zustand nicht beizukommen. Mit der bedächtigen Langsamkeit eines Ochsen glotzt der dem Freund ins Gesicht. Von tiefer Empörung durchdrungen, stemmt der Totengräber seinen massigen Körper aus der Bank, pflanzt sich vor dem Sigristen auf. Rasch will Gingg beschwichtigen, streckt die Hand nach der Schulter des Freundes aus, um ihn zu beruhigen. Zu spät. Toni, im Suff die Geste des andern falsch einschätzend, sie als Angriff taxierend, holt aus, platziert einen rechten Schwinger auf dem Kinn des Unglücklichen, dass es kracht. Als fege ein Sturm durch lotteriges Gebälk, knirschen dem Taumelnden die Knochen unter der geplatzten Haut, bricht die Architektur des Gesichts ein, ehe Jakob Gingg in die Knie geht, lang hinfällt und den Geist vorübergehend seinem Gott empfiehlt.
Einen kurzen Augenblick lang hält der Schreck die Feiernden im Griff, vom Saufen trüb gewordene Augen glotzen den Gräbertoni an. Verloren hängen die Grabschauflerhände am Tonikörper, als wüsste der gute Toni nicht, wie ihm geschehen ist. Schwer lastet die Mittagsstille über der Versammlung. Bis ein Grollen die Luft zerreißt und die Festgemeinde von der Spannung befreit. Es ist Gotthold Schätti, der eine Schlägerei auslöst, die in der Kirchengeschichte ihresgleichen sucht. Durch den jämmerlichen Anblick Jakob Ginggs geradezu zur Rache verpflichtet, schlägt er seinerseits den Ochsner Toni nieder, bis, angestachelt vom fließenden Blut, des Schulwarts Fäuste auf den Bedauernswerten niederprasseln. Von da an gehorcht die Prügelei ihren eigenen Gesetzen. Während die Frauen kreischend das Weite suchen, fällt Mann über Mann her, sogar der Ordnungshüter schlägt drein, was das Zeug hält. Ein Durcheinander von schwitzenden, nach Kuhdung, Brissago, Stumpen und Schweinestall stinkenden Körpern ergießt sich über den Kirchplatz, Stöhnen, Flüche und Schmerzensschreie wetteifern mit dem plötzlich einsetzenden Dröhnen aller drei Kirchenglocken. Ihren Einsatz verdankten die Glocken dem Sigristen Gingg, der sich aufgerappelt hatte und schmerzgepeinigt die Empore erklomm. Von heiligem Zorn beflügelt hängte er sich in die Seile, bis die Glockenklänge mächtig über den Kirchplatz schallten.
Da endlich besinnen sich Herren und Knechte. Benommen weicht einer des andern Blick aus, stumm gehen sie auseinander, um sich daheim die blutenden Wunden vom angetrauten Weib verbinden zu lassen.
Die unfromme Prügelei hatte ein Nachspiel. Ortsfremde Polizisten, im Dorf immer ungern gesehen, knöpften sich noch am selben Tag Mann um Mann vor, die jedoch einmütig schwiegen. Nur den Toni, von Reue gequält, trieb es unaufgefordert vor den Kadi, er wollte sein Gewissen erleichtern. Er habe doch dem Sigristen Gingg, der sein zuverlässiger Partner sei, zumindest, was Begräbnisse betreffe, nichts anhaben wollen, er wisse selbst nicht, was über ihn gekommen, welcher Teufel in seine Fäuste gefahren sei.
Nach einem kurzen Aufenthalt im Bezirksgefängnis und einer im Spital zelebrierten Versöhnung blieb Toni nur noch, auch die Strafe der Kirche zu tragen. Pfarrer Knobel verdonnerte den Reuigen zu zwanzig Rosenkränzen, die jedoch nicht etwa vor der Mutter Gottes in der Pfarrkirche zu beten seien, sondern im Beinhaus, wo es Toni nun gar nicht hinzog.
Das Beinhaus klebte wie ein lästiges Insekt an der Rückseite der Pfarrkirche. Über dem reich verzierten, verfallenen Portal drohte ein furchterregendes Jüngstes Gericht dem verstockten Sünder mit ewigen Höllenqualen. Mit einem furchtbaren Richterauge, das andere hatte die Zeit zerstört, schickte der Allmächtige die Verdammten in die Flammen zurück, denen sie verzweifelt zu entkommen suchten. Erbarmungswürdig ihr Flehen, ihre zum Himmel gereckten Hände, ihre nackten, geschundenen Körper, ihre von Angst und Grauen zerfressenen Gesichter.
Den Verdammten gegenüber mit leuchtenden, einfältigen Gesichtern die Seligen. Von übergewichtigen Engeln begleitet, strebten sie dem Himmel zu, einem einst azurblauen, doch vom Zahn der Zeit ins Schmutziggraue geschliffenen Vakuum, das den wallenden Bart und das strähnige Haupthaar Gottvaters wie eine Aura umgab. Gottvaters unversöhnlichem Blick auf die Verdammten dieser Erde ungeachtet, brachten die seligen Frauen ihre schwellenden Brüste, ihre unverhüllte Wollust, ihr Begehren dem einen himmlischen Bräutigam dar. Ihre Jungfrauengesichter ließen noch immer das Karminrot erahnen, mit dem der Künstler ihre Wangen bemalt hatte. Und wie zum Hohn war die Farbe ihrer luftigen Bekleidung, die sie als Lohn für ihre frommen Bemühungen, im Gegensatz zu den Unglücklichen am andern Bildrand, tragen durften, abgeblättert, sodass sie nackter schienen als die zur Nacktheit verdammten Höllenbewohner.
Der Boden des überwölbten Innenraums bestand aus grob behauenen Kalksteinquadern. Ein schwerer Eisenring war in eine der Platten eingelassen, sodass man sie mit etwas Anstrengung heben und zur Seite schieben konnte. Eine Holzleiter erleichterte den Abstieg in den Totenkerker, den jedoch Toni, eine Taschenlampe zwischen den Zähnen, jeweils mit einem gewagten Sprung in die Dunkelheit hinter sich brachte. Je mehr Mut man zeige, meinte er, umso weniger könnten die da unten einem etwas anhaben. Dort lagen sie, die Gebeine der Toten, von Toni aus ihren Gräbern geschaufelt, nun säuberlich zu Knochenbündeln verschnürt. Weiß wie die Seelen der Seligen blinkten sie dem Betrachter entgegen, geheimnisvoll verwiesen sie auf die Vergänglichkeit aller Gelüste nach Ruhm und Bestand. Der Ort war ungeeignet, Lebensfreude zu verbreiten. Trotzdem zog es die Nachkommen der Verblichenen immer wieder hierher, um ihrer Toten zu gedenken, sie gnädig zu stimmen, auf dass sie nicht als Wiedergänger die Lebenden heimsuchten. Toni verfluchte den Pfarrer und seine Vorliebe für makabre Bußhandlungen, die ihn zwang, im Beinhaus zwanzig Rosenkränze zu beten. Wieder nüchtern, schien es ihm, dass ein Gott so viel Rache nicht ersinnen könne, der gleichzeitig als der Allgütige angebetet und verehrt werden wollte. Die schwarzen Holzperlen des Rosenkranzes durch die schwieligen Hände gleiten lassend, streifte ihn trotz allem ein Hauch jener Kälte, die Gottes Rache, laut Pfarrer Knobel, unmissverständlich ankündige. Man war ja nicht unempfindlich für die düsteren Geheimnisse der Heimsuchungen, die Gott auch für einen wie Toni bereithielt, sollte er nicht gehorchen. Also ergab sich der Totengräber ins Schicksal und leierte eifrig die Rosenkränze herunter.
8
Sorgfältig schiebt Daskind die Vorhaut des Penis nach hinten. Eine winzige rosarote Eichel wird sichtbar. Schiebt mehrmals, dass es den Buben schmerzt. Ist der Wille zur Tat ein Fest, jubelt Daskind, das sich, den Buben mit sich zerrend, am frühen Morgen ins Beinhaus geschlichen, den schweren Riegel vorgeschoben hat, damit keiner es störe. Musste die wild wedelnden Bubenhände außer Gefecht setzen, sie mit einer mitgebrachten Packschnur an den eisernen Ring fesseln. Hat dann den Buben, der anfänglich an ein freudiges Abenteuer glaubte, mit einem soliden Stück Holz geknebelt, das Holz in den Bubenmund gestopft und Kari Kenels Taschentuch um den Bubenkopf gebunden. Am Hinterkopf fest verknotet. Die Beine des Buben zucken hilflos unterm Gewicht des Kindes, das sich rittlings auf sein Opfer gesetzt hat. Daskind jetzt kaltblütig. Hat die Bubenhose bis zu den Knien heruntergezerrt, mit den Hosenträgern dem Buben die Beine gefesselt. Hilflos regt sich das kleine Ding, gleitet, sich langsam aufbäumend, der Kerbe zwischen Rumpf und Schenkel entlang über den Bauch, markiert wandernd ein Halbrund in die Luft. Schnellt dann zuckend in die Höhe, ragt auf, ein kleiner Pfahl am Leib des Buben, der sich nicht wehrt. Nicht wehren kann. Gefesselt Gewalt erleiden muss. Mit aufgerissenen Augen Daskind anstarrt.
Ist zu allem entschlossen, Daskind. Hat eine Rechnung zu begleichen. Vorige Woche sind sie zu dritt übers Kind hergefallen, drüben, in Schättis Stall. Unter der Anleitung des Pensionisten. Haben gewissenhaft zugehört, die drei Buben, haben Daskind mit Knebeln in den Bubenfäusten geschändet, wie er es gemacht haben wollte, Derpensionist. Um euch an die Mannesfreuden zu gewöhnen. Um zu lernen, wie man sich holt, was einem zusteht. Schoss ihnen das Blut in die wachsenden Schwänze. Auch dem Ambachbuben. Ihr kleinen Dreckfinken, drohte lachend Derpensionist, dass ihr mir eure ungewaschenen Mäuler haltet. Sonst fault euch euer Allerliebstes ab, ihr Stinkwichser. Die Buben, in die Welt der Erwachsenen geschleudert, klopften sich stolz auf die schmächtigen Schenkel. Daskind betrachtet angewidert die Hand, die vorher die Vorhaut über die rosige Peniskuppe nach hinten stülpte, sie einen Augenblick festhielt, sie wieder vorrobben ließ. Allein mit sich und dem Angstgeruch des Opfers. Im vorher müde zerschrieenen Zorn ist etwas Unerbittliches. Etwas Kaltes. Ein eisiger Wind.
Daskind holt aus, lässt die kurze, aus Spülketten gebastelte Peitsche durch die Luft sausen. Hält über dem Buben inne. Entblößt die Zähne, lacht. Holt wieder aus, testet die Kraft im Arm, zieht ihn zurück, holt umso grausamer wieder aus. Aber nur zum vermeintlichen Schlag. Probeweise, aus Spaß an der Angst des Buben. Schlägt endlich zu.
Auf dem weißen Bubenbauch entsteht ein rotes Muster. Die ovalen Kettenglieder reißen die Haut auf, lecken am Fleisch, streichen mit einem schleifenden Geräusch fast zärtlich über die Schenkel, über den winzigen, schlaffen Pfahl. Der Bub bettelt mit schlierigen Augen, mit Tieraugen, mit Wildaugen, Beuteaugen, Opferaugen um Gnade. Handaufsherzaugen, wenn du von mir lässt, geb ich dir drei Wünsche frei für dein Leben. Aber Jägerkind lässt nicht von ihm. Hat sich seit Langem vom Wünschen getrennt. Schlägt weiter zu. Mit dieser kalten Wut. Sucht mit der Wünschelrute nach dem Lebenssaft des Buben. Will Labung. Endlich. Und mehr.
Verkotet der Bub den Quaderstein über dem Totenkerker. Fließt über die Steine, der Kot, versickert in den Ritzen, grad so wie die Angst in den Ritzen der Ohnmacht. Aber das kann ein Jägerkind nicht aufhalten, nicht die Hand mit der Kettenpeitsche. Hält des Kindes Peitsche schwarze Hochzeit mit dem roten, aufgerissenen Fleisch des Buben. Das Jägergesicht starr jetzt, und die Augen durchsichtig. Das verlotterte Gemüt im Ansturm auf den Haufen Not in seinen Fängen. Der bietet Daskind die Stirn, der Not, der will es die Stirn bieten, bis der Arm erlahmt, mit dem letzten Schlag.
Lässt den Haufen Not zurück, die um Gnade winselnden Augen. Zurück auf dem Kalksteinquader, der den Eintritt zur Schädelstätte versperrt. DasduduweißtschondasnächsteMalteilichdenTodaus im Blick. Hohnworte im Schritt, beim Hinausschleichen Hohnworte, die über den Buben herfallen, ihm die Ohren zerreißen, bis er nicht mehr unterscheiden kann zwischen Schrei und Schrei, dem stummen Schrei der Jägerin und dem eigenen, durch Tuch und Knebel gehemmten.
Versteckt Daskind die Peitsche unter dem Kleid, schleicht sich durchs Dorf, das die Jägerin wie immer aussperrt, es als ein Nichts dem Wertlosen zuteilt. Wertlos wie alle andern Kinder, die Daskind auch ist. Kind Ohnenamen. Wie verwilderte Katzen, rachitische Lämmer, streunende Hunde. Schleicht sich Daskind in die Kammer unterm Dach, von einer plötzlichen Verzweiflung erfasst, vergräbt Daskind den Kopf im Kissen, reibt sich am Bettzeug die blutigen Hände sauber.
Den Buben findet anderntags Jakob Gingg. Seine Wangen flecken fiebrig, als er den Haufen Not im Beinhaus entdeckt. Rasch entledigt er sich des Blumenstraußes, nimmt sich des gemarterten Buben an, streicht ihm mit vorsichtigen Händen tröstend übers Gesicht. Das hat er noch nie gesehen, der Jakob Gingg: ein Bub, an Händen und Füßen gefesselt, mit einem rohen Knebel im Mund und dem Taschentuch um den Kopf, blutverkrustet. Eilig löst der Sigrist die Fesseln, zieht dem Buben die Hose übers Gesäß. Trotz des Bluts. Muss den Ambach benachrichtigen. Der jetzt, bereits in der vierten Generation, den Hof der Mächlerin bewirtschaftet. Dem der Bub gehört. Der einen Tag und eine Nacht nach dem Buben gesucht hat. Der Bub liegt jetzt dem Sigristen im Arm. Einen Irrsinn in den Augen, der nie mehr verschwinden wird.
Bedächtig faltete der Sigrist das rot-weiß karierte Taschentuch zusammen und steckte es in die Jackentasche seines schwarzen Anzugs. Er wusste, aus welchem Haushalt der währschafte Stoff stammte, der den Buben am Schreien gehindert hatte.
Der Bub wird immer seltsamer, sagten später die Leute im Dorf, und dass man die Bestie finden werde, wenn nicht heute, dann morgen. Der entgehe der Gerechtigkeit nicht, der Unhold, der den jüngsten Ambachbuben so übel zugerichtet habe. Den werde man lehren, unschuldige Buben zugrunde zu richten. Der Sigrist wusste Bescheid. Doch er schwieg trotz der Gewissensqualen, die ihn zerfraßen. Die wollte er dem Kari später antun, diese Schmach, in aller Leute Mund zu sein. Dem Kari und der Frieda, den beiden Eisheiligen. Sind noch nicht genug geschlagen, mit dem stummen Kind. Haben ihn verdient, den Wechselbalg, den kein Gebet aus dem Weg schafft, keine fromme Inbrunst aus der Dorfgemeinschaft entfernt.
Fühlt sich zu Höherem berufen, Jakob Gingg. Weiß als Einziger um die Herkunft des Kindes. Will sich als rächender Arm Gottes, wenn die Zeit reif ist, des Kindes annehmen, mit dem das Dorf seine Not hat. Ein für alle Mal Ordnung schaffen. Fühlt einen kleinen Kitzel beim Gedanken an Kari Kenels Taschentuch. Dem wird er’s heimzahlen, dem Kari, mit dem Taschentuch winken, wenn die Zeit reif ist. Kann ein niederträchtiges Lächeln nicht unterdrücken. Hat alles Handeln seine Zeit. Hat den Irrsinn des Buben zum Verbündeten. Ambachs Jüngster, der seit jenem Tag nur noch lallen kann. Der immer seltsamer wird. Den die Angst im Würgegriff hält.
Dem Ambach traute bald keiner mehr über den Weg. Ein Zorn schien an ihm zu fressen, ein wildes Tier, das jeden anfallen konnte. Ambach verdächtigte alle im Dorf, sich an seinem Sohn vergangen zu haben. Sosehr ihn die Nachbarn zu beschwichtigen suchten, Ambachs Blick in ihre Gesichter, sein ohnmächtiger Zorn errichteten eine Mauer um den Unglücklichen, den man, den irren Sohn an der Hand, oft einsam über die Felder gehen sah. Das Mitleid wich bald unfreundlicheren Betrachtungen. Da die Suche nach dem Kinderschänder erfolglos blieb, musste eine böse Macht mit im Spiel sein. Mit langen Blicken betrachtete das Dorf den abgelegenen Hof, wo die Mächlerin noch immer ihr Unwesen zu treiben schien. Die musste es gewesen sein. Weshalb sonst wurden weder Dörfler noch Polizisten fündig. Der Hof hatte seinen schwarzen Geist zurück, fortan hatte man auf der Hut zu sein, hatte man genau hinzuschauen, wie’s dort oben zuging.
Im Herbst jenes Jahres wurde der Ambach das Vieh nicht los. Finster strichen die Bauern um seine kraftstrotzenden Kühe. Misstrauisch beäugten sie den prächtigen, schwarz glänzenden Stier. Solch gut genährtes, ungewöhnlich schönes Vieh konnte ebenso gut das Werk der Mächlerin sein wie der Frevel am Buben. Es war ratsam, sich dieses Vieh nicht in den Stall zu holen, wollte man die Mächlerin nicht noch mehr erzürnen. Das könne man sich nicht leisten, einen verfluchten Stall, man werde sich das Unglück nicht übermütig ins Haus holen, gleich welcher Tarnung es sich bediene. Man wisse zwar, dass der Ambach schwer am Schicksal trage, aber Vorsicht sei nun einmal geboten, wenn die Mächlerin die Hand im Spiel habe.
So trottete Ambach unverrichteter Dinge seinem verfluchten Hof zu, wo die Frau mit elenden Augen im Türrahmen stand. Sie hatte es immer gewusst, dass dem Hof über kurz oder lang kein Glück beschieden sein würde. Die Todsünde der Mächler Olga verlange eben ihren Preis. Vorerst wollte es die Bäuerin mit geweihten Kerzen versuchen, überall Kerzen hinstellen wollte sie, zu Ehren der Heiligen Mutter Gottes. Den Jüngsten an sich drückend, überschlug sie den Schaden. Es würde kaum fürs Nötigste reichen, rechnete sie, nicht fürs Vieh und nicht für die Kinder, man werde schauen müssen, wie der Winter zu überstehen sei.
Nachts nahm der Ambachbauer die Frau mit dem Glauben an die Mutter Maria. Verzweifelt robbte er in ihr weiches Fleisch, wollte nur eines, Schutz vor der Zeit, die sich gegen ihn verschworen hatte. An der Tür stand der Bub, gaffte durch den Spalt, sah mit verschreckten Augen, wie der Vater auf der Mutter lag und zu den heftigen Stößen in ein heiseres Schluchzen ausbrach.