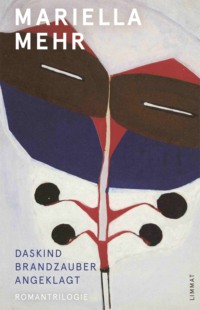Kitabı oku: «Daskind - Brandzauber - Angeklagt», sayfa 6
Im Ausweglosen verstrickt.
In der ausweglosen Zeit, die sich in Ewigkeiten verwandelt.
In dieser Nacht voller schwirrender Narrenlichter.
Irrlichtert
Daskind mit dem Kind
über das Feld
hinter
der Kromenkapelle.
Trägt
am Buckel
Daskind.
Als der Knecht auf dem Hof am östlichsten Rand der Harch das Wimmern des Kindes vernimmt, glaubt er, eine junge Katze zu hören. Langsam sucht er das Feld ab, bis er in einer Ackerfurche ein Kind kauern sieht. Er habe geglaubt, dass dort ein verirrtes Kätzchen jammere, sagt der Knecht dem Bauern, als er Daskind auf seinen Armen in die Stube trägt. Der ruft nach der Bäuerin. Die schlägt beim Anblick des Kindes die Hände zusammen und kann nicht aufhören, ein ums andere Mal Armeskind zu sagen, so verloren.
Wem es gehöre, wird Daskind gefragt. Das aber stumm bleibt. Die Milch trinkt. Sich an der großen Brust der Bäuerin wärmt. Das springt nicht über den Abgrund Wort, um endlich anzukommen, eine Ordnung zu finden. Daskind bleibt unbehaust, trotz der Wärme im Raum und der Milch, keiner Verführung zugänglich ist Daskind.
An diesem Tag wird Daskind zweimal davongetragen. Erst vom Knecht in die fremde Stube. Dann vom Pflegevater in die Kinderkammer. Nachdem ein Hin und Her von Fragen die Herkunft des Kindes klärte. Des Hergelaufenen. Daskind hat sich nicht gewehrt. Ist im offenen Jeep unter Kari Kenels Gummimantel, auf den ein Sommerregen niederprasselte, nach Hause gefahren worden, in die Gefahrenzone aller Gefahrenzonen, wo Frieda Kenel herrscht. Und der Immergrüne. Auch Kari Kenel. Der heute keinen Ledergürtel aus den Schlaufen zerrt. Nur den Kopf schüttelt und «Warumkind» murmelt. An diesem Tag.
11
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Das kann lange dauern, vielleicht ein Leben lang, das Danken, das Demlammdanken, weil es die Sünden der Welt auf sich genommen hat und für die Sünder gestorben ist. Agnus Dei. Singen die Dörfler mit schleppenden Stimmen, während Pfarrer Knobel mit hoch erhobenen Armen die Hostie über den Kelch hält. Seine Augen sind geschlossen. Schweißperlen auf der Stirn, Daskind sieht es genau.
Die Zeit ist ein spiralförmiger Lindwurm, man weiß nie, auf welcher Ebene seines mehrfach gewundenen Rückens man grad sitzt. Daskind denkt an seine Sünden, die ein Lamm auf sich genommen hat. Es müssen seine Sünden sein, die das Lamm getötet haben. Es ist ein Albtraum, an die Sünden zu denken und an das Lamm mit dem Messer am Hals. Während der Schafschur scherzen die Männer und drohen spielerisch mit ihren Messern, machen das Zeichen des Halsabschneidens. Die Schafe blöken und versuchen mit ungeschickten Bewegungen, sich zu befreien. Wenn sie auf den Rücken geworfen werden, ragen ihre zappelnden Beine anklagend in den Himmel. Einige verdrehen die Augen. Starren in eine andere Welt als die der Bauern mit ihren Messern. Manche stellen sich tot, sodass Daskind tatsächlich glaubt, sie seien gestorben. Auch wenn kein Blut fließt. Es ist eine Sünde, ein Lamm mit seinen Sünden zu beladen, dass es daran stirbt. Keine lässliche, die vergeben werden kann, eine Todsünde. Wäre Daskind nicht geboren worden oder kurz nach der Geburt gestorben, in den Bach geworfen worden, vom Vorderberg gestürzt, im See ertrunken, von Schirmers Stier zerfetzt oder vom Pensionisten, hätte kein Lamm sterben müssen. Wen auch immer das Lamm von seinen Sünden befreit hat, Daskind ist nicht unter ihnen.
Das ist mein Fleisch, sagt der Pfarrer mit starker Stimme, und das ist mein Blut, nehmet und esset von meinem Fleisch, trinket von meinem Blut. Sagt auch der Pensionist nachts in der Kammer des Kindes. Hält Daskind in seinen Pranken gefangen. Presst mit dem schweren Leib den Leib des Kindes in die Kissen. Führt den haarigen Schwengel in den Mund des Kindes. Stößt stöhnend zu. Erstickt Daskind am Dasistmeinfleisch. Rächt sich das Lamm. Rasch überschlägt Daskind sein kurzes Leben, bricht ab vor dem letzten Stoß des Stöhnenden, hat beim Überschlagen fast das Atmen vergessen, pumpt das Herz vergiftetes Blut durch den Körper. In wilder Wut. Rast Dasistmeinblut durch die Adern des Kindes. Liegt befriedet der Stier auf dem Kind. Unter den Augen des Lamms an der Wand. Unter den Rosaaugen des Lamms, das lächelt auf den Schultern des Hirten.
In der Sakristei ordnete Jakob Gingg die Soutanen des Pfarrherrn, als Daskind auf Geheiß seines Pflegevaters einen Strauß Rosen vorbeibrachte. Vorbeibringen musste. Während die Stunde bedrohlich mit den Flügeln schlug, hatte sich Daskind, an die Rosen geklammert, wieder einmal durchs Dorf geschlichen, am alten Schulhaus vorbei, ohne einzutreten, dem neuen entlang und am Pfarrhaus, der Michaelskirche zu. Die Rosen waren von der Pflegemutter in eine alte Ausgabe des Bezirksanzeigers gewickelt worden. Trotzdem bohrten sich die Dornen in den Handteller des Kindes. Um den Sigristen für einen Gedankenaustausch über neue Zuchtmöglichkeiten günstig zu stimmen, hatte Kari Kenel die schönsten seiner Stöcke geplündert. Er hatte sich sogar dazu durchgerungen, einige voll erblühte Zweige seiner Moosrosen zu opfern. Das zarte Rosa der Moosrosen ergänzte Kari Kenel mit einigen Hohlsteinrosen, deren blutrote Farbe den Sigristen einst zur Bemerkung veranlasst hatte, dass dieser wunderbaren Blüte der Name Herzblut sehr wohl anstehen würde. Hohlstein erscheine ihm allzu grobtrocken für ein Blümelein – Kari Kenel wunderte sich im Stillen ob der sonderbaren Ausdrucksweise –, dessen leuchtende Farbe das Herz eines jeden Rosenzüchters höherschlagen lasse. Kenel war bereit, dem beizupflichten, obwohl ihm an derart übertrieben poetischen Ergüssen nicht sonderlich gelegen war. Im Gegenteil, gerade die sanftesten Namen seiner Rosen brachten ihn eher in Verlegenheit. Namen wie Marcelle, Caprice, Marie Claire oder Mermaid, eine besonders zarte, blassgelbe Rankrose, ersetzte Kari Kenel kurzerhand durch Initialen und Zahlen. So hieß denn Kenels Marie Claire MC3, die Mermaid dagegen MM2. Auf diese Abkürzungen verzichtete er nur an den wenigen Ausstellungen, die er mit seinen neuesten Züchtungen besuchte. Dort musste man sich an die Regeln halten, auch wenn einem die fremdartigen, zärtlichen Namen nur schwer über die Lippen kamen. Sie verwirrten Kari, weichten den Panzer auf, der sein Inneres umschloss und es vor der Kälte schützte, der er ohne diesen Panzer nichts entgegenzusetzen gehabt hätte. Die Namen häuteten, entwaffneten ihn, sie machten ihn für Träume empfänglich, die in seinem Leben keinen Platz einnehmen durften, wollte er als einer der andern bestehen.
Schließlich bereicherte Kari Kenel den kräftig duftenden Strauß noch um ein paar Zweige Alaskarosen, als wäre ihm zu warm geworden in der armen Haut, als genügte der Name dieser Rose, ihn vor der Hitze zu schützen, die ihn beim Nachdenken überkommen hatte. Aber auch die Alaska konnte ihn heute nicht besänftigen, konnte kein Gefühl von wohltuender Kälte hervorzaubern. Im frühen Morgenlicht schimmerten die alabasternen Blütenblätter, Tautropfen glitzerten vielfarbig in den großen Blütenkelchen, ihr Anblick war nicht dazu angetan, sich zu bescheiden. Kenels Hände zitterten. Er hätte gern die Seidenhaut berühren wollen, eindringen wollen in die Alabasterkühle eines Frauenleibes, der Frieda Kenel so gar nicht war. Wie ein Bub stand er vor ihr, die Rosen in den großen, abgearbeiteten Händen. Aber die hatte rasch, während er noch grübelte, die Rosen an sich genommen und ins Papier gewickelt, dem Kind den Strauß in die Hand gedrückt. Beim Anblick ihrer knöchernen Handgelenke wurde ihm endlich kalt. Beschämt schlurfte Kari Kenel aus der Küche, folgte dem Kind bis zum Gartentor. Dann blieb er stehen, stand unter den weißen Trauerrosen, als Daskind das Tor sorgfältig aufschloss.
In die Stimme Kellers fiel Daskind wie in ein Loch. Sie bildete die Vorhut seiner Hände, die Daskind unter einem Vorwand packten, es an sich rissen, um es wie den schmutzigen Scheuerlappen, mit dem Kellers Frau angewidert den Dreck auf den Stufen verteilte, von sich zu schleudern. Beide, Herr und Frau Keller, bestanden aus fetten Gesichtern und fetten Wörtern, die sie wie Müll in sich hineinschaufelten. Oder andern an den Kopf warfen, bis diese, vollgestopft mit dem Kellermüll, dampften wie unordentliche Misthaufen. Die Anstrengung, mit dem Wortmüll um sich zu werfen oder ihn in sich hineinzuschaufeln, war den Kellergesichtern anzusehen. Fett waren sie, gerötet, und auf Kellers niedriger Stirn bildeten sich bei jedem Wetter Schweißtropfen.
Fast immer hing zwischen Kellers Lippen der Stumpen und qualmte in kurzen Stößen vor sich hin, wenn sich Kellers saugender Mund fest um ihn schloss. Auch heute, als Daskind sich an Keller vorbeischleichen wollte. Der wartete, Zigarre im fetten Gesicht, auf seinen Einsatz. Schlug zu, bevor es das alte Schulhaus erreichte. Mit den in einen alten Bezirksanzeiger eingewickelten Rosen. Mit der behelfsmäßigen Tüte, auf der, leicht vergilbt, noch immer nachzulesen war, wie Bauer Peter aus Freienbach ums Geld kam und sich Kaplan Ringholz bei diesem unredlichen Handel als Komplize des Betrügers einen Namen geschaffen hatte. Oder dass in Yverdon eine 51-jährige Hebamme von einem Rekruten erstochen wurde. Das Bajonett des Soldaten fand die besondere Beachtung des Reporters. Wie auch die Leiche des Massenmörders Tore Hedin, die aus dem südschwedischen See von Borasp gefischt wurde. In einem Abschiedsbrief habe er neun Morde gestanden und darauf hingewiesen, dass er, wenn nicht als Lebender, so wenigstens als Leiche seinem Land einen Dienst erweise, erspare er ihm doch die Gerichtskosten und den Gefängnisplatz, man möge ihm deshalb seine Flucht ins Jenseits verzeihen.
Von aller Vorsicht abgenabelt, gehorchte Daskind Kellers Stimme. Die als Vorhut nach ihm grapschte. Das fette Kellerlachen traf auf keinen Widerstand, als es in die Poren des Kindes eindrang und gleichzeitig die Kellerhand dem Kind den Stumpen in den Mund stieß, bis Daskind fahl wurde, die Todesangst über die Rosen kotzte, und über Tore Hedin, der doch schon tot war. Den keine Angstbrühe auferwecken konnte, wie das der herr am Ende eines langen Wartens eines jeden Sünders tat und mit dem Daumen beliebig nach unten oder oben wies.
Ich werde dich lehren, Zigaretten zu stehlen. In meinem Laden. Unter meinen Augen.
Lacht sein fettes Kellerlachen. Dieben soll man beizeiten die Hände abhacken.
Hat den krummen Blick, der Keller, auf Daskind gerichtet und lacht.
Kari Kenel steht noch immer bei der Trauerrose. Ohne sich zu rühren. Was soll Daskind mit dem stummen Pflegevater unter der Trauerrose. Mit dem speicheligen Zigarrenende im wunden Mund. Mit dem fetten Lachen in den Poren. Mit dem «Ich will dich lehren, in meinem Laden Zigaretten zu stehlen».
Schleicht, vom Ekel geschüttelt, alleinsam durchs Dorf. Keinen einzigen Schrei hinter sich lassend. Dieser Art Wege sind taubstumm zu beschreiten. Mit verstopftem Mund wie nachts unter dem Immergrünen.
Daskind verhielt den Schritt vor der Michaelskirche. Schluckte bitteren, übel riechenden Schleim. Die Erniedrigung. Den Hass Wennichgroßbinwerdeicheinenvoneuch. Oder vielleicht die Kellermarie. Wenn man ein Kind wie Daskind ist, scheint die Auswahl unbegrenzt. Nur Eulenkinder haben eine Zukunft. Anderer Kinder Leben scheint ein Tod ohne Ende zu sein. Und nähme der Tod ein Ende, was dann? Was überhaupt bei dem Leben?
Im Kind denkt’s ans Töten. Dann ist eine Macht da, im Kopf, wenn ans Töten gedacht wird.
Unter dem Chorgewölbe blieb Daskind einen Augenblick stehen. Über ihm breitete Mutter Maria schützend ihren Sternenmantel aus. In seine Falten schmiegten sich um Fürbitte betende Menschen, zur Linken der Heiligen Jungfrau fromme Männer, zu ihrer Rechten Frauen und Kinder. Die Hände Hilfe suchend erhoben, hingen ihre Blicke am Gesicht der Jungfrau, das, von einem Heiligenschein umrahmt, sanft auf sie herablächelte. Die Gottesmutter war eine Riesin, so groß, dass sich die Menschen in ihren Mantelfalten wie Zwerge ausnahmen. Einige gingen am Stock, andere hatten Schwären an den nackten Füßen. Einem fehlte ein Bein, der junge Mann stützte sich auf die Schulter eines Alten, dessen Gesicht von einer Wunde entstellt war. Ein Mädchen, an der Hand seiner Mutter, sah mit großen, traurigen Augen empor. Bei seinem Anblick zog sich dem Kind das Herz zusammen. Das kannte Daskind, diese nie enden wollende Trauer in der Brust, ein schwarzer Stein, der das Atmen erschwerte. Schmerzzerfressen. Hasszerfressen, wenn der Schmerz nicht mehr auszuhalten war.
Eine kurze Steintreppe führte hinter dem linken Seitenaltar, der dem Schmerzensmann geweiht war, hinunter zur Sakristei. Das Sandsteinrelief über der goldverzierten Altarmensa wurde von einer winzigen Öllampe schwach beleuchtet. Die Gesichtszüge des leidenden Christus, in Schmerz erstarrt, wirkten abweisend. Der nackte, magere Leib war von den gestifteten Kerzen rußgeschwärzt. Eine Hand war abgeschlagen, die Beine grotesk ineinander verschlungen, am linken Fuß fehlte die Ferse. Daskind berührte die raue Oberfläche des Körpers, es musste sich dazu auf die Zehenspitzen stellen und weit über den Altartisch beugen. Im Herzen der silbernen Strahlenmonstranz lagen die Hostien von der letzten Totenmesse. Wenn die Wettermesse gelesen werden musste, wurde die kleinere, vergoldete Wettermonstranz hervorgeholt. Daskind, das nicht wusste, was es am Leib des Herrn zu suchen hatte, trödelte lange vor dem Altar.
Bis es den Sigristen in der Sakristei hantieren hört. Bedächtig nimmt es Stufe um Stufe. Den jetzt unschönen Strauß mit den langen Dornen fest umklammernd. Zwingt sich, nicht an den Schmerz im blutenden Handteller zu denken. Das Blut hat Tore Hedins Geständnis und des Kindes Angstbrühe rot gefärbt. So ist alles eins geworden mit dem Kind, das Blut und die Angst und der Schmerz und der Tod eines Mörders. Kein Loch, durch das Daskind aus dem Kreis schlüpfen könnte. Sieht dem Sigristen ins faltige Altmännergesicht. In die geröteten Augen. Saugt sich an ihnen fest, als wäre das ungläubige Staunen in diesen Augen eine feste Burg. Der Unverstand des Sigristen ein sicherer Hafen. Streckt dem Sigristen die Angst und das Blut und den Schmerz, den Tod entgegen. Der ihm, angewidert von der Geste, die Tür weisen will. Daskind bleibt unter der schweren Holztür stehen, mit den zerstörten Rosen in der ausgestreckten Hand.
Daskind kann den Zorn im Sigristengesicht sehen. Er spiegelt sich in den Sigristenaugen wider, die jetzt schmal werden wie die des Kindes es immer sind. Daskind sieht unter den verquollenen Lidern ein kaltes Feuer.
Unter der Stuckdecke, an der Ziborium, Messbuch, Messglöcklein, zwei Kerzen, ein Lorbeerzweig und Rosen zu einem sakralen Stillleben in einem runden Louis-seize-Rahmen geordnet sind, steht das alte Sakristeibuffet. Dorthin zerrt der Sigrist Daskind. Hat es am Nacken gepackt und zum Buffet geschleift, drückt ihm das Gesicht auf das rankenverzierte Holz, dass Daskind keine Wahl hat. Fallen die Streiche auf den Rücken des Kindes, reißen die Dornen die Haut auf unter dem dünnen Hemd, hinterlassen rote Spuren auf der Haut. Mutter Maria, möchte Daskind beten, nimm mich unter deinen blauen Himmelsmantel. Möchte betteln, von den Rosenschlägen verschont zu werden. Wird nicht verschont, Daskind, kennt kein Gebet, das so laut wäre, dass es die Himmelsmutter hören könnte. Dich will ich lehren, geifert’s aus dem Sigristenmaul, ich bin das Schwert Gottes, da, um deine Sünde zu rächen vor den Augen des Herrn.
Fallen verkotzte Blütenblätter von den dornigen Stielen. Fällt dem Kind die Leiche Tore Hedins ins Gehirn und das Soldatenbajonett. Das will es nicht vergessen, dass da Krieg herrscht zwischen ihm und der Welt. Das will es nicht vergessen, und dass es gestehen muss, immer wieder, ein Kriegskind zu sein, den Tod im Gedärm und in der Seele, die einem wie dem Kind abgesprochen wird, und doch da ist mit ihrer Last aus Verzweiflung und Hass. Das ist mein Fleisch, das ist mein Blut, hämmert’s in seinem Kopf, nehmet und esset vom Gift, schlagt euch die geilen Bäuche voll, saugt das Blut auf mit euren gierigen Mündern. Bringt Fleisch und Blut zum Verschwinden, bis nichts mehr bleibt vom Kind, an dem es leiden könnte. Rasch noch die Dornen in den Schädel gebohrt und einen Speer zwischen die Rippen. Es wird kein Halten geben, wenn die Sünden unvergeben sind und der Leider am Kreuz kein Erbarmen zeigt. Ich will dich lehren, schreit’s über dem Rücken des Kindes. Widerstandslos lernt Daskind, vornübergebeugt, das Gesicht in die Ranken gedrückt. Lernt rasch und sicher, weil keine Zeit zu vertrödeln bleibt, wenn von der Sünde die Rede ist. Erstaunt bemerkt es das plötzliche Fehlen der Angst, hat mit den Fühlern des Hasses eine Ordnung gefunden. Agnus Dei auf dem brennenden Rücken, den Dornenkranz auf dem lockigen Haupt. Liegt in den braun verfärbten Rosenblüten, die nicht lieblich duften. Fällt Schneeregen in den schwarzen Hass.
Keiner fragt Daskind nach der Ursache seiner Wunden. Ist im Übermut in die Dornenhecke gefallen. Vielleicht. Im Übermut, im hergelaufenen, ins Haus geholten. Dornenkind.
12
Das war ein Gelächter im Dorf, als man erfuhr, dass sich Daskind nachts im frisch ausgefahrenen Mist gewälzt hatte. Nachdem sich Gott, der Herr, und der heilige Petrus geweigert hatten, Daskind von seiner stummen Not zu befreien, wie Pfarrer Knobel es wortreich versprach, schleppte man das Kind zur Schwarzen Madonna ennet dem Vorderberg. Die Freudenstau hatte Frieda Kenel heimlich ein paar Schrecksteine zugesteckt, die solle sie dem Kind in die Rocktasche geben, man könne nie wissen, ob nicht doch ein Dämon im Kind stecke, der jede Fürbitte der Schwarzen Mutter verlache. Ganz bestimmt leide Daskind am Chlupf, wie man es in dieser Gegend nenne, da könne sowohl das Auflegen von Schrecksteinen als auch von Schwalbenasche oder ungereinigten Hufnägeln gute Dienste leisten. In der Nähstube hatten sich die Frauen ausgiebig unterhalten. Über den Kopf des Kindes hinweg, das auf dem roten Sofa saß und wie immer schwieg. Frieda Kenel, die Stecknadeln zwischen den Lippen, konnte ihrem Misstrauen gegen solchen Aberglauben nur zischend Ausdruck verleihen, aber ihr kühler Blick aus seidenblauen Augen und die hochgezogenen rötlichen Augenbrauen sprachen Bände. Das allerdings hielt ihre Kundinnen nicht davon ab, sich lüstern über Räucherungen, Beschwörungen, über den Nutzen von Verschreifeigen beim Chlupf, Luchsklauen bei Verstocktheit und andern Gottesgeißeln zu unterhalten. Daskind kaute an den aufgeklebten Gänseflaumfederchen eines weißen Zelluloidschwans, als Schättis Frau lispelnd vor Aufregung riet, drei Miserere über dem Kind zu singen und dann dreimal mit den Worten das Kreuz über dem Kind zu schlagen: «Für Herzgesperre und Unterwuchse, Hilf meinem Kind von seiner Sache, Hilf meinem Kind von seiner Rippe, wie Jesus Christus von der Krippe.» Hierauf blase man dem Kind dreimal ins Gesicht, nachdem man eine Knoblauchzehe gegessen und die rechte Hand ins Weihwasserbecken neben der Stubentüre getaucht habe. Weil aber niemand so recht wusste, wessen Kind denn Daskind nun eigentlich sei, entstand eine Verlegenheit, die sich in einem langen Schweigen bemerkbar machte. Schließlich unterließ man, immer noch etwas verlegen, man war ja gerade dabei gewesen, der Kirche das verbriefte Recht abzusprechen, als einzige Heil und Weh der Welt zu verwalten, jegliche Zauberei, auch die im Namen Christi. Nur die Freudenstau steckte Frieda Kenel heimlich drei Schrecksteine zu, die sie, so gebot es die Vorschrift, bei Vollmond unter einem Kuhfladen hervorgeholt hatte. Schättis Frau drückte Daskind an die milchig duftenden Hängebrüste: Frecherbub, Kleinerfratz, zärtlich, und eine Brustwarze schmiegte sich zutraulich an die Wange des Kindes. Das hatte soeben die letzte Flaumfeder des Schwans verschluckt und hustete, bis es in Tränen ausbrach. Saumädchen, Dreckigerbalg, Undankbares Ding, sagte die Freudenstau, während die Störschneiderin Kenel geschäftig an ihren schmalen Hüften hantierte und sanft über den glatten, geschmeidigen Stoff strich. Auf dem marmornen Schwarz schillerten die Lichtstrahlen der Nachmittagssonne, am Bein der Freudenstau glitzerte das Strumpfband.
Die Unterredung in der Nähstube brachte Frieda Kenel auf den Gedanken, sich mit Pfarrer Knobel auszusprechen. Der, im Beichtstuhl durch das Sprechgitter Meinetochter murmelnd, rief die Schwarze Jungfrau an, eine Wallfahrt zu ihr könne nicht schaden. Er selber wolle, gegen ein bescheidenes Entgelt, es sei immer ratsam, dem Herrn Jesu Geschenke darzubringen, zum Segen des Kindes eine Messe lesen. Wenn Daskind sich aber weiterhin, auch nach dem Besuch der Heiligen Mutter, in einer Art von Nervenkrampf winde, müsse man an eine Austreibung denken. Doch dafür sei er nicht zuständig, da müsse Pater Laurentius her, den wolle er schon einmal benachrichtigen und im Namen Gottes bitten, sich des Kindes, wenn nötig, anzunehmen. Bei dem Wort Austreibung leuchteten Knobels Augen in heiliger Vorfreude auf. Es war dasselbe Leuchten, das in seinen Augen lag, wenn er sonntags durchs Dorf trippelte und einem gedeckten Tisch entgegeneilte. Austreibung. In diesen Zeiten wurde man nicht allzu oft mit derlei frommer Drastik verwöhnt. Ausgetrieben wurde vielmehr der Aberglaube, auch in Knobels Kirche, damit Gott vorbehalten bleibe, was Gottes ist. Beim vermaledeiten Kind aber würde die Uhr zurückgestellt werden, zum Wohle des Kindes in die Zeit zurück, als dem Teufel mit Rutenhieben auf die armen, besessenen Leiber das Wildern ausgetrieben wurde. Amen. Gehe, Meinetochter, in Frieden.
Aber vorerst wird nicht ausgetrieben. Das spart man sich für den schönen Notfall auf. Zuerst wird zur Schwarzen Mutter ennet dem Vorderberg gewallfahrt, die soll helfen, wenn dem Kind noch zu helfen ist. Da wird man beten, für das in züchtiges Grün gekleidete Kind, fürs von Frieda Kenel in grobes Tuch eingeschneiderte Kindohnelieb, fürs Chlupfchind, das ungeschlachte. Die Schrecksteine liegen schwer in der Rocktasche, Frieda Kenel hat geglaubt, sich an höhern Mächten als der Macht Gottes zu versündigen, wenn sie den Ratschlag der Freudenstau nicht beherzigte. Nachts zuvor ist Frieda Kenel über sich hinausgewachsen, hat drei Zweiglein Majoran in ein Glas gegeben, Wasser dazugegossen und das Ganze mit blauem Papier zugedeckt, das sie vorher mit Nadelstichen durchlöchert hat. Sogar die Schere hatte sie nicht vergessen, das Papier mit einer kreuzförmig geöffneten Schere beschwert und dreimal zu Gott gebetet, er möge ihrem Tun den Segen bringen. Als sich Daskind morgens an dem Gebräu verschluckte, verstand sie es als ein Zeichen. Sie hatte es immer gewusst: dem Teufel ab dem Karren.
Im Zug war es gut. Daskind ließ die Landschaft an sich vorbeiziehen. Es saß neben Kari Kenel, in sich gekehrt, ohne Anteilnahme. Frieda Kenel hatte Brote mitgeschleppt, die keiner aß. Sie nippte an einem Glas Elmer Citro, das Mineralwasser gehörte unverzichtbar zu einem Ausflug. Daskind nippte an nichts. Schloss die Hand um die Schrecksteine, die sich warm und etwas rau anfühlten. Wie Kari Kenels Militärhose, die er an Werktagen trug. Es hätte gerne an den Steinen gerochen, wagte aber, unter den Augen der Pflegemutter, nicht, sich zu rühren.
Ennet dem Berg, jenseits des Berges, lag alles, was Daskind von der Welt trennte. Man musste also in die Welt fahren, um den Teufel loszuwerden. Wenn der Teufel auch mitfahre, dachte Daskind, hier, ennet dem Vorderberg, würde er mit zornig-bissigem Gestank von dannen fliegen, der Hölle zu. Über die Komplikationen dachte Daskind nicht weiter nach, nicht an die Möglichkeit, dass der Teufel es nach seiner Rückkehr am Eingang des Dorfes hämisch lachend begrüßen könnte. Mit seinem Bocksfuß, dem Bocksschwanz und den Bockshörnern. Dem Bocksgestank. Dass ein hinterlistiges Geschick es für immer an den Teufel verschacherte. Der seine Hölle im Dorf hatte und unter den Augen der Bewohner mit dem Kind sein Unwesen trieb. Dass es nimmer reden mochte. Wer konnte schon mit Sicherheit sagen, von wem Daskind in seiner Kammer ausgefroren wurde. Und hatte es je in Kari Kenels Augen geschaut, wenn er zuschlug und weinte. Vielleicht war ja auch das Sigristengesicht nur eine Tarnung, an der sich der Teufel ganz besonders ergötzte. Daskind selbst eine Ausgeburt teuflischer Fantasie, eine unrettbare Nichtexistenz, der auch die Welt ennet dem Berg nicht zum Leben verhelfen konnte. Gottes verlorene Idee, vom Teufel aufgelesen und umgeformt. Nichts war sicher, nichts als der schwere, schwarze Stein in der Körpermitte, um den Daskind täglich Ordnung zu schaffen suchte.
Der Andrang der Welt nahm mit jeder Umdrehung der Räder zu. Daskind betrachtete das sich immer wieder verändernde Muster aus Dörfern, weidenden Kühen, Kirchtürmen, kleinen und größeren Bahnhöfen, wo sonntäglich gewandete Menschen mit Kindern wie dem Kind an den Händen ungeduldig auf die Abreise von da nach irgendwohin warteten. Erreichte der Zug einen Bahnhof, stand die Zeit für einen Augenblick still, und Daskind glaubte zu sehen, dass sich ennet dem Berg frei von schwarzen Steinen Schicksale ereigneten und deshalb keine Ordnung zu schaffen geboten war. Weil Daskind die Freude nicht kannte, schloss es die Augen, bis der Zug in Einsiedeln einfuhr.
Eine lachende, gestikulierende Menschenmasse quoll aus den Wagen, drängte sich zum Bahnhofsausgang und verteilte sich gleichmäßig über die Straße, die zur Wallfahrtskirche führt. Was für eine Straße. Auf den Gehsteigen reihte sich Stand an Stand, prall gefüllt mit Devotionalien, gebrannten Mandeln, herzförmigen Schleckstängeln und Magenbrot. In großen Kupferkesseln wurde Zuckerwatte in allen Farben angerührt, die, um lange Holzstiele geschwungen, in den Händen strahlender Mädchen und Buben landete. Die Erwachsenen wählten unterdessen zwischen einer Madonna aus Marzipan oder bemaltem Eschenholz, aus Gips, Ton oder Bakelit.
Daskind starrte auf einen Berg herzförmiger Schleckstängel. Sie leuchteten erdbeerrot in der Sonne, ihr süßer Geruch, vermischt mit dem wolkigen Geruch der Zuckerwatte und dem bittersüßen Geruch der gebrannten Mandeln stieg dem Kind in die Nase. Die Farbe der Zuckerherzen war von derselben Leuchtkraft wie das Flammenherz Jesu über dem Weihwasserbecken in Frieda Kenels Stube. Daskind träumte mit offenen Augen, dass da ein Berg gebrochener Jesuherzen läge, alle um seinetwillen gebrochen, eins nach dem andern. Die Katze hat sieben Leben, dann ist’s aus, Schluss mit dem Mäusefangen, dem Krallenwetzen und Miauen. Fritz, der Kater, war beim siebten angelangt. Vielleicht. Wer eine Katze am Schwanz packt, gibt ihr ein Leben zurück, damit sie sich nachts auf die Brust des Kindes setzen und mit den krallenbewehrten Pfoten zuschlagen kann. Wer an einem gebrochenen Herz Jesu lutscht, macht sich der Sünde wider den Heiligen Geist schuldig. Wer das Herz Jesu bis auf den weißen Zuckergrund mit der Zunge durchlöchert, wird zum Eisvogel, der nie mehr zu sich zurückkehrt und alle Jesuherzen auf den hohen Berg tragen muss, wo der Silberpfahl unterm Mond aufragt und leuchtet und zustößt, bis der Schleim im Mund zuckrig wird und Herzjesu lacht, wenn der Eisvogel nicht in das Land des Anfangs zurückkehren kann.
Frieda Kenel schob Daskind durch die Menge, der Kirche entgegen, wo bald das Hochamt mit einem jubelnden Kyrie eleison, aus Hunderten geübter Mönchskehlen und vollen Mönchsherzen gesungen, beginnen sollte. Da Daskind nicht gefrühstückt hatte, weil man danach den Leib Jesu nicht empfangen durfte, wurde ihm vom Gedränge, Geschiebe und den vielen Düften leicht schwindlig, sodass es sich an Kari Kenel festhalten musste. Die wogende, jetzt allmählich verstummende Menschenmasse näherte sich dem Hauptportal der Barockkirche, zäh und beharrlich zerteilte sie die schwere, zuckerschwangere Luft, der sich nun ein scharfer, animalischer Geruch nach Krankheit, Angst und Sorge beimischte. All die dicht gedrängten Leiber verströmten eine schreckliche Gegenwart voller Leid, Schmerz, Todesahnungen und Jenseitsängsten, aber auch Eitelkeit, Neid, Missgunst und Selbstsucht. Daskind hielt den Atem an, um nicht daran zu ersticken. Es passte auf, dass die Schatten nicht in es eindrangen und seinen Körper besetzten. Das hätte es nicht ertragen, all diesen traurigen Unrat, es hatte genug damit zu tun, in seinem eigenen Körper Ordnung zu schaffen. Rund um den schwarzen Stein, der es niederdrückte.
Während im Rücken der Menschenmenge noch immer die mählich dumpfer werdenden, schließlich fast drohenden Lockrufe aus den Verkäufermündern erschollen, stimmten die vordersten, die das Portal bereits berühren konnten, das Ave Maria an. Ein unbarmherziger Gesang ergoss sich in die Ohren des Kindes, das sich, vor Müdigkeit und Hunger kaum noch aufrecht halten konnte. Die Menge brach aus ihrer Form, als die Ersten in die Kathedrale eindrangen und sich, einander unwillig stoßend und schiebend, auf die Bänke verteilten. Es wurde an Rosenkränzen gefingert, während das Ave Maria zum Schlachtruf anschwoll und ein dumpfes Glück die Pilger ergriff. Selbst das Licht schien sich zu verändern, als die Gläubigen ächzend hin und her zu schwanken begannen und ihre Körper nach vorne drängten.
Und plötzlich fand sich Daskind vor der Heiligen Jungfrau wieder. Die Luft war verwundet von Weihrauch und Schweiß, während das Ave Maria lauter und lauter wurde, schließlich als ein einziger Schrei durch die Kirche wogte, dann plötzlich verebbte. Als hätte eine göttliche Hand Einhalt geboten. Ohne die besten Plätze vor der Madonna zu verlassen, verrenkten die Männer und Frauen ihre Hälse, um das Geschehen vor dem Hauptaltar verfolgen zu können. Der Prior, gefolgt von einer Schar Mönche, stieg mit der goldenen Monstranz die Altarstufen hinauf und stellte sie auf die Mensa. Dann schlug er das Kreuz über ihr, und die Mönche begannen zu singen. Das Kyrie widerhallte von den stuckverzierten Wänden, auf der Empore antwortete den Mönchen ein Knabenchor. Ihre hellen Stimmen verdunkelte eine beklemmende Trauer, die sich auf die Menge übertrug. Auch auf Daskind, das vor der Madonna stand und die reich bestickten Gewänder bestaunte. Im trüben Licht der Kerzen leuchteten die bunten Perlen auf dem goldenen Brokatgewand. Über den Schultern hing lose ein weiter, mit Sternen übersäter Mantel aus blauem Samt. Die Madonna lächelte, dem Künstler war das schüchterne Lächeln einer scheuen Jungfrau vollendet gelungen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.