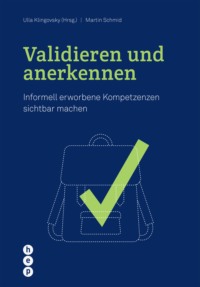Kitabı oku: «Validieren und anerkennen (E-Book)», sayfa 4
2.3 Kompetenzen
Die meisten Validierungs- und Anerkennungsverfahren machen sich die in den vergangenen Jahren in den meisten Lern- und Ausbildungsinstitutionen formulierten Kompetenzraster zunutze, da sich die Verfahren weitgehend an Konzepten der Kompetenzentwicklung und -erfassung orientieren. Im Zentrum stehen der Kompetenzbegriff und ein ganz bestimmtes Verständnis, was er für Anerkennungs- und Validierungsverfahren bedeutet und wie er in diesem Zusammenhang nutzbar gemacht werden kann. Allerdings sind Kompetenzdefinitionen in der Literatur beinahe inflationär vorzufinden (vgl. z. B. Erpenbeck 1997: 311 f., Frey 2004: 904, Klieme/Hartig 2007: 21, Erpenbeck/von Rosenstiel/Grote/Sauter 2017: XX–XXIV, Weinert 2001, 27 f., Arnold 2001: 176, Dehnbostel/Gillen 2005: 32, Bohlinger 2013: 28), was mitunter auch ein Ausdruck der Problematik des Kompetenzkonstrukts ist. Deshalb soll an dieser Stelle nur darauf verwiesen werden, worin Kern und Anknüpfungspunkte für Anerkennungs- und Validierungsverfahren bestehen. Die nachfolgenden Ausführungen nehmen hauptsächlich Bezug auf Diskussionen in den Fachbereichen Pädagogik im Allgemeinen und in der Berufs- und Erwachsenenpädagogik im Speziellen.
Der eigentliche Ursprung der Kompetenzdebatte liegt allerdings ausserhalb des Fachbereichs Pädagogik und wird dem Linguisten Noam Chomsky zugeschrieben, der bereits 1962 eine strikte Trennung von Kompetenz und Performanz vornahm. Er ging davon aus, dass unter Kompetenzen die Fähigkeit von Sprechern und Hörern verstanden wird, die mithilfe eines begrenzten Inventars von Kombinationsregeln und Grundelementen potenziell unendlich viele neue, noch nie gehörte Sätze selbstorganisiert bilden und verstehen können. Grundlegend und für die Weiterentwicklung des Kompetenzverständnisses zentral ist die sich daraus ergebende Konsequenz, dass sich Kompetenzen im so verstandenen Sinn erst auf der Ebene der Performanz äussern und dann auch beobachtbar und mitunter auch messbar sind (Klieme/Harting 2007; Annen 2012; Grunert 2012). In der Pädagogik werden Kompetenzen erstmals 1971 von Heinrich Roth erwähnt. Seine Arbeiten hatten grossen Einfluss auf das pädagogische Kompetenzverständnis. Für ihn ist die Entwicklung des Individuums abhängig von der Lernumwelt sowie den Sozialisations-, Lern- und Erziehungsprozessen, die den Menschen in die mündige Selbstbestimmung führen. Aus diesem Zusammenspiel von personalen und situativen Aspekten ergeben sich Handlungsprozesse, deren erfolgreiche Bewältigung als menschliche Handlungsfähigkeit oder eben als Kompetenz verstanden wird. Mündigkeit ist für Roth (1971) darüber hinaus die seelische Verfassung einer Person, bei der die Fremdbestimmung so weit wie möglich von der Selbstbestimmung losgelöst ist, wenn eine Person also über die Fähigkeit verfügt, verantwortungsvoll zu handeln. Diese Handlungsfähigkeit ist als Kompetenz zu verstehen, die sich ausdifferenzieren lässt in Selbstkompetenz (Fähigkeit, selbstverantwortlich zu handeln), Sach- und Methodenkompetenz (Fähigkeit, für Sachbereiche urteils- und handlungsfähig und damit zuständig zu sein) und Sozialkompetenz (Fähigkeit, für sozial, gesellschaftlich und politisch relevante Sach- und Sozialbereiche urteils- und handlungsfähig und also ebenfalls zuständig zu sein) (Roth 1971: 180). Diese Differenzierung schränkt den Kompetenzbegriff entsprechend nicht nur auf die menschliche Handlungsfähigkeit in unterschiedlichen Situationen ein, sondern beinhaltet auch die Persönlichkeit des Individuums. Kompetenzen sind somit Persönlichkeitsdispositionen, welche die Bewältigung unterschiedlicher Lebenssituationen ermöglichen (Klieme/Hartig 2007).
In der Zeit nach Roth blieb es in der Pädagogik rund 20 Jahre still rund um den Kompetenzbegriff. Ins öffentliche Bewusstsein geriet er erst wieder im Rahmen von schulischen Diskursen und dabei speziell im Zusammenhang mit der PISA-Studie. Allerdings unterschied sich dieses grundlegend vom bisherigen Kompetenzverständnis, das von individueller Handlungsfähigkeit und der Erfordernis des Individuums ausging, in komplexen Situation angemessen reagieren zu können. Neu an der vor dem Hintergrund der PISA-Studie entstehenden Ausrichtung waren die Leistungsmessungen in Schulen und die damit verbundenen individuellen Leistungsdispositionen. Der dabei verwendete Ansatz, der durchaus nicht als umfassendes und ausgereiftes Kompetenzkonstrukt zu verstehen war, konzentrierte sich in erster Linie auf vermittelbare kognitive Kenntnisse, Fertigkeiten und Strategien, die auf das Wissen und Können innerhalb der ausgewählten Domänen abstellt und damit als funktional und fachbezogen charakterisiert werden konnte (Grunert 2012). Dieses Verständnis des Kompetenzbegriffs, das auf Leistungstests fokussiert und somit in erster Linie nach dem Produkt «Kompetenz» fragt, hat sich in den folgenden Jahren weiterentwickelt und verändert. Kompetenzen wurden, darauf aufbauend, in der Folge als komplexes, handlungsregulierendes System gefasst, in dem «intellektuelle Fähigkeiten, bereichsspezifisches Vorwissen, Fertigkeiten und Routinen, motivationale Orientierungen, metakognitive und volitionale Kontrollsysteme sowie persönliche Wertorientierungen» (Weinert 1999, zit. nach Grunert 2012: 60) verbunden sind. Trotz dieser Ausweitung oder Rückbesinnung auf Teilaspekte des Roth’-schen Kompetenzbegriffs und somit auf die subjektbezogene Handlungsebene geriet im Kontext der PISA-Studie allmählich die Nutzbarmachung von Kompetenzen für spezifische Zwecke in den Vordergrund. Diese Aspekte sollten die künftige Diskussion rund um Kompetenzen tief greifend prägen und sich grundlegend auf die Validierungs- und Anerkennungsverfahren in verschiedenen Bereichen des schweizerischen Bildungssystems auswirken. Den Gedanken des Verwertungszwecks von Kompetenzen führten Autoren wie Erpenbeck/von Rosenstiel/Grote/Sauter (2017) weiter, deren Grundgedanken eher der betriebswirtschaftlichen Managementpraxis und weniger der (berufs-)pädagogischen und psychologischen Forschung entsprangen. Dadurch rückten unternehmerische Ziele sowie der wirtschaftliche Erfolg von Betrieben und deren Konkurrenzfähigkeit ins Zentrum, die durch gezielte Kompetenzentwicklung der einzelnen Mitarbeitenden sichergestellt werden kann. Diese Entwicklung führte gar dazu, dass Kompetenzorientierung zu einem Schlüsselkonzept der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit wurde. Verschiedene Verfahren zur Sichtbarmachung und Messung oder Bilanzierung von Kompetenzen wurden erarbeitet, die mehrheitlich der Personalentwicklung dienen und aus wissenschaftlicher Sicht allesamt mit Problemen behaftet sind. Entweder sind die für ein Unternehmen relevanten Kompetenzen zu wenig ausdifferenziert und entsprechend zu abstrakt formuliert, sodass sie sich nicht operationalisieren und schon gar nicht interkulturell vergleichen lassen, oder sie werden detailliert verschriftlicht, wobei sich Überschneidungen von verschiedenen Kompetenzen nicht verhindern lassen und darüber hinaus ein Kompetenzkatalog entsteht, der selbst von Fachleuten nicht mehr überblickt werden kann (Klieme/Hartig 2007). Dennoch finden diese Kompetenzmessverfahren breite Akzeptanz, sind aber unter anderem auch Ausdruck dessen, was Arnold (1997) unter kompetenzorientierter Wende versteht. Darunter ist letztlich die Anpassung des Individuums an sich verändernde Wissensbestände und Rahmenbedingungen gemeint, und zwar in dem Sinne, dass der Kompetenzbegriff eine nach ökonomischen Massstäben handlungsfähige Persönlichkeit impliziert. Im Gegensatz zu bildungspolitischen Imperativen drückt sich die kompetenzorientierte Wende in individualisierten und auf Selbststeuerung ausgelegten Anforderungsprofilen aus (Truschkat 2009: 21). Dieser ständige Wandel der Anforderungsprofile ist im sozialen Wandel begründet, kann aber auch mit der fortschreitenden Modernisierung und Technologisierung in einzelnen Unternehmen oder gar arbeitsplatzbezogen implizit oder explizit in Verbindung gebracht werden. Solche Entwicklungen rücken ein bestimmtes Verständnis des Kompetenzbegriffs ins Zentrum, das im Wesentlichen in beruflichen Verwertungszusammenhängen begründet ist. Zwar geht es noch immer um den Menschen mit seinem vielfältigen Wissen und Können, mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten oder, anders ausgedrückt, um seine gesamte Persönlichkeit. Die Kompetenzen sollen aber in ökonomische Kontexte einfliessen und für die betriebliche Weiterentwicklung im Sinne der Gewinnmaximierung fruchtbar gemacht werden. Etwas widersprüchlich mutet in diesem Zusammenhang gemäss Vonken (2005) an, dass Kompetenzentwicklung, hier als Persönlichkeitsentwicklung durch die Selbstorganisationsfähigkeit des Individuums verstanden, aus pädagogischer Perspektive einem konstruktivistischen Ansatz folgt. Es wird davon ausgegangen, dass sich Kompetenzen nicht wie Qualifikationen vermitteln lassen, sondern dass dem Entwicklungsprozess eine subjektive Konstruktionsleistung zugrunde liegt (Erpenbeck 1996: 9). So gesehen, steuert das Individuum seine individuelle Kompetenzentwicklung selbst. In der Regel werden aber die Kompetenzentwicklungsziele durch ökonomische, berufliche oder bildungspolitische Vorgaben bestimmt, sodass der Entwicklungsprozess nur scheinbar individuell ist. In Wahrheit wird von der Unmündigkeit des Individuums ausgegangen und seine Entwicklung in vorgezeichnete Bahnen gelenkt. Kompetenz wird so zum Steuerungsmechanismus für Haltung und Handeln der und des Einzelnen. Dieser Widerspruch löst sich nur dann auf, wenn die individuellen Kompetenzentwicklungsziele tatsächlich mit den vorgegebenen Kompetenzzielen übereinstimmen. Nur dann wird das Individuum in der Lage sein, sich auf die Anforderungen einzulassen und sich der Zumutung der skizzierten Erziehungsmechanismen zu entziehen. Diese Passung ist bei auf Kompetenzprofilen basierenden Validierungs- und Anerkennungsverfahren in aller Regel gegeben, zum einen, weil die Kompetenzentwicklungsprozesse bereits grösstenteils abgeschlossen sind, und zum andern, weil es ja genau darum geht, die bereits entwickelten Kompetenzen zu attestieren. Die oben beschriebene Problematik zeigt sich erst, wenn allenfalls in Teilbereichen noch Nachholbedarf besteht. Klaffen individuelle Kompetenzentwicklungsabsichten und vorgegebene Anforderungsprofile auseinander, kann das zu Demotivation und sogar zum Abbruch des Verfahrens führen. Die ökonomische Nutzbarmachung der subjektiven Persönlichkeitsstrukturen würde entsprechend erfolglos bleiben.
Im Kompetenzdiskurs nimmt die Berufspädagogik eine Position zwischen pädagogischen Ansätzen und unternehmerischen Zielen beziehungsweise den betrieblichen Anforderungen an die Arbeitnehmenden ein. Vor dem Hintergrund des beschleunigten technologischen Wandels und der Forderung nach erhöhter beruflicher Mobilität kümmerte sie sich allerdings zunächst um die Frage der Schlüsselqualifikationen. Das sind Bildungsziele und Bildungselemente mit universalerer Relevanz und längerer Haltbarkeit als fachliche Qualifikationen (Mertens 1974). Durch die zunehmende Ausdifferenzierung dieser Schlüsselqualifikationen und die Ausweitung des Konzepts auf andere Schulstufen und -fächer verlor dieser Fokus zunehmend an Schärfe. Dennoch markiert die Initiierung von Schlüsselqualifikationen eine pragmatische Wende, da das Konzept auf Handlungsfähigkeit abzielte. Das ihm inhärente, sich verbreitende Kompetenzverständnis leitete eine Abkehr vom bildungstheoretischen Objektivismus der Stofforientierung ein. Die sich allmählich etablierende Kompetenzorientierung beruflichen Lernens schliesst unmittelbar an das bereits durch Roth (1971) begründete Konzept der Handlungskompetenz an und greift die Trias von Selbst-, Sozial- und Fachkompetenz auf. Berufslernende sollen lernen, in beruflichen wie privaten Situationen eigenständig und eigenverantwortlich zu handeln. Diese Festigung der persönlichen Disposition folgt allerdings Zielsetzungen und fachspezifischen Inhalten, die aus funktionalen Tätigkeitsanforderungen heraus begründet werden. Darin zeigt sich der normative Charakter des Konzepts. Das Individuum rückt ins Zentrum des Arbeitsprozesses; es muss nicht nur über anforderungsorientierte Fachkompetenzen, sondern auch über eine bestimmte Persönlichkeitsdisposition verfügen, um die verschiedenen beruflichen Anforderungen meistern zu können.
Validierungs- und Anerkennungsverfahren bewegen sich in der Regel im Spannungsfeld zwischen individueller Kompetenzentwicklung und anforderungsorientierten Kompetenzzielen. Die Verfahren verfolgen gewöhnlich beide Ansätze, wobei im Zentrum die Subjektgebundenheit und die Auseinandersetzung mit der Umwelt stehen. Gemäss Gillen (2006: 98 f.) vollzieht sich Kompetenzentwicklung nach folgenden Leitkriterien:
•gebunden an das Subjekt mit dem Ziel der Handlungsfähigkeit,
•im Rahmen eines lebensbegleitenden Prozesses,
•durch die Bewältigung von konkreten Handlungsanforderungen,
•im Austausch mit anderen und in der zwischenmenschlichen Interaktion,
•durch die Verarbeitung von bereits gemachten Erfahrungen,
•durch Reflexion insbesondere bei Störungen im Handlungsvollzug.
Personen, die ein Anerkennungs- oder Validierungsverfahren anstreben, haben gewöhnlich die meisten Kompetenzentwicklungsprozesse bereits durchlaufen – wobei sie ihre Kompetenzen nicht in formalen Lehr-Lern-Arrangements erworben haben, sondern das Lernen mehr oder weniger unbewusst stattfand. Solche Lernprozesse vollziehen sich beispielsweise im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit, sodass nach einigen Jahren Berufserfahrung aufgrund der dadurch entwickelten beruflichen Handlungskompetenzen über den Weg der Validierung ein Zertifikat erworben werden kann. Gerade in Bezug auf die unbewusste Kompetenzentwicklung spielen die Betriebe eine entscheidende Rolle. Arbeitstätigkeiten, die vornehmlich auf die Bewältigung von routinierten Abläufen ausgerichtet sind, sind wenig lernintensiv und hinsichtlich der beruflichen Kompetenzentwicklung kaum hilfreich. Ganzheitliche und komplexe Aufgabenstellungen dagegen, die immer wieder neue Herangehensweisen erfordern und entsprechend zu Herausforderungen werden, enthalten für die Herausbildung umfassender beruflicher Handlungsfähigkeit weit mehr Potenzial (Kaufhold 2006). Allerdings deutet sich durch diese unterschiedlichen Arbeits- und Lernumgebungen eine Chancenungleichheit an, die sich in Validierungs- und Anerkennungsverfahren manifestiert. Im Verfahren begünstigt werden all jene, die herausfordernde Tätigkeiten verrichten können. Dagegen sind Arbeitnehmende benachteiligt, die ausschliesslich in routinierte Abläufe eingebunden sind. Ihre Kompetenzpalette kann sich dadurch nicht erweitern, was sich auf die Verfahren nachteilig auswirkt. Die Möglichkeiten und Chancen, ein Validierungs- oder Anerkennungsverfahren in Angriff zu nehmen und es erfolgreich zu durchlaufen, sind demnach eng verbunden mit der Ausgestaltung des Arbeitsplatzes und den Lernmöglichkeiten, die dieser bietet.
Sofern die Konzeption von Validierungs- und Anerkennungsverfahren auf Kompetenzprofilen basieren soll, muss sie sich mit dem Kompetenzdiskurs auseinandersetzen. Unabhängig davon, welches Lehr-Lern-Bewusstsein hinter dem Kompetenzbegriff steckt und ob Kompetenz als Ausdruck von Persönlichkeitsdispositionen oder im Hinblick auf unternehmerische Verwertbarkeit verstanden wird, vereint das Kompetenzverständnis aus dem Blickwinkel der unterschiedlichen Fachbezüge vier Kernelemente, die sich in den vergangenen Jahren durchgesetzt haben und mehrheitlich akzeptiert werden (Kaufhold 2006: 22 ff.):
Handlungsbezug: Kompetenzen sind immer als Voraussetzungen für das Handeln zu verstehen. Daraus ergibt sich, dass sie erst in konkreten Handlungen, also in der Performanz sichtbar werden. Kompetenzen können entsprechend nur über den Handlungsvollzug erfasst werden, wobei die Handlung den Ausgangspunkt bildet, um aus ihr heraus die sich dahinter manifestierende Kompetenz interpretativ zu erschliessen.
Situations- und Kontextbezug: Ob in einer konkreten Situation Kompetenzen oder bestimmte Kompetenzdimensionen erforderlich sind, bedingt die subjektive Konstruktionsleistung der jeweiligen Akteure. So sind Handlungsvollzüge denkbar, in denen das Individuum keine Kompetenzen aktivieren muss. Für die Entwicklung von Kompetenzerfassungsmethoden ist es deshalb wichtig, die Situationen exakt zu beschreiben, um sie in den jeweiligen Kontext einordnen zu können.
Subjektivität/Subjektgebundenheit: Kompetenzen sind an das Subjekt gebunden. In ihrer Summe handelt es sich um Persönlichkeitsmerkmale, die in einzelnen Kategorien offenbaren, was Menschen tun, nicht aber, was von ihnen verlangt werden könnte. Dementsprechend können Kompetenzen auch nicht mit vollständig objektiven Leistungsparametern geprüft werden.
Veränderbarkeit: Kompetenzen sind personengebundene Kategorien, die keine Konstanten sind, sondern sich im Laufe der biografischen Entwicklung, insbesondere bei beruflichen Sozialisationsprozessen, herausbilden und verändern. Aufgrund fehlender Entwicklungsmöglichkeiten ist auch ein Kompetenzverlust denkbar.
Kompetenzen sind demnach immer ans Subjekt gebunden und werden in konkreten, herausfordernden und durch das Subjekt definierten Situationen sichtbar (Performanz), in denen sie sich gleichzeitig fortentwickeln. Für die Ausgestaltung von Anerkennungs- und Validierungsverfahren besteht die Konsequenz nun darin, dass diese Verfahren individuell zugeschnitten sein und sich auf reale Handlungssituationen beziehen müssen. Die Überprüfung der Kompetenzen in Handlungssituationen ist mit objektiven und generalisierenden Parametern meist nicht möglich, sondern bedarf der jeweiligen Situation angepasster Formen. Dieser Aspekt ist besonders heikel, vor allem wenn davon ausgegangen werden muss, dass Beurteilungs- und Bewertungsverfahren die Persönlichkeitsdisposition bilanzieren sollen. Grundsätzlich stellen sich in diesem Zusammenhang Fragen nach dem Detailierungsgrad und dem Umfang des Kompetenzkatalogs sowie nach den Kriterien einer Beurteilung. Gerade in Bezug auf das Erfordernis der individuellen Ausgestaltung von Validierungs- und Anerkennungsverfahren hat dieser Aspekt besondere Brisanz. In aller Regel weicht die Praxis von diesen Leitkriterien ab. Individuell ausgerichtete Verfahren sind allein schon aufgrund des hohen Aufwands nur in seltenen Fällen möglich. Darüber hinaus lässt eine nach individuellen Massstäben konzipierte Sichtbarmachung von Kompetenzen die Anforderungsseite unberücksichtigt, sodass dem Anspruch nach Verwertung der individuellen Persönlichkeitsdisposition nicht nachgekommen werden kann. Gemäss vorgegebenem und verbindlichem Kompetenzprofil muss aber zwingend eine definierte Anzahl an Kompetenzen vorhanden oder zumindest teilweise vorhanden sein. Darüber hinaus muss festgelegt werden, welche Kompetenzen, wie viele und allenfalls welche Kompetenzstufen erreicht sein müssen, damit eine Validierung oder eine Anerkennung erfolgen kann. Sind diese Aspekte, oder zumindest einige Facetten davon, nicht festgelegt, sind Validierungs- und Anerkennungsverfahren in der Regel nicht möglich.
2.4 Ökonomische Bezüge
Während die Darstellung und Diskussion der theoretischen Bezüge in den vorangehenden Kapiteln dazu gedient hat, Validierungs- und Anerkennungsverfahren in verschiedenen Theoriesträngen zu verorten, soll mit der Betrachtung von vergangenen und aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen und Umwälzungen aufgezeigt werden, vor welchen ökonomischen und sozialpolitischen Hintergründen diese Verfahren entstanden sind. Diese Ausführungen beziehen sich in erster Linie auf das Validierungsverfahren in der beruflichen Grundbildung, weil die Notwendigkeit der Validierung informell erworbener Kompetenzen gerade für Menschen ohne diese Bildung besonders deutlich wird. Im Prinzip könnte auch mit der Validierung in der Erwachsenenbildung argumentiert werden, allerdings hat dieses Verfahren einen etwas anderen Entstehungszusammenhang, es wurde vor allem durch die Berufsverbände initiiert und ist weniger das Resultat des sozialen Wandels als vielmehr des Bestrebens, die Erwachsenenbildung als pädagogische Disziplin zu professionalisieren. Eine ähnliche Folie wie dem Validierungsverfahren in der beruflichen Grundbildung liegt auch den Verfahren in der höheren Berufsbildung zugrunde, jedoch handelt es sich dort strenggenommen nicht um Validierungs-, sondern um Qualifikationsverfahren, die berufsspezifisch ausgestaltet sind und unter Umständen Ähnlichkeiten mit beispielsweise dossierbasierten Validierungsverfahren aufweisen können.
Das Validierungsverfahren in der beruflichen Grundbildung ist das wohl bekannteste und am weitesten entwickelte Verfahren, es wird im Vergleich mit andern auch mit Abstand von den meisten Personen durchlaufen. Es wurde im Anschluss an die Einführung des neuen Bundesgesetzes über die Berufsbildung (BBG) von 2002 konzeptioniert. Das Verfahren selbst ist allerdings nur einer von vier Wegen, die ausserhalb der klassischen Grundbildung zu einem eidgenössisch anerkannten Berufsabschluss führen. Berufsabschlüsse können auch durch reguläre und verkürzte Berufslehren sowie durch einen direkten Zugang zur Berufsabschlussprüfung erworben werden (vgl. Kap. 8.1). Diese drei alternativen Wege haben bereits eine lange Tradition; bekannt wurden sie aber erst in den vergangenen Jahren unter der Bezeichnung «Berufsabschlüsse für Erwachsene», worunter auch die Validierungsverfahren in der beruflichen Grundbildung zu subsumieren sind. So gesehen, beziehen sich die Erläuterungen in diesem wie auch im nachfolgenden Kapitel sowohl auf das Validierungsverfahren als auch auf die anderen drei Wege, die zu einem Berufsabschluss im Erwachsenenalter führen.
Seit einigen Jahren hat die Schweizer Wirtschaft zusehends Mühe, hochqualifizierte Fachkräfte zu rekrutieren. Davon besonders betroffen ist der MINT-Bereich. Gemäss einer im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung und Forschung SBF erstellten Studie des Büro Bass (Gehrig/Gardiol/Schaerrer 2010) blieb in diesem Feld Ende 2009 fast jede zehnte Stelle unbesetzt. Die Situation hat sich in den darauffolgenden Jahren auch in anderen Beschäftigungsbereichen zugespitzt. Dem Schweizer Arbeitsmarkt werden bis im Jahr 2030 insgesamt eine halbe Million Arbeitskräfte fehlen (Schweizer Monat 2017). Davon betroffen werden alle Branchen sein, wobei sich bereits in den kommenden zehn Jahren ein gravierender Mangel an Personal bei den Ingenieuren und den Lehrpersonen einstellen wird. Eine Unternehmensbefragung durch PricewaterhouseCoopers (PwC), an der 1100 Human-Resources-(HR-)Führungskräfte in vierzehn europäischen Ländern und in den USA beteiligt waren, kommt zudem zum Schluss, dass der Mangel an Fachkräften «in der Schweiz, den USA und Europa zu den grössten Herausforderungen im HR-Bereich» gehören wird (PwC 2011).
Kägi, Sheldon und Braun (2009) regten in ihrer Analyse zur Entschärfung des Fachkräftemangels an, die offenen Stellen weiterhin mit Fachkräften aus dem Ausland zu besetzen. Eine solche Massnahme könne den Fachkräftemangel wesentlich schneller, kostengünstiger und marktstabilisierender bereinigen als der Versuch, mehr Personen mit Wohnsitz in der Schweiz auszubilden. Der Bundesrat hat sich im Mai 2011 jedoch gegen diese Haltung entschieden und langfristige Massnahmen gegen den Fachkräftemangel angekündigt. Erklärtes Ziel dieser bundesrätlichen Initiative ist, «dass Schweizer Unternehmen künftig vermehrt gut ausgebildete Mitarbeiter im Inland rekrutieren können» (NZZ 2011). In seinem Grundlagenbericht zur Fachkräftesituation in der Schweiz (EVD 2011) argumentierte der Bundesrat dahingehend, dass sich aufgrund des demografischen Wandels der Fachkräftemangel in ganz Europa verschärfen und die Rekrutierung von Fachkräften selbst auf dem europäischen Markt schwieriger werden würde. Der Bundesrat erachtete es als zu riskant, die zunehmende Fachkräftenachfrage durch Zuwanderung befriedigen zu wollen, da andere Länder in Europa mit ähnlichen Schwierigkeiten konfrontiert sind und Massnahmen ergreifen oder bereits ergriffen haben, um ihre Fachkräfte im eigenen Land zu behalten. Als Beispiele für solche Massnahmen, wie sie in Deutschland initiiert wurden, sind hier zu nennen: die Förderung grosser Talente durch Exzellenzinitiativen, die Erhöhung der Professorenlöhne und die Einführung von Rückkehrprämien (Die Zeit 2011).
Der Bundesrat hat die Fachkräfteinitiative (FKI) im Mai 2011 also mit dem Ziel lanciert, das inländische Potenzial an Fachkräften verstärkt auszuschöpfen. Am 21. Mai 2013 diskutierten Bund, Kantone und Sozialpartner die vorgeschlagenen Massnahmen (WBF 2013a, WBF 2013b). Beschlossen wurden Schritte zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Schaffung guter Voraussetzungen zur Erwerbstätigkeit bis zur Pensionierung sowie Innovationen zur Entschärfung der Fachkräfteknappheit. Eine dieser Innovationen sieht die Höherqualifizierung geeigneter Arbeitskräfte entsprechend den Bedürfnissen der Arbeitswelt vor. In der Analyse zu dieser Massnahme führte der Bund als wichtigen Aspekt das lebenslange Lernen im Sinne von biografiebestimmenden Anpassungsleistungen an. Die Fachkräfteinitiative plant deshalb unter anderem die Förderung und Stärkung der vier Wege, auf denen ein Berufsabschluss im Erwachsenenalter erworben werden kann. Darüber hinaus unterstützen Bund und Kantone die Etablierung der Anrechenbarkeit von Bildungsleistungen an formale Abschlüsse im gesamten Bildungssystem. Schliesslich prüft der Bund, wie der Zugang zu Informationen für die Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen verbessert werden kann. Nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative am 9. Februar 2014 durch das Volk wurde der Berufsabschluss für Erwachsene und die berufliche Mobilität zu einem Handlungsschwerpunkt erklärt (SBFI 2014a). Bereits bestehende Massnahmen gegen den Fachkräftemangel wurden auf einer Website aufgelistet. Darunter finden sich auch einige im Bereich Berufsabschluss für Erwachsene im Allgemeinen sowie zu Validierungs- und Anerkennungsverfahren im Speziellen.[3]
Die Fachkräfteinitiative soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass damit in erster Linie der Bedarf an Hochqualifizierten mit Abschluss auf der Tertiärstufe gedeckt werden soll. Grundvoraussetzung, dass dieses Ziel erreicht werden kann, ist eine eidgenössisch anerkannte Erstausbildung: Erst mit einem Abschluss auf der Sekundarstufe II (berufliche Grundbildung oder Mittelschule) wird es möglich, Aus- und Weiterbildungen zu besuchen, die zu einer Höherqualifizierung auf der Tertiärstufe führen. Deshalb ist es notwendig, Jugendlichen eine nachobligatorische Ausbildung zu ermöglichen beziehungsweise sie dazu aufzufordern und dabei zu unterstützen. Gleiches gilt für die Berufsausbildung für Erwachsene. Für Letztere dürften die Hürden einer zusätzlichen Aus- oder Weiterbildung insbesondere auf dem Niveau höhere Berufsbildung wesentlich höher sein als für junge Absolventinnen und Absolventen einer beruflichen Grundbildung. Dennoch zeigen neuste Daten, dass motivierte erwachsene Ausbildungsabgängerinnen und -abgänger – wenn auch ihre absolute Zahl noch klein ist – willens sind, ihre durch die berufliche Grundbildung lancierte Karriere weiterzuführen (Schmid/Schmidlin 2018). Aus der Perspektive der Arbeitgebenden besteht allerdings kein Bedarf nach noch mehr Abschlüssen Erwachsener auf der Stufe der beruflichen Grundbildung. Ihrer Meinung kann der Fachkräftemangel im Tertiär- und Führungsbereich durch die Suche auf dem Arbeitsmarkt getilgt werden. Einen direkten Zusammenhang zwischen der Deckung des Fachkräftemangels und der Förderung der beruflichen Grundbildung für Erwachsene können sie nicht ausmachen (Tsandev et al. 2017: 49).
Die sehr praxisorientiert ausgerichtete Fachkräfteinitiative entspricht in ihren Grundgedanken der Leitidee des lebenslangen Lernens sowie dem aktuellen Kompetenzdiskurs. Einerseits forciert die Initiative individuelle Anpassung an die Vorgaben der Wirtschaft zur besseren Leistungsfähigkeit des nationalen Wirtschaftsraums, andererseits nimmt sie Bezug auf individuelle Kompetenzentwicklungsmöglichkeiten in verschiedenen Tätigkeits- und Lebensphasen sowie in formalen, non-formalen und informellen Kontexten. Validierungs- und Anrechnungsverfahren passen entsprechend exakt ins Bild dieser Initiative und könnten einen Beitrag zur Reduzierung des Fachkräftemangels leisten. Spezifische Aufmerksamkeit oder eine gezielte Förderung durch den Ausbau und die Bekanntmachung von weiteren Verfahren insbesondere in der beruflichen Grundbildung erhalten sie im Zuge der Diskussion rund um den Fachkräftemangel jedoch nicht.