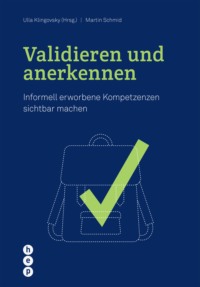Kitabı oku: «Validieren und anerkennen (E-Book)», sayfa 5
2.5 Sozialpolitische Bezüge
Im Folgenden soll für die Schweiz dargelegt werden, wie viele Personen und welche Personengruppen von Ausbildungslosigkeit betroffen sind, welche Auswirkungen diese Ausbildungslosigkeit auf das einzelne Individuum haben kann und welchen Beitrag Validierungs- und Anerkennungsverfahren zur Bekämpfung von sozialen Problemlagen, wie sie durch Ausbildungslosigkeit hervorgerufen werden, leisten können.
Der Schweizer Arbeitsmarkt zählt zu jenen Arbeitsmärkten in Europa, die viele Stellen für qualifizierte und hochqualifizierte Fachkräfte anbieten, aber nur wenige Arbeitsplätze für Geringqualifizierte. Gesamtschweizerisch hat sich die Zahl der Arbeitsplätze mit niedrigen Qualifikationsanforderungen seit 2006 um 9 Prozent verringert. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Arbeitsplätze mit hohen Qualifikationsanforderungen, die sich an Erwerbspersonen mit einem Tertiärabschluss richten, um 54 Prozent gestiegen (SAKE[4] 2015). In der gegenwärtigen wissenschaftlichen und bildungspolitischen Diskussion steht ausser Zweifel, dass sich diese Schere weiter öffnen wird: Die tätigkeitsbezogenen Profile mit komplexen Anforderungen werden weiter zunehmen und Beschäftigungsmöglichkeiten für geringqualifizierte Arbeitskräfte werden dagegen weiter zurückgehen (Spöttl/Windelband 2016; Botthof 2015). Die Geringqualifizierten sind die Verlierer dieses Prozesses, da sie den wachsenden Anforderungen der Betriebe nicht mehr gerecht werden können und deshalb häufiger aus dem Erwerbsleben ausgeschieden werden (Bogai/Buch/Seibert 2014).
Gemäss der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) verfügten in der Schweiz im Jahr 2015 rund 470 000 Erwerbspersonen[5] im Alter von 25 bis 64 Jahren über keinen Abschluss auf Sekundarstufe II. Dies entspricht 12 Prozent aller Erwerbspersonen in diesem Altersspektrum. Die Zahl der Frauen und Männer ohne qualifizierten Abschluss ist bei beiden Geschlechtern etwa gleich gross. Ein Unterschied zeigt sich hingegen bei schweizerischen und ausländischen Erwerbspersonen. 2015 verfügten 25 Prozent der Letzeren über keinen nachobligatorischen Bildungsabschluss, von den Schweizer Erwerbspersonen können dagegen 7 Prozent keinen Sek-II-Abschluss nachweisen.
Geringqualifizierte Erwerbstätige sind grösstenteils in Hilfs- oder Anlerntätigkeiten und in Niedriglohnbranchen wie der Gastronomie, Reinigung, Industrie und im Bau tätig. So verfügte im Jahr 2013 in der Gastronomie jede dritte Arbeitskraft über keinen Abschluss auf Sekundarstufe II, in der Baubranche jede vierte und im Bereich Immobilien und sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 22 Prozent. Mit 5 Prozent verzeichnen die Kredit- und Versicherungsbranche sowie die Wirtschaftsabschnitte Information und Kommunikation die tiefsten Anteile niedrigqualifizierter Arbeitskräfte. In der öffentlichen Verwaltung sind es 6 Prozent, in Erziehung und Unterricht ebenfalls. Diese Wirtschaftsbereiche gelten als relativ wissensintensiv und erfordern daher in stärkerem Masse einen qualifizierten Berufsabschluss (SAKE 2013[6]).
Ausbildungslosigkeit kann sich als schwere Hypothek erweisen. So zeigt ein weiterer Blick in die SAKE-Daten, dass Personen, die nur einen Abschluss auf der Sekundarstufe I vorweisen können, einem erhöhten Erwerbslosenrisiko ausgesetzt sind. Die Entwicklung der letzten Jahre macht deutlich, dass die Erwerbslosenquote der Ausbildungslosen seit 2011 stärker ansteigt als jene der Personen mit Abschluss auf Tertiärstufe. Damit wird die Kluft der Erwerbslosigkeit zwischen Ausbildungslosen und gut Ausgebildeten immer grösser. Aufgegliedert nach Berufshauptgruppen gemäss ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations), heisst das, dass die Erwerbslosenquote unter den Hilfsarbeitskräften mit 8,5 Prozent überdurchschnittlich hoch liegt. Im Vergleich dazu beträgt sie beispielsweise unter Führungskräften 3,5 Prozent und unter akademischen Berufsleuten 2,5 Prozent. Gemessen an Wirtschaftsabschnitten (NOGA-Klassifikation), verfügt das Gastgewerbe mit 8,9 Prozent über am meisten Erwerbslose. In dieser Branche dürften viele unausgebildete Personen beschäftigt sein. Im Bereich Erziehung und Unterricht, in dem auf Personal mit Tertiärabschluss zurückgegriffen werden muss, liegt die Erwerbslosigkeit bei 1,8 Prozent (BFS 2016a).[7]
Personen ohne nachobligatorische Schulbildung sind, neben einem erhöhten Erwerbslosenrisiko, auch einem erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt.[8] Die Armutsquote ist in dieser Population überdurchschnittlich hoch, im Jahr 2014 lag sie bei 12,6 Prozent. Zum Vergleich: Die Armutsquote innerhalb der Schweizer Gesamtbevölkerung lag im selben Jahr bei 6,6 Prozent. Dies entspricht in absoluten Zahlen 533 000 Personen. Neben der Ausbildungslosigkeit haben allerdings noch weitere Faktoren einen Einfluss auf Armut, beispielsweise die Herkunft oder die Haushaltsform (BFS 2016b; Schuwey/Knöpfel 2014: 68 f.).
Im Jahr 2014 waren rund 123 000 Personen von Armut betroffen, obwohl sie erwerbstätig waren. Dies entspricht 3,3 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung (BFS 2016b). Somit ist fast ein Viertel der von Armut heimgesuchten Personen erwerbstätig. Diese Working-Poor weisen mehrheitlich dieselben Merkmale auf, wie sie für alle von Armut heimgesuchten Personen gelten. Zumindest was die Bildung betrifft, könnte das Armutsrisiko für die Personengruppe der Ausbildungslosen vermutlich mit einer abgeschlossenen Ausbildung deutlich reduziert werden, da der Bruttolohn von Personen mit einer abgeschlossenen Berufsbildung um fast 1200 Franken höher liegt als von Personen ohne Berufsbildung (Maurer/Wettstein/Neuhaus 2016: 39). Zur Bekämpfung von Armut wurde deshalb im Jahr 2013 vom Bund ein nationales Programm lanciert. Das Programm sieht verschiedene Massnahmen vor, so unter anderem auch im Bereich der Bildung, die gemäss dem Verständnis des Programms bis ins Erwachsenenalter reicht. Mithilfe des Programms soll auf der Grundlage einer nachgeholten Bildung ein erfolgreicher Einstieg und ein nachhaltiger Verbleib in der Arbeitswelt ermöglicht werden.[9]
Unzweifelhaft erhöht das Fehlen einer beruflichen Grundbildung das Risiko auf Erwerbslosigkeit und auf Armut. Letztlich ist jedoch zu fragen, ob alle 470 000 Erwerbspersonen im Alter von 25 bis 64 Jahren, die derzeit über keinen Abschluss auf der Sekundarstufe II verfügen, für ein Validierungsverfahren auch tatsächlich infrage kommen würden. Selbst bei einer zusätzlichen Eingrenzung des absoluten Personenkreises ist unsicher, ob die Zielgruppe hinreichend erfasst wird: So geht TravailSuisse (2014) davon aus, dass zwischen 52 000 und 93 000 Personen die Voraussetzungen für ein Validierungsverfahren erfüllen. Der Verband begründet diese Zahlen mit der Eingrenzung der Altersgruppe auf die 30- bis 49-Jährigen mit fünf Jahren Berufserfahrung. Diese Altersgruppe würde sich grundsätzlich am besten eignen, denn ab dem Alter von 50 Jahren gestalte sich ein Berufswechsel zunehmend schwieriger (vgl. auch Fritschi et al. 2012). Dennoch scheinen auch diese Zahlen hoch angesetzt zu sein, denn selbst unter diesen Personen sind viele mit ausländischer Staatsbürgerschaft, die über mangelhafte Kenntnisse in einer der Landesprachen verfügen. Ausserdem sind in vielen Berufen, die handwerklich ausgerichtet sind und wenig mündliche und schriftliche Sprachkompetenzen erfordern, überproportional viele Personen ohne Berufsabschluss beschäftigt. Die Validierungsverfahren der beruflichen Grundbildung setzen aber ein Mindestmass an Kompetenzen in einer Landessprache oder in Englisch voraus, und zwar insbesondere in Bezug auf die Schriftlichkeit, da die beruflichen Kompetenzen in einer eigenhändig verfassten Selbstbeurteilung beschrieben und plausibilisiert werden müssen. Dies dürfte gerade vielen zugezogenen Personen, Arbeitskräften in handwerklich ausgerichteten Branchen sowie allgemein Schreibungewohnten schwerfallen. Es ist deshalb zu vermuten, dass ein wesentlich geringerer Anteil dieser Alterspopulation für ein Validierungsverfahren infrage kommt. Allenfalls gelingt es aber, diese Personen einem anderen Weg der beruflichen Grundbildung zuzuführen, der weniger schriftlastig ist und ebenfalls zu einem EBA oder zu einem EZF führt (vgl. Kap. 8.1). Unabhängig von der beruflichen Grundbildung, ist der explosionsartige Ausbau an Aus- und Weiterbildungsformaten unterschiedlichster Art ein Zeichen dafür, dass Bildungszertifikate steigende Bedeutung bekommen. Ausgeschlossen von vielen beruflichen Aus- und Weiterbildungsangeboten sind aber in der Regel Personen, die über keine berufliche Grundbildung verfügen.
Validierungs- und Anerkennungsverfahren könnten durchaus als Mittel zur Armutsbekämpfung verstanden werden, vermindert ein eidgenössisch anerkanntes Zertifikat die Armutsgefährdung doch erheblich, indem einerseits das Erwerbslosenrisiko reduziert und die Chance auf einen Wiedereinstieg im Falle einer Arbeitslosigkeit erhöht wird. Darüber hinaus ebnet ein eidgenössisches Zertifikat den Weg für eine berufliche Karriere. Denkbar sind Validierungs- und Anerkennungsverfahren aber auch zur Bekämpfung von Armut in anderen Bereichen, in denen nicht zwingend ein eidgenössisches Zertifikat ausgestellt werden müsste. Dafür kämen verschiedene von Armut betroffene Zielgruppen infrage, die sich im Laufe ihres bisherigen Lebenswegs Kompetenzen auf informellem Wege angeeignet haben. Zu denken ist etwa an Personen, die von Armut in erhöhtem Mass betroffen sind, wie Migrantinnen und Migranten, Alleinerziehende oder Eltern mit vielen Kindern. Für sie könnten spezifische Verfahren konzipiert werden, die ihre Kompetenzen sichtbar machen, beispielsweise in den Bereichen Informatik, Betreuung, Projektmanagement, Kulturwissen aus dem Herkunftsland, Kenntnisse und Erfahrungen als Migrantin oder Migrant in der Schweiz usw. Dazu müssten sich aber bisherige Validierungs- und Anerkennungsverfahren zunächst einmal besser etablieren. Zudem müssten für die Entwicklung neuer Verfahren mit bislang noch nicht berücksichtigten Zielgruppen Methoden entworfen werden, die deren spezifischen Eigenheiten einbeziehen, sodass keine Ausschlussmechanismen produziert werden, die unüberwindbare Hindernisse darstellen, wie dies bei der sehr sprachbetonten Validierung in der beruflichen Grundbildung der Fall ist.
2.6 Der Qualifikationsrahmen des Berufsbildungssystems
Das Bildungssystem in der Schweiz war in den vergangenen Jahren einem unvergleichlichen Entwicklungs- und Veränderungsschub ausgesetzt, dessen Ende derzeit noch nicht absehbar ist. Auch ist ungewiss, in welche Richtung sich die Bildung noch bewegen wird. Ausschlaggebend für diese Veränderungen waren und sind unter anderem der technologische Wandel sowie die fortschreitende Ökonomisierung, deren Credo der Profitmaximierung eine Leistungsgesellschaft formt. Nicht zuletzt werden diese Entwicklungen mit den theoretischen Strängen des lebenslangen Lernens sowie der Kompetenzorientierung begründet. Dabei zeichnet sich insgesamt eine Tendenz ab, dass sich das Bildungssystem von der ursprünglichen Grobstruktur mit der traditionellen Unterteilung in Primarschule, Sekundarschule, Berufslehre, Gymnasium, hin zu einer ausdifferenzierten Feinstruktur entwickelt hat. Dabei steht allerdings weniger die eigentliche Bildungssystematik im Vordergrund, sondern vielmehr die kleinteilige Zerstückelung von Wissen (Kraus 2001: 107) in neue Gefässe wie Kompetenzen, Niveaustufen, Module, Zertifikate usw. Zu beobachten ist diese Entwicklung allerorts, am prominentesten wohl aber im Lehrplan 21, der die gesamten Lerninhalte in einzelne Kompetenzformulierungen verpackt. Grundsätzlich ist ein sich in diese Richtung entwickelndes Bildungsverständnis für Validierungs- und Anerkennungsverfahren zuträglich, da diese Verfahren in der Regel in hohem Masse strukturiert sind und nur dann erfolgreich sein können, wenn die vorgegebenen Strukturen möglichst klein und kompakt und dadurch im besten Falle auch messbar sind. Validierungs- und Anerkennungsverfahren sind aber im Prinzip nur Profiteure des sich in dieser Weise entwickelnden Systems, sie haben letztlich nur einen geringfügigen Einfluss auf die Gestaltung und die Ausgestaltung der Bildungssystematik.
Ähnlich wie in der Volksschule werden auch in der Berufsbildung Kompetenzen formuliert, die die Auszubildenden am Schluss ihrer Ausbildungszeit erreicht haben müssen. Diese bilden dann zusammen mit den Bestehensregeln die Grundlage für Validierungs- und Anerkennungsverfahren (vgl. Kap. 8.2). Eine weitere Strukturierung der Berufsbildung ist durch die Schaffung eines nationalen Qualifikationsrahmens zu verzeichnen. Seine Entstehung ist vor allem im Kontext internationaler Entwicklungen zu sehen: Das schweizerische Berufsbildungssystem besteht unter anderem aus der beruflichen Grundbildung, die im Anschluss an die obligatorische Schule absolviert wird, sowie aus der höheren Berufsbildung, die an die berufliche Grundbildung anschliesst. Dieses System ist im Ausland wenig bekannt, was dazu führen kann, dass Personen mit einem Schweizer Bildungsabschluss im Ausland oder bei in der Schweiz ansässigen ausländischen Unternehmen bei der Stellensuche benachteiligt werden. Um die Vergleichbarkeit von Schweizer Bildungsabschlüssen mit beruflichen Abschlüssen anderer europäischer Länder zu gewährleisten, wurde die Verordnung über den nationalen Qualifikationsrahmen für Abschlüsse der Berufsbildung (V-NQR-BB) geschaffen. Diese stützt sich auf Art. 34 Abs. 2 sowie auf Art. 65 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung (BBG). Die V-NQR-BB trat am 1. Oktober 2014 in Kraft. Gemäss den Ausführungen des SBFI[10] ist der Nutzen dieses neuen Qualifikationsrahmens vielseitig: Absolventinnen und Absolventen können ihre berufliche Mobilität sowie ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen, denn die Bildungsabschlüsse sind nun international vergleichbar, und die berufsspezifischen Kompetenzen werden besser beschrieben. Darüber korrespondieren die Abschlüsse durch aufgezeigte Gleichwertigkeit auch mit anderen Bildungsbereichen ausserhalb der Berufsbildung. Gleiches gilt für Unternehmen: Ihnen fällt durch die bessere Vergleichbarkeit die Rekrutierung von Arbeitskräften sowohl im Inland als auch im Ausland leichter, denn die Bildungsabschlüsse sind mit zusätzlichen Informationen versehen, die in den herkömmlichen Zertifikaten noch nicht enthalten waren. Ausserdem können die Unternehmen diese Zusatzinformationen als unternehmerische Hilfsmittel verwenden. Schliesslich haben gemäss SBFI auch die Trägerschaften einen Nutzen, denn der Berufsbildungsabschluss wird gestärkt und attraktiver. Ferner kann das Berufsfeld von einer erhöhten Transparenz profitieren, denn der Qualifikationsrahmen kann zur Qualitätssicherung beitragen. Im Grundsatz werden diese Vorzüge mit drei Massnahmen sichergestellt:[11]
•Verordnung über den nationaler Qualifikationsrahmen Berufsbildung V-NQR-BB: Der NQR-BB ist ein Raster, das aus acht Niveaus besteht. Diese acht Niveaus setzen sich je aus den Bereichen Kenntnisse (Wissen und Verstehen), Fertigkeiten (prozedurale und sensomotorische Fertigkeiten) sowie Kompetenzen (berufliche Kompetenzen, Selbst- und Sozialkompetenzen) zusammen. Diese Bereiche werden für jede Niveaustufe beschrieben. Das hierarchisch höher liegende Niveau setzt die Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen der voranstehenden Niveaus voraus. Jeder Schweizer Berufsbildungsabschluss wird einem dieser acht Niveaus zugeordnet. Diese Zuteilung ist nicht personengebunden, sondern bezieht sich ausschliesslich auf den erworbenen Abschluss. Im Grossen und Ganzen hat sich eine Ordnungsstruktur durchgesetzt, die für das eidgenössische Berufsattest EBA eine Einstufung auf Niveau 3 vorsieht, für das eidgenössische Fähigkeitszeugnis EFZ Niveau 4, für den eidgenössischen Fachausweis Niveau 5, für ein Diplom höhere Fachschule HF Niveau 6 und für ein eidgenössisches Diplom ebenfalls Niveau 6[12]. Der NQR-BB wurde in Anlehnung an den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) konzipiert, der ebenfalls als Raster mit mehreren Niveaustufen angelegt ist. Um eine internationale Vergleichbarkeit zu gewährleisten, ist jede Niveaustufe des NQR-BB einem entsprechenden Niveau des EQR zugeordnet. Das europäische Leistungspunktesystem (ECVET), das den technischen Rahmen für die Erfassung von Lernergebnissen ermöglicht, wie auch der Europäische Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung (EQAVET) spielen in der Schweiz (noch) keine Rolle.
•Zeugniserläuterung: Für jeden Abschluss der beruflichen Grundbildung wird eine Zeugniserläuterung erstellt. Diese basiert auf den Bildungsverordnungen, Bildungsplänen und Qualifikationsprofilen und hat den Anspruch, die für Arbeitgebende relevanten Informationen knapp und präzise zusammenzufassen. Darüber hinaus wird das Niveau des Abschlusses gemäss NQR-BB und EQR aufgeführt. Die Zeugniserläuterung enthält keine personenspezifischen Daten.
•Diplomzusatz: Für jeden Abschluss der höheren Berufsbildung wird ein Diplomzusatz abgegeben. Darauf sind der Name, Vorname sowie das Geburtsdatum der Absolventin bzw. des Absolventen vermerkt. Zusätzlich werden das Niveau des Abschlusses gemäss NQR-BB und EQR eingetragen sowie die Kompetenzen beschrieben, über die eine Person mit dem entsprechenden Abschluss verfügt. Diese standardisierten Einträge basieren auf den Rahmenlehrplänen, Prüfungsverordnungen und Wegleitungen. Wie die Zeugniserläuterungen für die berufliche Grundbildung hat auch der Diplomzusatz den Anspruch, diese Dokumente knapp und präzise zusammenzufassen, um Arbeitgebende über den beruflichen Abschluss zu informieren. Auf Gesuchsbasis hat eine Absolventin oder ein Absolvent die Möglichkeit, die nachträgliche Abgabe des Diplomzusatzes zu beantragen – unter der Voraussetzung natürlich, dass die Person berechtigt ist, den entsprechend geschützten Titel zu führen. Dem Gesuch kann in der Regel entsprochen werden, wenn die Grundlagendokumente nach Abgabe des Berufsbildungsabschlusses keine wesentlichen Änderungen erfahren haben oder, falls dies doch der Fall sein sollte, der oder die Antragstellende mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung nachweisen kann.
Validierungs- und Anerkennungsverfahren bedürfen notwendigerweise einer Strukturierung. Ob der NQR-BB dafür taugt, ist fraglich. Derzeit scheint das sogar eher unwahrscheinlich. Einziger Bezugspunkt ist die Abgabe nachträglicher Diplomzusätze auf Antrag, wenn sich der Beruf seit dem Berufsabschluss stark gewandelt hat und die Antragstellenden quasi zur Plausibilisierung ihrer für die neuen Anforderungen notwendigen Kompetenzen fünf Jahre Berufserfahrung vorweisen müssen. Hier ist der Gedanke der Anerkennung verankert, die sich in diesem Fall ausschliesslich auf die berufliche Erfahrung stützt und im unkompliziert ausgehändigten Diplomzusatz zum Ausdruck kommt. Ansonsten ist der NQR-BB zu wenig berufsspezifisch ausgerichtet, er bezieht die Handlungskompetenzen der einzelnen Berufe nur auf einer übergeordneten Ebene ein. Hinzu kommt, dass der NQR-BB die Bereiche Kenntnisse und Fertigkeiten integriert, diese in einem Validierungs- oder Anerkennungsverfahren in der Regel aber nicht enthalten sind, da diese Verfahren fast ausschliesslich auf der Grundlage der theoretischen Kompetenzkonzeption funktionieren. Eine Sichtbarmachung bzw. Bilanzierung der individuellen fachspezifischen Kompetenzen ist mit dem Qualifikationsrahmen nicht möglich. Es fehlen dem NQR-BB die grundlegenden Instrumente, die für ein Validierungs- oder Anerkennungsverfahren nötig wären, nämlich differenzierte Kompetenzprofile sowie die Bestehensregeln (vgl. Kap. 8). Somit kann der NQR-BB im Bereich der Qualifikationen nicht mehr sein als eine Positionsbestimmung die nicht den Anspruch erhebt, individuelle Leistungen oder Kompetenzen auszuweisen, sondern lediglich den Beruf mithilfe verschiedener Instrumente genauer beschreibt. Die Grundlagen für Validierungs- und Anerkennungsverfahren müssen berufsspezifisch ausgerichtet sein und sich an den Kompetenzbegriff anlehnen, um damit die individuelle Leistung vor dem Hintergrund eines Anforderungsprofils bestimmen zu können. Das Nebeneinander des nationalen Qualifikationsrahmens und der Validierungsverfahren in der Schweiz läuft dem europäischen Ansinnen, die nationalen Qualifikationsrahmen ins Zentrum der Validierung von non-formalem und informellem Lernens zu rücken, um dadurch ländervergleichende Verfahren entwickeln zu können, zuwider. Demgemäss sollen die nationalen Qualifikationsrahmen die Grundlage für den Aufbau und die Etablierung von Validierungsverfahren bilden. Besonderes eignen würden sie sich deshalb, weil die Klassifizierung der Qualifikationsniveaus in der Regel in Form von Lernergebnissen beschrieben wird (Cedefop 2009: 34). Im Prinzip war die Schweiz im Vergleich zur europäischen Entwicklung einfach zu schnell. So wurden im Zuge der Erarbeitung der Validierungsverfahren bereits berufsspezifische Handlungskompetenzen formuliert, die nun für die Einstufung der Berufe in die verschiedenen Niveaus des Qualifikationsrahmens gebraucht werden können. Diese Handlungskompetenzen dienen aber schon seit einiger Zeit auch der Validierung von Bildungsleistungen. Der NQR-BB dürfte deshalb in Bezug auf die Validierung kaum Bedeutung haben, da die berufliche Grundbildung bereits vor der Erarbeitung des nationalen Qualifikationsrahmens über ein gut funktionierendes Validierungssystem verfügt hat, das in vielen Ländern Europas in dieser Form (noch) nicht existiert und erst noch erarbeitet werden muss. So gesehen, kann der Einbezug nationaler Qualifikationsrahmen in anderen europäischen Ländern für die Erarbeitung von Validierungsverfahren tatsächlich sehr nützlich sein, für die Schweiz bringt er momentan jedoch keinen Gewinn.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.