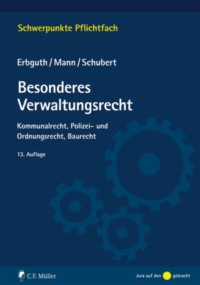Kitabı oku: «Besonderes Verwaltungsrecht», sayfa 11
Teil I Kommunalrecht › § 3 Die Gemeindebevölkerung (Bürger und Einwohner)
§ 3 Die Gemeindebevölkerung (Bürger und Einwohner)
Inhaltsverzeichnis
I. Die gesetzliche Differenzierung zwischen Bürgern und Einwohnern
II. Konsequenzen
III. Verstärkung plebiszitärer Elemente
98
Fall 3: „Kommunalwahlrecht für Ausländer?“
Nachdem Sachverständige sich in einem Memorandum dafür ausgesprochen hatten, zur Integrationsförderung auch Ausländern, die nicht Unionsbürger sind, nach einem Aufenthalt von acht bis zehn Jahren in der Bundesrepublik das kommunale Wahlrecht zu gewähren, berät die Landesregierung des Landes L, ob dem Landtag eine entsprechende Änderung des Kommunalwahlgesetzes vorgeschlagen werden soll. Dabei werden in der Ministerrunde neben politischen Gegenargumenten auch verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. Ein Teil der Kabinettsmitglieder meint, mit einer Änderung des Kommunalwahlgesetzes allein sei es nicht getan, vielmehr müsse zuvor das Grundgesetz (Art. 28 I 2 GG) geändert werden. Der Innenminister ist der Auffassung, dass der Bundesgesetzgeber wegen Art. 79 III GG hierzu überhaupt nicht in der Lage sei, sodass eine Einführung des Kommunalwahlrechts für Ausländer nicht in Frage komme. Wie ist die Rechtslage? Angenommen, der Landtag hätte durch Änderung des Kommunalwahlgesetzes ein aktives Ausländerwahlrecht begründet. Könnte der im Land L wohnende deutsche Staatsbürger D die Rechtmäßigkeit des Kommunalwahlrechts für Ausländer gerichtlich überprüfen lassen? Rn 103
Teil I Kommunalrecht › § 3 Die Gemeindebevölkerung (Bürger und Einwohner) › I. Die gesetzliche Differenzierung zwischen Bürgern und Einwohnern
I. Die gesetzliche Differenzierung zwischen Bürgern und Einwohnern
99
Eine grundsätzliche Differenzierung zwischen dem klassischen Begriff des Bürgers und dem des Einwohners[1] lässt sich schon in der Leitvorstellung der Gemeindeordnungen für die gemeindliche Selbstverwaltung erkennen: Die Förderung des Wohls der Einwohner durch von der Bürgerschaft gewählte Organe, vgl zB § 1 I GO NRW; §§ 1 I, 28 NKomVG.
Dem Bürgerrecht in einer Stadt („Stadtluft macht frei“) kam traditionell große Bedeutung zu. Vgl aus der preuß. Städteordnung vom 19.11.1808 (GS 1822 Anh. S. 324):
„§ 14: Ein Bürger oder Mitglied einer Stadtgemeinde ist der, welcher in einer Stadt das Bürgerrecht besitzt.
§ 15: Das Bürgerrecht besteht in der Befugnis, städtische Gewerbe zu treiben und Grundstücke im städtischen Polizeibezirk der Stadt zu besitzen. Wenn der Bürger stimmfähig ist, erhält er zugleich das Recht, an der Wahl der Stadtverordneten teilzunehmen, zu öffentlichen Stadtämtern wahlfähig zu sein und in deren Besitze die damit verbundene Teilnahme an der öffentlichen Verwaltung nebst Ehrenrechten zu genießen.
§ 16: In jeder Stadt gibt es künftig nur ein Bürgerrecht. Der Unterschied zwischen Groß- und Kleinbürgern und jede ähnliche Abteilung der Bürger in mehrere Ordnungen wird daher hierdurch völlig aufgehoben.
§ 17: Das Bürgerrecht darf niemandem versagt werden, welcher in der Stadt, worin er solches zu erlangen wünscht, sich häuslich niedergelassen hat und von unbescholtenem Wandel ist. …“
Einwohner ist jeder, der in der Gemeinde wohnt[2], Bürger nur, wer zu den Gemeindewahlen wahlberechtigt ist (vgl Art. 15 II bay.GO, § 28 II NKomVG, § 21 II GO NRW, § 13 II KV M-V). Die Wahlberechtigung richtet sich indes nach den Vorschriften des Kommunalwahlrechts[3]. Danach ist gängigerweise das aktive Wahlrecht denjenigen vorbehalten, die am Wahltag Deutsche im Sinne von Art. 116 GG oder Unionsbürger[4] sowie 18 bzw. 16 Jahre alt[5] sind und darüber hinaus eine gewisse Zeit, in der Regel mindestens drei Monate[6], ihren melderechtlichen Wohnsitz (Hauptwohnsitz) in der Gemeinde haben.
100
Das sog. passive Wahlrecht, die Wählbarkeit, richtet sich grundsätzlich nach der Wahlberechtigung (vgl § 49 I NKomVG; § 12 KWG NRW), wobei es insoweit auch in denjenigen Ländern, die mit Blick auf das aktive Wahlrecht das Wahlalter abgesenkt haben, der Vollendung des 18. Lebensjahres bedarf[7]. Für Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes bestehen nicht nur auf staatlicher, sondern auch auf kommunaler Ebene Inkompatibilitätsregelungen (vgl Art. 137 I GG)[8], aus denen sich hier ausnahmsweise zur Sicherung der Integrität der Entscheidungsprozesse (Verhütung von Interessenkonflikten zwischen kommunalem Vertretungsmandat und hauptberuflicher Funktion) auch legitime Wählbarkeitsbeschränkungen ergeben[9].
So ist es nach BVerwGE 117, 11 ff von Verfassung wegen nicht zu beanstanden, wenn ein Landesgesetzgeber die Tätigkeit einer Teilzeitangestellten des die Gemeinde verwaltenden Amtes (dazu oben Rn 27 f) ohne Rücksicht auf die konkret ausgeübte Funktion generell für unvereinbar mit der gleichzeitigen Wahrnehmung eines Mandats in der Gemeindevertretung erklärt.
§ 50 I Nr 7 NKomVG; § 13 I 1 b, d KWG NRW und § 25 I 1 Nr 4 KV M-V; begründen eine Unvereinbarkeit von Amt und Ratsmandat nur für Angestellte und Beamte solcher Behörden, die Aufgaben der allgemeinen Kommunalaufsicht oder – bezogen auf Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (dazu unten Rn 206) – der Sonderaufsicht über die Gemeinden wahrnehmen. Nicht erfasst werden hiervon Bedienstete anderer Behörden, auch wenn diese aufsichtsbehördliche Befugnisse ausüben. Eine über den Wortlaut hinausgehende Auslegung sei weder durch die Entstehungsgeschichte noch durch den Sinn der Inkompatibilitätsbestimmung geboten, so OVG NRW, NWVBl. 2002, 464.
101
Vor allem in den 80er-Jahren war die kommunal- und ausländerpolitische Frage diskutiert worden, ob die Zubilligung eines Kommunalwahlrechts Integrationsbemühungen unterstützen könne. Die Länder Schleswig-Holstein und Hamburg räumten im Jahre 1989 durch entsprechende Wahlrechtsänderungen Ausländern, die sich seit längerer Zeit (fünf bzw acht Jahre) in Deutschland aufhielten und einen bestimmten ausländerrechtlichen Status innehatten, das kommunale Wahlrecht bei Gemeinde- und Kreiswahlen bzw auf Bezirksebene ein.
Nach § 13 II KommVerfDDR sollte sogar schon ein nur zweijähriger Aufenthalt in der Gemeinde ausreichen, um den Status eines Gemeindebürgers und damit zugleich das Wahlrecht zu erlangen.
Art. 28 I 2 GG spricht auch in Bezug auf Kreise und Gemeinden von einer Vertretung des „Volkes“. Gemeint sein kann bei dieser die bundesstaatliche Homogenität sichernden Norm im Einklang mit der Präambel, Art. 1 II, 38 I und 146 GG nur das deutsche Volk. Die Einführung eines Kommunalwahlrechts für Ausländer bedurfte daher einer Änderung des Grundgesetzes (vgl heute Art. 28 I 3 GG[10])[11]. Wegen Verstoßes gegen Art. 28 I und 20 II GG hat das BVerfG die Ausländerwahlgesetze von Schleswig-Holstein und Hamburg dann auch für nichtig erklärt[12].
102
Nicht ausdrücklich geklärt ist bislang freilich, ob nicht einer pauschal formulierten, nicht nur Unionsbürger iSd Art. 28 I 3 GG erfassenden Verfassungsänderung sogar Art. 79 III GG entgegensteht, wonach eine Änderung des Grundgesetzes generell unzulässig ist, durch die in Art. 20 GG niedergelegte „Grundsätze“ berührt werden. Art. 20 GG enthält nämlich in Abs. 1 das allgemeine Demokratiegebot als Verfassungsstrukturprinzip und in Abs. 2 die Spezifizierung, dass alle Staatsgewalt vom „Volke“ ausgeht und in Wahlen vom „Volke“ ausgeübt wird. Das Bundesverfassungsgericht hat aber betont, dass die Gemeinden Staatsgewalt ausüben und sich diese Staatsgewalt – in Homogenität mit Bund und Ländern – von der Gesamtheit der jeweiligen Bürger als dem Volke, von dem alle Staatsgewalt ausgeht, her legitimieren muss[13].
103
Lösungshinweis zu Fall 3 (Rn 98):
Damit sind die entscheidenden Probleme des Ausgangsfalles angesprochen. Die geplante Gesetzesnovellierung ohne Verfassungsänderung wäre unzulässig. Fraglich bleibt, ob eine nicht nur Unionsbürger, sondern Ausländer generell einbeziehende Verfassungsänderung mit Blick auf Art. 79 III GG, der eine Antastung der in Art. 20 GG niedergelegten „Grundsätze“ blockiert, möglich wäre. Dies dürfte angesichts der Aussagen des BVerfG jedoch zu verneinen sein[14].
Die zweite Frage betreffend, könnte zunächst an eine Verfassungsbeschwerde zum BVerfG gegen das Landesgesetz gedacht werden[15], und zwar unter Berufung auf die nach überkommener Ansicht durch Art. 3 GG mitgeschützte[16] Gleichheit und Allgemeinheit der Wahl. Anders aber seit 1998 das BVerfG, das in ausdrücklicher Abkehr von seiner bisherigen Rspr Art. 28 I 2, 38 I 1 GG als speziellere Wahlgleichheitssätze betrachtet und daher bei politischen Wahlen im Verfassungsraum der Länder die Gewährung subjektiven Schutzes des Wahlrechts abschließend den Ländern zuweist[17]. Es erschiene ohnehin zweifelhaft, ob vorliegend wirklich von einer Verletzung subjektiver Rechte des D ausgegangen werden kann, welche gem. Art. 93 I Nr 4a GG, § 90 I BVerfGG unabdingbares Erfordernis für eine erfolgreiche Verfassungsbeschwerde ist.
Sofern das Landesverfassungsrecht eine (Individual-)Verfassungsbeschwerde nicht vorsieht (wie etwa in Nds. und NRW), bietet im Anschluss an die unter den neuen gesetzlichen Bedingungen durchgeführte Kommunalwahl das im Kommunalwahlrecht aller Länder anerkannte Institut der Wahlanfechtung bzw Wahlprüfung gesicherte Kontrollmöglichkeiten[18].
104
Mit Blick auf das Kommunalwahlrecht für Unionsbürger heißt es unmissverständlich in Art. 28 I 3 GG:
„Bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden sind auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzen, nach Maßgabe von Recht der Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt und wählbar.“
Insoweit ist nunmehr in Art. 20 II 2 lit b) AEUV festgesetzt, dass die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger (vgl Art. 20 I AEUV) in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, das aktive und passive Wahlrecht bei den Kommunalwahlen besitzen, wobei für sie dieselben Bedingungen gelten, wie für die Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaats. Demgemäß sehen inzwischen auch alle Kommunalwahlgesetze der Länder ein Wahlrecht für Unionsbürger ausdrücklich vor (vgl § 48 I 1 NKomVG; § 7 KWG NRW; Art. 1 I Nr 1 bay.GLKrWG; § 4 II 1 LKWG M-V).
Teil I Kommunalrecht › § 3 Die Gemeindebevölkerung (Bürger und Einwohner) › II. Konsequenzen
II. Konsequenzen
105
Rechte im Rahmen des sich aus der gemeindlichen Verpflichtung zur Vorhaltung von Einrichtungen der Daseinsvorsorge (vgl unten Rn 235 ff) ergebenden Betreuungsverhältnisses auf gemeindlicher Ebene stehen durchgängig allen Einwohnern zu.
Beispiele:
Anspruch auf Benutzung öff. Einrichtungen (§ 30 I NKomVG; § 8 II GO NRW; Art. 21 I bay.GO; § 14 II KV M-V.;), Pflicht zur gemeindlichen Hilfeleistung bei der Einleitung von Verwaltungsverfahren (§ 37 NKomVG; § 22 I GO NRW – ähnlich § 14 IV KV M-V)[19], Unterrichtungspflicht des Rates (§ 23 GO NRW, § 20 I GO BW) oder des Bürgermeisters (§ 16 I KV M-V; § 28 I KVG LSA)[20], Anspruch eines jeden, sich mit Anregungen oder Beschwerden an den Rat zu wenden (§ 34 NKomVG; § 24 GO NRW; § 14 I KV M-V).
106
Lediglich das Wahlrecht bei den Gemeindewahlen kennzeichnet den Bürger und hebt ihn heute noch[21] hervor. Auch sind nur Bürger zur Übernahme von Ehrenamt und ehrenamtlicher Tätigkeit verpflichtet (vgl Art. 19 I bay.GO; § 19 II KV M-V; § 38 II NKomVG;)[22]. Differenzierter ist die Rechtslage in NRW: Dort können Einwohner zu einer nebenberuflichen vorübergehenden unentgeltlichen Tätigkeit für die Gemeinde verpflichtet werden (ehrenamtliche Tätigkeit), § 28 I GO NRW.
Beispiele für ehrenamtliche Tätigkeit: Heranziehung zur Pflichtfeuerwehr (§ 14 II BHKG NRW), oder als Schöffe bei Gericht (§ 31 GVG); Mitwirkung als sachverständiger Bürger[23].
Bürger sind in NRW hingegen verpflichtet, nebenberuflich einen auf Dauer berechneten oder besonders bedeutsamen Kreis von Verwaltungsgeschäften für die Gemeinde zu übernehmen (Ehrenamt), § 28 II GO NRW.
Beispiel für ein Ehrenamt: Ortsvorsteher in Gemeindebezirken (vgl § 39 VI, VII 3 GO NRW).
Ehrenamtlich Tätige sind zur Verschwiegenheit verpflichtet (Art. 20 II 1 bay.GO; §§ 19 IV, 23 VI m.v.KVerf.; § 40 NKomVG; § 30 GO NRW) und gelten amtshaftungsrechtlich als Amtsträger iSd Art. 34 GG iVm § 839 BGB[24].
Teil I Kommunalrecht › § 3 Die Gemeindebevölkerung (Bürger und Einwohner) › III. Verstärkung plebiszitärer Elemente
III. Verstärkung plebiszitärer Elemente
107
Auch auf kommunaler Ebene gelten, wie bereits mit Blick auf Art. 28 I 2 GG (oben Rn 78 ff) festgestellt, die Grundsätze der repräsentativen Demokratie. Die einzelnen Länder sehen im Rahmen der verfassungsrechtlich verfügbaren Gestaltungsoptionen[25] in ihren Gemeindeordnungen aber zunehmend auch plebiszitäre Elemente als zusätzliche Möglichkeiten der direkten Einflussnahme von Bürgern auf die politische Willensbildung und damit eine Stärkung von Ausdrucksformen der unmittelbaren Demokratie vor.
1. Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
108
Eine zentrale Rolle nehmen Bürgerbegehren und Bürgerentscheid gem. § 21 bd.wtt.GO, Art. 18a bay.GO, § 20 KV M-V; §§ 32, 33 NKomVG; § 26 GO NRW ein.
Das Bürgerbegehren stellt einen an ein bestimmtes Unterschriftenquorum geknüpften schriftlichen Antrag von Bürgern dar, der darauf zielt, dass die Bürgerschaft selbst über eine Angelegenheit der Gemeinde an Stelle des Rates – mit der Wirkung eines Ratsbeschlusses – entscheidet (Bürgerentscheid)[26]. Ziel eines Bürgerbegehrens kann es daher nicht sein, dem Rat lediglich Vorgaben für eine erst noch von ihm zu treffende Entscheidung zu machen.
Zu unterscheiden ist zwischen einem sog. kassatorischen und einem sog. initiierenden Bürgerbegehren. Ersteres greift in eine vom Rat getroffene Regelung ein, sei es, dass sie sich in der Aufhebung dieser Regelung erschöpft, sei es, dass es sie durch andere ersetzt; letztere „bearbeiten gleichsam ein noch unbestelltes Feld und stoßen damit ausschließlich gemeindliche Aktivitäten an“[27].
109
Bevor ein Bürgerbegehren zum Bürgerentscheid heranreifen kann, muss es eine Reihe von Zulässigkeitsvoraussetzungen[28] erfüllen: In formeller Hinsicht bedarf es eines hinreichend bestimmten Antrags mit Bezeichnung einer Frage, die mit Ja/Nein beantwortet werden kann,[29] einer Begründung und der Benennung von vertretungsberechtigten Personen. In vielen Ländern wird ferner ein Vorschlag zur Kostendeckung gefordert[30]. Das vom Bürgerbegehren zu erreichende Unterstützungsquorums liegt in Deutschland zwischen 3% der Einwohner bei großen Städten in Bayern oder NRW und 10% etwa in Sachsen[31] und ist innerhalb einer bestimmten Frist zu erreichen. Zudem sind die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung thematisch begrenzt, was die Gemeindeordnungen zumeist in einem Negativkatalog zum Ausdruck bringen. Zu den Themenkreisen, die einem Bürgerbegehren nach Maßgabe gesetzlicher Festlegung verschlossen bleiben, gehören in jedem Falle solche Anträge, die kommunale Abgaben betreffen (vgl § 32 II Nr 3 NKomVG; § 26 V Nr 3 GO NRW), mit denen ein gesetzwidriges Ziel verfolgt wird oder die sittenwidrig sind (vgl § 32 II Nr 8 NKomVG). Je nach Landesrecht sind dies aber etwa auch Fragen der Organisation der Gemeindeverwaltung und ihrer Mitglieder oder Belange mit besonderer Komplexität. Stets muss es jedenfalls um eine Angelegenheit der Gemeinde gehen, für die innergemeindlich grundsätzlich der Gemeinderat organzuständig ist.
Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind und das Bürgerbegehren zulässig ist, wird in der Regel vom Gemeinderat (vgl § 26 VI 1 GO NRW; Art. 18a VIII 1 bay.GO; § 20 V 4 KV M-V), in Niedersachsen jedoch (gem. § 32 VII 1 NKomVG) vom Hauptausschuss festgestellt. Ist dies der Fall, kann das Vertretungsorgan entweder dem Bürgerbegehren entsprechen[32] oder den Bürgerentscheid durchführen lassen. Die kommunalen Verfahren sachunmittelbarer Demokratie sind also stets zweistufig ausgestaltet. Der abschließende Bürgerentscheid selbst fordert eine Ja/Nein-Entscheidung, die regelmäßig beim Erreichen der einfachen Mehrheit und eines hinreichenden Zustimmungsquorums, das wiederum zwischen den Ländern variiert[33], erfolgreich ist.
110
Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Ratsbeschlusses. Er entfaltet bindende Wirkung hinsichtlich der Angelegenheit, über die die Bürgerschaft entschieden hat.[34] Vor Ablauf von zwei Jahren kann er nur auf Initiative des Rates durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert werden (so § 33 IV 2 NKomVG; § 26 VIII GO NRW; § 20 I 2 KV M-V in der Abänderbarkeit abweichend Art. 18a XIII bay.GO).
Daraus ergibt sich mittelbar, dass nach zwei Jahren ein Bürgerentscheid durch Ratsbeschluss kassiert werden kann. Diese Vorschrift ist aber nicht umgekehrt anwendbar auf die Kassation eines Ratsbeschlusses durch einen Bürgerentscheid. Für eine Analogie fehlt es an einer Regelungslücke, insbes. in NRW, wo für sog. kassatorische Bürgerbegehren in § 26 III GO NRW eine abschließende Fristenregelung getroffen ist[35].
111
Anders als bei Wahlen sind die Gemeindeorgane regelmäßig nicht zur Neutralität gegenüber einem Bürgerbegehren verpflichtet. Ihre Befugnis, sich zu einem kassatorischen Bürgerbegehren wertend zu äußern, erfährt jedoch Einschränkungen durch Kompetenznormen, den Grundsatz der Freiheit der Teilnahme an Bürgerbegehren und das Sachlichkeitsgebot[36]. Letzteres gilt allerdings auch für die Bürgerbegehren, die, wenn ihre mangelhafte Begründung als Täuschung des Wählerwillens erscheint, unzulässig sein können[37].
Der plebiszitär-demokratische Charakter des Bürgerbegehrens verleiht diesem einen besonderen Schutz gegenüber den Handlungen der Gemeindeorgane. Der aus dem allgemeinen Staatsrecht entwickelte Grundsatz der Organtreue gilt auch im Verhältnis der Gemeindeorgane zur Bürgerschaft im Rahmen eines Bürgerbegehrens. Gleichwohl besteht allein durch Einleitung eines Verfahrens zur Herbeiführung eines Bürgerbegehrens bzw Bürgerentscheides noch keine generelle „Entscheidungssperre“ für den Rat oder andere Gemeindeorgane[38]. Andererseits ist das Handeln der Gemeindeorgane aber dann als treuwidrig anzusehen, wenn es in der Sache oder hinsichtlich des dafür gewählten Zeitpunkts bei objektiver Betrachtung nicht durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist, sondern allein dem Zweck dient, dem Bürgerbegehren die Grundlage zu entziehen und damit eine Willensbildung auf direkt-demokratischem Wege zu verhindern[39]. So darf der Gemeinderat nicht einseitig durch Beschleunigung von Verfahrensschritten, kombiniert mit einer Verzögerung des Verfahrens des Bürgerbegehrens Fakten schaffen, welche letztlich dem Bürgerbegehren die Grundlage entziehen[40]. Im Konfliktfall stellt sich mithin die Aufgabe, „die direkte Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene mit der Handlungsfreiheit der Gemeinden und ihrer gewählten Organe zu verbinden“[41].
112
Rechtsschutzfragen können sich nun in allen diesen geschilderten Stadien des Bürgerbegehrens ergeben, wobei der praktische Schwerpunkt bei den Klagen gegen Entscheidungen über die Unzulässigkeit eines Bürgerbegehrens liegt. In allen denkbaren Konstellationen geht es im Kern um drei Grundfragen, die miteinander zusammenhängen: Wem steht das geltend gemachte Recht zu? Um welche Art von Recht – Innen- oder Außenrechtsverhältnis – handelt es sich? Und welche Klageart steht verwaltungsprozessual zur Verfügung, um das Klageziel zu erreichen? Insoweit lassen sich sieben verschiedene Fallkonstellationen unterscheiden, deren Thematisierung im Detail jedoch den Umfang dieses Lehrbuchs sprengen würde, weshalb hier auf die Rechtsprechung und Spezialliteratur zu verweisen ist[42].