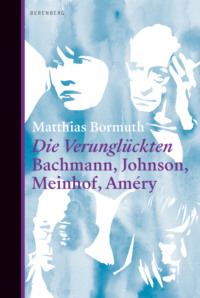Kitabı oku: «Die Verunglückten», sayfa 3
II.
Jean Améry mied die »Mördergrube« lange. Bis 1965 war die Schweiz der Ort, an dem seine in Brüssel entstandenen Reportagen erschienen. Allerdings stellte er schon 1961 mit Geburt der Gegenwart eine kulturphilosophische Zeitdiagnose der westlichen Welt, die in Deutschland wenig geschätzt wurde. Denn das Kapitel »Im Schatten des Dritten Reiches« macht deutlich, warum er vor dem Jerusalemer Eichmann-Prozess auf kein Publikum hoffen konnte. Es bietet eine genaue Bestandsaufnahme der deutschen Nachkriegsjahre, die das restaurative Klima der Adenauer-Ära unter den Bedingungen des Kalten Krieges beschreibt: »Die Vertuschung und Verdrängung der nationalsozialistischen Vergangenheit wurde dem deutschen Volke durch eine Weltstimmung erleichtert, die […] durchaus bereit war, zu vergeben und zu vergessen – und sei es nur um der antikommunistischen Allianz mit Deutschland willen, die man allenthalben, wenn auch nur als notwendiges Übel, annahm.« Als eine der wenigen überzeugenden Stimmen führt Améry Karl Jaspers mit dem Traktat Die Schuldfrage an. Der Philosoph habe 1946 gewagt, »seinem Volke Dinge zu sagen, wie es sie gewiß nicht gerne hörte«. Améry gefiel auch dessen Rechtfertigung der Nürnberger Prozesse, die er mit den Worten zitierte: »Die nationale Schmach liegt nicht im Gericht, sondern in dem, was zu ihm geführt hat, in der Tatsache dieses Regimes und seiner Handlungen.« Dagegen seien die deutschen Schriftsteller nicht fähig gewesen, die »unbewältigte Vergangenheit« wirklich zur Sprache zu bringen: »Die Dichter vermochten nicht, die Mauer der Wirklichkeit zu durchbrechen.«
Fritz Bauer löste mit den Frankfurter Auschwitz-Prozessen in der Folge den Bann. Nun forderte die kritische Öffentlichkeit in Deutschland die schonungslose Aufklärung, deren Fehlen Améry in Geburt der Gegenwart vermisst hatte. Mit Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten konnte er nun ein Zeichen setzen. Améry wollte eine selbstkritische Nachdenklichkeit unter den Deutschen wecken und kein vernichtendes Urteil sprechen. Ihm ging es um eine mögliche Versöhnung zwischen Opfern und Tätern.
Dieses Anliegen teilten auf deutscher Seite auch einige Psychiater, die mit Sorge beobachtet hatten, dass viele von Traumata gezeichnete Patienten, welche die Lagerwelt überlebt hatten, in den 1950er Jahren noch nicht einmal finanziell entschädigt worden waren. Man versuchte ihnen als Überlebenden des Holocaust wenigstens klinisch Gerechtigkeit zukommen zu lassen. Amérys Überlegungen greifen die psychiatrische Initiative auf, die in der Heidelberger Tradition von Karl Jaspers 1964 zu dem Buch Psychiatrie der Verfolgten geführt hatte. Die Autoren plädierten erfolgreich dafür, die Spätfolgen der Haft als Grund für Renten und andere Formen der Entschädigung anzuerkennen. Entscheidend für die positive Begutachtung war die klinische Kategorie der »erlebnisreaktiven Umstrukturierung der Persönlichkeit«. Aber zur chronifizierten Depression, die sich oft in Niedergedrücktheit, Schuldgefühlen und Antriebsstörungen äußerte, zählten manche Autoren auch »Züge misstrauischer Verbitterung«, die man vielfach als »Konzentrationslagersyndrom« klassifizierte.
In seinen Überlegungen bürstet Améry die psychiatrischen Überlegungen gegen den Strich. Er will die moralische Position des Opfers legitimieren, dem es um Aufklärung zu tun ist. Er stößt sich an der Bezeichnung »KZ-Syndrom«: »Wir allen seien, so lese ich in einem kürzlich erschienenen Buch über ›Spätschäden nach politischer Verfolgung‹, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch versehrt. […] Wir sind, so heißt es, ›verbogen‹.« Besonders war es der Aufsatz »Die Konzentrationslagerhaft als Belastungssituation«, der Améry mit Passagen über die »rassisch Verfolgten« und deren »generelle[m] Mißtrauen« provoziert hatte. Denn der Autor des Aufsatzes, der philosophisch ambitionierte Psychiater Paul Matussek, beurteilte dieses als psychopathologische Fragwürdigkeit: »[Das Mißtrauen] richtet sich gegen diejenigen Menschen, die nicht im KL waren und entspringt aus der nicht oder nicht voll auslebbaren Anklägerrolle, die sich durch das vergangene, aber nicht zu vergessende Faktum des totalen Ausgestoßenseins dem Verfolgten der Gesellschaft gegenüber auferlegt und die Gesellschaft ihm gegenüber ständig in Verlegenheit bringt.«
Améry erscheint dagegen das psychopathologisch gesteigerte Misstrauen keineswegs als Negativum. Vielmehr deutet er das »Ressentiment« als Privileg der Traumatisierten, da es sie mit einem geschärften Blick ausstatte und ihre Welt moralisch unbequem betrachten lasse. An Nietzsches provokative Moralpsychologie des Ressentiments mit ihrer polemischen Unterscheidung zwischen jüdisch-christlicher Sklavenmoral und vornehmer Herrenmoral entzündet sich Amérys gegenläufige Sichtweise. Er zitiert ausführlich aus Zur Genealogie der Moral: »Das Ressentiment bestimmt solche Wesen, denen die eigentliche Reaktion, die der Tat, versagt ist, die sich nur durch eine imaginäre Rache schadlos halten … Der Mensch des Ressentiments ist weder aufrichtig, noch naiv, noch mit sich selber ehrlich und geradezu. Seine Seele schielt, sein Geist liebt Schlupfwinkel und Hintertüren, alles Versteckte mutet ihn als seine Welt, seine Sicherheit, sein Labsal.« Dem folgt das Bekenntnis zu einem scheinbar arg beschränkten Blick des geschichtlichen Überwältigten: »Ich hegte meine Ressentiments.« Dabei ist Améry sich mit Nietzsche der moralisch eingeengten Perspektive bewusst, die aus der Fixierung auf das vergangene Unrecht resultiert: »Das Ressentiment blockiert den Ausgang in die eigentlich menschliche Dimension, die Zukunft. Ich weiß, das Zeitgefühl des im Ressentiment Gefangenen ist verdreht, ver-rückt, wenn man will«. Die scheinbar psychopathologische Not des Opfers wird bei Jean Améry zur moralphilosophischen Tugend: »Meine Ressentiments aber sind da, damit das Verbrechen moralische Realität werde für den Verbrecher, damit er hineingerissen sei in die Wahrheit seiner Untat.«
Die biographisch bedingten Traumata bilden somit die psychodynamische Grundlage für die moralisch aufklärerische Vision: »Sittliche Widerstandskraft enthält den Protest, die Revolte gegen das Wirkliche, das nur vernünftig ist, solange es moralisch ist. Der sittliche Mensch fordert Aufhebung der Zeit – im besonderen, hier zur Rede stehenden Fall: durch Festnagelung des Untäters an seine Untat. Mit ihr mag er bei vollzogener moralischer Zeitumkehrung als Mitmensch dem Opfer zugesellt sein.«
Amérys Reflexionen entfalten eine Paria-Moral, in der die »negative Privilegierung« zum prophetischen Impetus wird. Entsprechend reklamiert er mit polemischer Bitterkeit die jüdische »Einzigartigkeit, die man auch eine ›negative Ausgewähltheit‹, d. h. eine Ausgewähltheit zum Schlachtvieh« nenne. Die moralische Prophetie eröffnet einen großartigen utopischen Horizont: »Zwei Menschengruppen, Überwältiger und Überwältigte, würden einander begegnen am Treffpunkt des Wunsches nach Zeitumkehrung und damit nach Moralisierung der Geschichte. Die Forderung, erhoben vom deutschen, dem eigentlich siegreichen und von der Zeit schon wieder rehabilitierten Volke, hätte ein ungeheures Gewicht, schwer genug, daß sie damit auch schon erfüllt wäre. Die deutsche Revolution wäre nachgeholt. Hitler zurückgenommen.« Améry spricht selbst von einer »ausschweifenden moralischen Träumerei«, die er zuletzt wieder radikal in Frage stellt: »Im Grunde waren die Befürchtungen […] Nietzsches nicht gerechtfertigt. Unsere Sklavenmoral wird nicht triumphieren.«
III.
Als Jean Améry Jenseits von Schuld und Sühne schrieb, hatte Hannah Arendt mit Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen eine weltweite Kontroverse über das Verhalten der Opfer des Holocaust ausgelöst. Als Beobachterin des Eichmann-Prozesses fragte Arendt, ob die erzwungene Kooperation, gerade der Judenräte, nicht dazu geführt habe, dass wesentlich mehr jüdische Menschen in die Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten geraten seien, als wenn ihre privilegierten Vertreter ihre Mitarbeit verweigert hätten. Sie selbst urteilte polemisch: »Eines aber ist gewiß: Die ›Führer‹ dieses Volkes, also im Ghetto vor allem Judenrat und Judenpolizei, hätten besser daran getan, sich nicht an jene ungeglaubte und hoffnungslose Hoffnung zu klammern, sondern von Anbeginn ihre Sache und die ihrer Schützlinge auf nichts zu stellen, was in diesem Falle hießt: auf den eigenen Tod, der ohnehin kommen musste, und auf die Vorbereitung der rächenden Gewaltanwendung.«
Vor diesem Hintergrund bekennt Améry mit »schmerzvoller Scham«, nicht zur Gruppe jener gehört zu haben, die in manchen Lagern den Aufstand gegen die übermächtigen Deutschen gewagt oder im Erdulden des Leids herausgeragt hatten. Obwohl er den aktiven und passiven Widerstand derjenigen bewundert, die aufgrund ihres religiösen oder politischen Glaubens die inneren Kräfte besaßen, verteidigt er die besondere Situation dessen, den keine dogmatischen Wahrheiten mobilisiert habe: »Der skeptische geistige Mensch wurde nur in Ausnahmefällen durch das großartige Beispiel der Kameraden zum Christen oder zum marxistischen engagé. Meist kehrte er sich ab und sagte sich: Eine bewundernswerte und rettende Illusion, aber eine Illusion eben doch.« Primo Levi teilte diesen Blick: »Im Mühlwerk des täglichen Lebens lebten die gläubigen Menschen besser. Améry und ich haben es beide beobachtet. Es hatte überhaupt keine Bedeutung, welchem Glauben sie anhingen, ob er religiös oder politischer Natur war […]: sie besaßen einen Schlüssel und einen Halt, ein tausendjähriges Morgen, für das es einen Sinn haben konnte, sich zu opfern, einen Platz im Himmel oder auf der Erde, wo die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gesiegt hatten, oder in einer vielleicht fernen, aber gewissen Zukunft den Sieg erringen würden: Moskau oder das himmlische oder das irdische Jerusalem.«
Gleichwohl blieb es nicht bei dem Urteil von Jenseits von Schuld und Sühne. Ein Jahr später änderte sich Amérys Auffassung, als er Jean-François Steiners Roman Treblinka besprach. Der ehemalige Lagerhäftling zeigte sich beeindruckt von dem Motiv, aufgrund dessen der junge französische Jude sein Buch geschrieben hatte. Améry zitierte dessen Bekenntnis: »Ich litt unter der Schande, Sohn eines Volkes zu sein, von dem sechs Millionen sich zur Schlachtbank führen ließen wie die Schafe.« Ihn bannte die dramatische Erzählung über die Sechshundert, denen die gewaltsame Flucht aus dem Todeslager gelungen war, während sich Hunderttausende ohne Gegenwehr in ihr Schicksal ergeben hatten. Keine Rede ist mehr von den ideologischen Illusionen angesichts der todesmutigen Entschlusskraft: »Aus der Tiefe der Demütigung erhebt sich der Mensch zur Selbsterlösung in der ›violence‹.« Die Tatsache, dass Steiner sich mit der literarischen Legende des grandiosen Widerstands den Vorwurf der Geschichtsfälschung einhandelte, stört Améry nicht: »Man trinkt und ist qualvoll berauscht.« Mit seinem hagiographischen Narrativ diene der junge Autor einem höheren Anliegen: »Was er erzählt hat, daß er es erzählt hat, trägt zur Befreiung aller überlebenden KZ-Juden vom nachlastenden Druck erfahrener Schmach bei.« Auch Hannah Arendt hatte in Jerusalem die Erinnerungen der jüdischen Widerstandskämpfer als seltene, emotional erlösende Schilderungen gehört und geschrieben: »Ihr Auftreten verjagte das Gespenst einer allseitigen Gefügigkeit«.
Ende der 1960er rückte Améry die perfiden Machtmechanismen der Nationalsozialisten nochmals stärker ins Bewusstsein, als er gefragt wurde, ein Vorwort zu einer Dokumentation des Warschauer Ghettos zu liefern: »[D]enn des Unterdrückers teilende und herrschende, schließlich den unausweichlichen Tod verhängende Gewalt hatte die praktischen, die psychologischen und die existentiellen Grundlagen des menschlichen Racheaktes zu zerstören gewusst.« Mit beißender Ironie unterstreicht sein Vorwort nun Steiners desolate Schilderung der Lagerexistenz: »Die Nazis gaben jedem Juden eine Chance, ein Schurke zu sein«. Die tägliche Kollaboration in den Ghettos habe sich vor allem aus der Hoffnung gespeist, selbst von der Deportation verschont zu bleiben oder zumindest ein milderes Schicksal erwarten zu dürfen: »Eine Hierarchie errichtete sich, wo doch alles darauf angekommen wäre, daß kein armer Hund hätte mehr und besser sein sollen als der andere, um mit ihm in totaler Egalität zur Wolfsherde zu werden.« Seine Reflexionen rechtfertigen jegliche Handlung, die unternommen wurde, um am Leben zu bleiben: »Jede Antwort auf die menschliche Zerstampfung der Juden durch den Nazi war im Ghetto legitim: auch die im üblichen Sinne niederträchtigste.«
Die tiefe Zerrissenheit, die Améry angesichts der eigenen Verstrickung in den Apparat der Vernichtung fühlte, drückt sich auch im zornigen Anschreiben gegen Hannah Arendt und ihren Bericht von der Banalität des Bösen aus: »Es war die politische geradeso wie die moralische Begriffswelt durch ein Übermaß an Unrecht außer Kraft gesetzt worden. Der Triumph des radikalen Bösen (nicht des ›sogenannten‹, das rückführbar wäre auf stammesgeschichtliche Tatsachen; auch nicht des ›banalen‹, an dessen Existenz ich nicht mehr glauben kann) hatte im Ghetto eine Welt erstehen lassen, die nicht jenseits, wohl aber unterhalb von Gut und Böse war.« Als Betroffener, der die Lagerwelt überlebt hatte, war Améry so empört, dass er Arendt – tief getroffen und entsetzt von dem, was er als Arroganz und Ignoranz empfand – auch persönlich angriff: »Nur Unverstand, frecher Hochmut und völlige Unkenntnis der Sachlage wird den ›Kollaborations-Juden‹ verurteilen wie irgendeinen Quisling im besetzten Europa!« Mit polemischer Leidenschaft setzt er sich von der provokanten Gedankenführung von Eichmann in Jerusalem ab. Améry führt die »eigentümliche Dialektik der jüdischen Solidarität« an gegen das, »was immer uns Frau Arendt erzählt haben mochte in ihrem bemerkenswert verständnislosen und nicht einmal relevante Sachkenntnis enthaltenden Eichmann-Buch!«: »Sie litten trotz allem mit ihren Opfern, die jüdischen Kapos, Blockältesten und die jüdischen Ghetto-Polizisten und schnöden Ghetto-Notablen. Sie prügelten den Mitjuden und trafen dabei sich selbst; sie jagten ihn in die Gaskammern und glaubten nicht einmal, daß sie mit solchem Verrat sich selber würden retten können.«
IV.
Nach dem Erfolg von Jenseits von Schuld und Sühne blieb Améry vorerst dem autobiographischen Genre treu. Er behielt auch das kluge Prinzip bei, fünf Essays zunächst für den Rundfunk zu schreiben und sie nach Möglichkeit auch einzeln abdrucken zu lassen, bevor sie gesammelt als Buch erschienen. Auf diesem Weg erschienen bei Klett-Cotta in den Jahren 1968 und 1971 die beiden Bände Über das Altern und Unmeisterliche Wanderjahre. Sie folgten zwei anderen lebensgeschichtlich zentralen Perspektiven: dem körperlichen Verfall, den der 66-jährige Améry zu gewärtigen hatte, und dem geistigen Werden, das ihn von den Wiener Anfängen im Positivismus in die französische Welt des Existentialismus um Jean-Paul Sartre geführt hatte.
Den ersten Band Über das Altern. Revolte und Resignation besprach Horst Krüger in der Zeit unter dem Titel »Aufklärung statt Verklärung«. Ihm imponierte Amérys schonungsloser Willen zur Ernüchterung. Dass diese auch von den traumatischen Erlebnissen geprägt war, zeigte sich in dem späteren Essay »Über das Altern«, den Améry drei Jahre nach dem Buch im Zeitmagazin erscheinen ließ: »Das Leben des alten Menschen ist Last. Sein Leib wird aus einem tragenden zu einem lastenden, ein unheimlicher Geotropismus macht, daß der Alte zur Erde sich neigt: Er geht gebückt, denn er ist schwer vom Gewichte des eigenen Körpers, schwer auch von Erinnerungen, die ihm die Wirklichkeit verstellen, beschwert bis zur Unerträglichkeit von den Provokationen eines Zeitgeschehens, das er nicht mehr mitgestalten kann.«
Der melancholische Zug prägte auch die Essay-Sammlung Unmeisterliche Wanderjahre, die als »Bildungsgeschichte« gedacht war und die »Problematik einer intellektuellen Existenz zwischen Deutschland und Frankreich« in bewusster Subjektivität erzählen sollte: »Prinzipiell würde ich bei der Methode der persönlichexistentiellen Aussageform verharren wollen, die ich für meine Sendereihe und Bücher Jenseits von Schuld und Sühne und Über das Altern wählte, nur daß der hier proponierten Serie doch die informative Komponente gegenüber der subjektiven ein klares Übergewicht wird bewahren müssen.« Die Selbstanzeige des Buches umreißt resignativ die Ohnmacht des Geistes gegenüber der vernichtenden Geschichte: »Es gibt Meisterschaft und Meister nicht mehr. Immer wieder soll dem Hörer dargetan werden, wie die Zeit gewaltige und unlösbar erscheinende Probleme ganz einfach auslöscht, […] und manchmal wird Geschichte nur als das erscheinen, als was einst Theodor Lessing sie bezeichnet hat: Sinngebung des Sinnlosen.« Dass Améry vergeblich versucht hatte, sich im Denken einzurichten, weil ihm die reale Heimat verloren war, beschrieb Rudolf Hartung, der damalige Herausgeber der Neuen Rundschau: »Indem er sich nämlich ganz dem Denken überantwortet, als gebe es Heimat oder Wohnstatt nur in ihm und in den geschichtlichen Entfaltungen des Zeitgeistes, erwartet er vom Denken zu viel.«
Der Verlust der Heimat machte Améry auch sensibel für den Staat Israel, den er 1976 erstmals besucht hatte. Während die europäische Linke nach dem überraschend erfolgreichen Sechstagekrieg Israel in weiten Zügen verurteilte und sich mit dem Schicksal der unterdrückten Palästinenser solidarisierte, verteidigte Améry schon 1969 im Essay »Der ehrbare Antisemitismus« das 1948 gegründete Land: »Fest steht: Der Antisemitismus, enthalten im Anti-Israelismus oder Anti-Zionismus wie das Gewitter in der Wolke, ist wiederum ehrbar. Er kann ordinär reden, dann heißt das ›Verbrecherstaat Israel‹. Er kann es auf manierlichere Art machen und vom ›Brückenkopf des Imperialismus‹ sprechen«. Als gebranntes Kind befürchtete er eine neue Welle deutschen Ressentiments, das sich nun gegen die Juden in Gestalt der politisch Mächtigen richten würde, die mit den Mitteln des internationalen Kapitals gnadenlos gegen Ohnmächtige agierten: »Die Linke […] sieht nicht, daß trotz Rothschild und einem wohlhabenden amerikanisch-jüdischen Mittelstand der Jude immer noch schlechter dran ist als Frantz Fanons Kolonisierter, sieht das so wenig wie das Phänomen des anti-imperialistischen jüdischen Freiheitskampfes, der gegen England ausgefochten wurde.«
Als sich Israel im Jom-Kippur-Krieg gegenüber den überraschenden Angriffen der arabischen Anrainerstaaten als wehrhafte Heimstatt jüdischer Menschen erwiesen hatte, vertiefte Améry seine Apologie. Sein Essay »Der neue Antisemitismus« interpretierte diesen 1976 als erschreckendes Anzeichen für eine Renaissance antijüdischen, von Gewaltphantasien durchzogenen Denkens: »Der Antisemitismus, welt- und menschenunmöglich geworden durch etwas, das hier durch die Chiffre ›Auschwitz‹ verkürzt gekennzeichnet ist, steht im Begriffe, sich wieder in die politische Diskussion einzudrängen und sich ganz unverschämt breit zu machen. […] Der Antisemitismus, mit dem wir es heute zu tun haben, nennt seinen Namen nicht. Im Gegenteil: Will man ihn haftbar machen, verleugnet er sich. Man kann ihm nur schwer den Prozeß machen, den er schon längst verloren hat, der aber gleichwohl ein Verfahren in Permanenz zu bleiben hätte. Was sagt der neue Antisemit? Etwas überaus Einfaches und dem flüchtigen Blick auch Einleuchtendes: Er sei nicht der, als den man ihn hinstelle, nicht Antisemit also sei er, sondern Anti-Zionist! […] Man darf rufen: ›Schlagt die Zionisten tot, macht den Nahen Osten rot!‹ – und kann verschweigen oder sogar empört die Insinuation zurückweisen, daß in diesem Kampfruf ein anderer, nur allzu bekannter mitschwinge: das ganz eindeutige ›Juda verrecke‹ der Nazis.«
Mit dem aktuellen Anlass blitzte die Erinnerung an die jüngste Vergangenheit auf, deren unheilvolle Rückkehr Améry unter gewandelten Umständen und Vorzeichen befürchtete. Hier ist spürbar, wie wirkmächtig die Traumatisierung blieb, wie genau und argwöhnisch, bis in Übertreibungen hinein, der ehemalige Lagerhäftling die deutsche Öffentlichkeit und ihre Meinungsbildung beobachtete. Jean Améry offenbarte mit diesen Essays zum linken Antisemitismus nochmals deutlich, von welchen biographischen Erfahrungen her seine Rolle als engagierter Intellektueller ihre Bestimmung und Rechtfertigung fand.