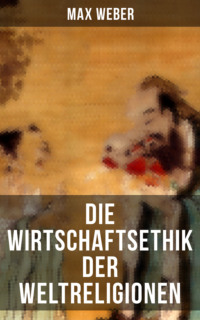Kitabı oku: «Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen», sayfa 4
Konfuzianismus und Taoismus5.
I. Soziologische Grundlagen: A. Stadt, Fürst und Gott.
China war, in scharfem Gegensatz zu Japan, schon seit einer für uns vorhistorischen Zeit ein Land der großen ummauerten Städte. Nur Städte hatten einen kanonisierten Ortspatron mit Kult. Der Fürst war vornehmlich Stadtherr. Die Bezeichnung für »Staat« blieb in offiziellen Dokumenten auch der großen Teilstaaten: »Eure Hauptstadt« bzw. »Meine bescheidene Stadt«. Noch im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurde die endgültige Unterwerfung der Miao (1872) durch einen zwangsweisen Synoikismos, eine Zusammensiedlung in Städte, besiegelt, ganz wie im römischen Altertum bis gegen das 3. Jahrhundert. Im Effekt kam vor allem die Steuerpolitik der chinesischen Verwaltung auf eine sehr starke Begünstigung der Stadtinsassen auf Kosten des platten Landes hinaus6. Ebenso war China von jeher die Stätte eines für die Bedarfsdeckung großer Gebiete unentbehrlichen Binnenhandels. Dennoch aber war, entsprechend der überragenden Bedeutung der agrarischen Produktion, bis in die Neuzeit hinein die Geldwirtschaft schwerlich je so entwickelt wie etwa im ptolemäischen Aegypten. Dafür ist schon das – allerdings teilweise nur als Verfallsprodukt zu verstehende – Geldsystem mit seinem fortwährend zeitlich und überdies von Ort zu Ort wechselnden Kursverhältnis des Kupferkurants zum Barrensilber – dessen Stempelung in den Händen der Gilden lag –, Beweis genug7.
Das chinesische Geldwesen8 bewahrt Züge äußerster Archaistik in Verbindung mit scheinbar modernen Bestandteilen. Das Zeichen für »Reichtum« bewahrt noch jetzt die alte Bedeutung »Muschel« (pei). Es scheint, daß noch 1578 Muschelgeldtribute aus Yünnan (einer Minenprovinz!) vorkamen. Für »Münzen« findet sich ein Zeichen, welches »Schildkrötenschale« bedeutet9, »Pu pe«: »Seidengeld«, soll unter den Tschou existiert haben und die Leistung von Seide als Steuer hat sich in den verschiedensten Jahrhunderten gefunden. Perlen, Edelsteine, Zinn werden daneben als alte Träger von Geldfunktion genannt und noch der Usurpator Wang Mang (seit 7 n. Chr.) versuchte – vergeblich – eine Geldskala herzustellen, in welcher neben Gold, Silber, Kupfer auch Schildkrötenschalen und Muscheln als Zahlmittel fungierten, während umgekehrt der rationalistische Einiger des Reiches, Schi Hoang Ti, nur »runde« Münzen, aber – nach einer freilich nicht sehr verläßlichen Angabe – außer Kupfer- auch Goldmünzen (Y und Tsien) hatte schlagen lassen, alle andern Tausch- und Zahlmittel aber – vergeblich – verboten hatte. Silber scheint als Münzmetall erst spät (unter Wu-ti, Ende 2. Jahrhunderts vor Chr.) überhaupt aufzutreten, als Steuer (der Südprovinzen) erst 1035. Zweifellos zunächst aus technischen Gründen. Das Gold war Waschgold, die Kupfergewinnung ursprünglich technisch relativ leicht, Silber dagegen nur durch eigentlichen Bergbau zu gewinnen. Sowohl die Bergbautechnik aber als die Münztechnik der Chinesen ist auf ganz primitiver Stufe stehen geblieben. Die angeblich seit dem 12., wahrscheinlich seit dem 9. Jahrhundert vor Chr. geschaffenen Münzen – erst seit etwa 200 vor Chr. mit Schriftzeichen versehen – wurden gegossen, nicht geprägt. Sie waren daher sehr leicht nachahmbar und an Gehalt sehr verschieden – noch weit verschiedener als, bis zum 17. Jahrhundert, die europäischen Münzen (fast 10% bei englischen Kronen). 18 Stücke der gleichen Emission des 11. Jahrhunderts schwankten nach Biots Wägung zwischen 2,70 und 4,08 g, 6 Stücke der Emission von 620 nach Chr. gar zwischen 2,50 und 4,39 g Kupfer. Schon deshalb allein waren sie kein eindeutig brauchbarer Standard für den Verkehr. Die Goldvorräte wurden wesentlich durch Tatarenbeutegold plötzlich vermehrt, um schnell wieder zu sinken. Gold und Silber wurden daher früh sehr selten, – das Silber, trotzdem die Bergwerke an sich, bei entsprechender Technik, abbauwürdig geblieben wären10. Kupfer blieb das Kurantgeld des Alltagsverkehrs. Der weit größere Edelmetallumlauf des Okzidents war den Annalisten insbesondere der Han-Zeit sehr wohl bekannt. Die großen, aus den Naturaltributen gespeisten Seidenkarawanen (jährlich eine große Zahl) brachten zwar okzidentales Gold in das Land. (Römische Münzen werden gefunden.) Doch das hörte mit dem Ende des Römerreichs auf und erst die Zeit des Mongolenreichs brachte wieder Besserung.
Die Wendung brachte erst der Verkehr mit den Abendländern in der Zeit nach der Eröffnung der mexikanisch-peruanischen Silberminen, von deren Ertrag ein erheblicher Teil als Gegenwert gegen Seide, Porzellan, Tee nach China floß. Die Silberentwertung im Verhältnis zu Gold (1368 = 4: 1, 1574 = 8: 1, 1635 = 10: 1, 1737 = 20: 1, 1840 = 18: 1, 1850 = 14: 1, 1882 = 18: 1) hinderte nicht, daß die infolge des zunehmenden geldwirtschaftlichen Silberbedarfs steigende Schätzung des Silbers das Kupfer im Preis gegen Silber sinken ließ. Wie die Bergwerke, so war auch die Münzschaffung Regal der politischen Macht: schon unter den 9 halblegendären Behörden des Tschou-li findet sich der Münzmeister. Die Bergwerke wurden teils in Eigenregie mit Fronden11, teils durch Private, aber unter Ankaufsmonopol der Regierung für die Ausbeute, betrieben12; die hohen Transportkosten des Kupfers zur Münze in Peking – welche den Ueberschuß über den Staatsmünzbedarf verkaufte – verteuerten die Münzherstellung beträchtlich. Diese Kosten waren auch an sich gewaltig. Im 8. Jahrhundert (752 nach Ma-tuan-lin) produzierten 99 damals existierende Münzstätten angeblich jede jährlich 3300 Min (à 1000 Stück) Kupfermünzen. Jede bedurfte dazu 30 Arbeiter und verwendete 21200 Kin (à 550 g) Kupfer, 3700 Blei, 500 Zinn. Der Kostenaufwand betrug auf 1000 Stück davon 750, also: 75%. Dazu trat der exorbitante Münzgewinn, welchen die (monopolisierte) Münze beanspruchte13: nominell 25%, welcher allein schon den unausgesetzt durch alle Jahrhunderte laufenden Kampf gegen die überaus gewinnbringende Nachprägung hoffnungslos machte. Die Bergwerksdistrikte waren von feindlicher Invasion bedroht. Nicht selten kaufte die Regierung Kupfer für Münzzwecke vom Ausland (Japan) oder konfiszierte private Kupfervorräte, um den hohen Prägebedarf zu sichern. Zeitweilig wurden Regal und Eigenbetrieb auf alle Metallbergwerke überhaupt erstreckt. Die Silberminen zahlten eine sehr bedeutende Royalty (in Kwantung Mitte des 19. Jahrhunderts 20-33 1/3%, bei Verbindung mit Blei 55%) an die betreffenden Mandarinen, deren Haupteinnahmequellen dort diese – gegen eine Pauschalsumme an die Regierung ihnen überlassenen – Einkünfte bildeten. Die Goldminen (besonders in der Provinz Yünnan vorhanden) waren, ganz ebenso wie alle anderen, in kleinen Feldern für den Kleinbetrieb an Minenmeister (Handwerker) vergeben und zahlten je nach Ergiebigkeit bis zu 40% Royalty. Daß alle Minen technisch schlecht ausgebeutet wurden, wird noch aus dem 17. Jahrhundert berichtet: der Grund war – neben den Schwierigkeiten, welche die später zu erwähnende Geomantik machte14 – der allgemeine, später zu erörternde, in der politischen, ökonomischen und geistigen Struktur Chinas liegende Traditionalismus, der auch jede ernsthafte Münzreform immer wieder scheitern ließ. Von Münzverschlechterungen hören wir in der Annalistik schon in alter Zeit (Tschuang Wang und Tsu), auch davon, daß die Oktroyierung der verschlechterten Münzen für den Verkehr scheiterte. Die erste Goldmünzenverschlechterung – seitdem oft wiederholt – wird bereits von King Ti berichtet und auch von den starken Störungen des Handels, die sie herbeiführte, erzählt. Das Grundübel aber waren offenbar die schwankenden Münzmetall-Vorräte15, unter der gerade der Norden, wo die Verteidigung gegen die Barbaren der Steppe zu führen war, ganz ungleich stärker litt als der mit metallenen Umlaufsmitteln von jeher weit reicher ausgestattete Süden, der Sitz des Handels. Die Finanzierung jedes Kriegs bedingte gewaltsame Münzreformen und Verwendung der Kupfer-Münzen für die Waffenfabrikation (wie bei uns im Kriege der Nickelmünzen). Herstellung des Friedens bedeutete Ueberschwemmung des Landes mit Kupfer durch die willkürliche Verwertung des Heeresguts seitens der »demobilisierten« Soldaten. Jede politische Unruhe konnte die Bergwerke sperren, erstaunliche – selbst nach Abzug der wahrscheinlichen Uebertreibungen sehr bedeutende – Preisschwankungen als Folge der Münzknappheit und des Münzüberschusses werden berichtet. Massenhafte private, zweifellos von den Beamten geduldete, Nachmünzstätten entstanden stets aufs neue und auch die einzelnen Satrapien spotteten des Monopols immer wieder. In der Verzweiflung über die Mißerfolge aller Versuche der Durchführung des staatlichen Münzmonopols ist man wiederholt (zuerst unter Wen-ti 175 v. Chr.) zur Freigabe der Münzschaffung für jeden Privaten nach gegebenen Modellen übergegangen. Völlige Verwirrung des Münzwesens war die natürliche Folge. Zwar gelang es nach dem ersten solchen Experiment Wu-ti ziemlich schnell, das Münzmonopol herzustellen und die privaten Prägestätten auszurotten, auch durch Verbesserung der Münztechnik (Münzen mit festem Rand) das Prestige der staatlichen Münzen wieder zu heben. Aber die Notwendigkeit, zur Finanzierung des (in alle Münzwirren aller Zeiten als Ursache hineinragenden) Hiung Nu-(Hunnen-)Kriegs Kreditgeld (aus weißen Hirschfellen) auszugeben und die leichte Nachahmbarkeit seiner Silbermünzen ließ auch diesen Versuch schließlich scheitern. Die Münzmetallknappheit war unter Yuan-ti (ca. 40 vor Chr.) so groß wie je16, – wohl eine Folge politischer Wirren, in deren Gefolge der Usurpator Wang Mang seine vergeblichen Geldskalenexperimente (28 Münzsorten!) vornahm. Eine Herstellung von Gold- und Silbermünzen durch die Regierung, – an sich nur als Gelegenheitserscheinung auftauchend, – scheint seitdem nicht mehr zu verzeichnen. Die 807 zuerst vorgenommene Emission staatlicher17 Umlaufsmittel in Nachahmung der Bankumlaufsmittel18 aber – besonders unter den Mongolen blühend – ist nur zuerst, später immer weniger, mit bankmäßiger Metalldeckung erfolgt, und die Entwertung der Assignaten in Verbindung mit der Erinnerung an die Münzverschlechterungen hat seitdem die Banko-Währung (deponierte Silberbarren als Unterlage des Großhandelszahlungsverkehrs in »Taël«-Einheiten) unerschütterlich etabliert. Die Kupferwährung aber bedeutete trotz der sehr niedrigen Preise doch nicht nur jene ungeheure Teuerung der Münzherstellung, sondern auch eine, durch die Höhe der Geldtransportkosten, für den Verkehr und die Entwicklung der Geldwirtschaft überhaupt sehr unbequeme Geldform: eine Schnur mit 1000 aufgereihten Kupfermünzen (tsien) wurde anfangs = 1 Unze Silber tarifiert, später = 1/2 Unze Silber. Dabei blieben die Schwankungen der verfügbaren Kupfermengen auch im Frieden infolge der industriellen und künstlerischen Verwendung (Buddhastatuen) außerordentlich bedeutend und in den Preisen sowohl wie namentlich bei der Steuerbelastung fühlbar. Die sehr starken Schwankungen des Münzwerts mit ihren Folgen für die Preise sind es denn auch gewesen, welche den immer wieder gemachten Versuch, ein einheitliches Budget auf der Grundlage reiner (oder annähernd reiner) Geldsteuern zu schaffen, ebenso regelmäßig wieder zum Scheitern brachten: stets erneut mußte zur (mindestens teilweisen) Naturalbesteuerung mit ihren selbstverständlichen, die Wirtschaft stereotypierenden Konsequenzen zurückgegangen werden19.
Für die Zentralregierung kam bei ihren Beziehungen zum Geldwesen neben unmittelbarem Kriegsbedarf und andern rein fiskalischen Motiven auch die Preispolitik sehr stark beherrschend in Betracht. Inflationistische Neigungen – Freigabe der Prägung, um die Kupfergeldproduktion anzuregen – wechselten mit Maßregeln gegen die Wirkung der Inflation: Schließung eines Teils der Münzstätten20. Vor allem aber war das Verbot und die Kontrolle des Außenhandels valutapolitisch mitbestimmt: teils durch Angst vor dem Abströmen des Geldes bei freier Einfuhr, teils durch die Sorge vor Ueberschwemmung mit fremdem Geld bei freier Ausfuhr21 von Waren. Ebenso war die Verfolgung der Buddhisten und Taoisten zwar zum sehr wesentlichen Teil religionspolitisch, daneben aber oft rein münzfiskalisch bedingt: die Buddhastatuen, Vasen, Paramente, überhaupt die durch die Klosterkunst angeregte künstlerische Verwendung des Geldstoffs wurde der Währung stets erneut gefährlich: die massenhaften Einschmelzungen führten zu scharfer Geldknappheit, Kupferthesaurierungen, Preissenkungen und im Gefolge davon zur Naturalwirtschaft22. Systematische Plünderungen der Klöster durch den Fiskus, Tarifierungen der Kupferwaren23und schließlich24 der Versuch, ein staatliches Monopol der Fabrikation von Bronze- und Kupferwaren durchzuführen, dem später ein Monopol der Fabrikation aller Metallwaren (um der privaten Münzverfälschungen Herr zu werden) folgte – was beides nicht dauernd durchführbar war. Das später zu besprechende, mit wechselnder Wirksamkeit eingeschärfte Verbot der Bodenakkumulation durch Beamte führte immer wieder zu sehr bedeutenden Anhäufungen von Kupfer in deren Händen und neben sehr hohen Geldbesitzsteuern häuften die preispolitischen und fiskalisch motivierten Geldbesitzmaxima25 sich in Zeiten der Geldknappheit. Der wiederholt versuchte Uebergang zum Eisengeld, welches längere Zeit neben Kupfer als Münzmetall herging, führte zu keiner Verbesserung der Lage. Die unter Schi-tong (10. Jahrhundert) erwähnte amtliche Eingabe, welche Verzicht auf den Münzgewinn und Freigabe der Metallverwertung (um Monopolpreise der Metallprodukte und dadurch Anreiz zur industriellen Verwertung zu vermeiden) forderte, blieb unausgeführt.
Die Papiergeldpolitik stand unter ähnlichen Gesichtspunkten. Die Emissionen der Banken, welche offenbar zunächst Zertifikat-Charakter hatten: – die übliche Sicherung des Großhandels gegen Münzverwirrung, – und später Umlaufsmittelcharakter, insbesondre zu interlokalen Remittierungszwecken, annahmen, waren der Anreiz zur Nachahmung gewesen. Technische Voraussetzung war die Entstehung der seit dem 2. Jahrhundert nach Chr. importierten Papierindustrie und ein geeignetes Holzschnitt-Druckverfahren26, insbesondere der Reliefschnitt statt des ursprünglichen intaglio-Verfahrens. Zuerst Anfang des 9. Jahrhunderts begann der Fiskus, den Kaufleuten ihre Wechsel-Verdienstgelegenheit aus der Hand zu nehmen. Zunächst hatte man auch das Prinzip des Einlösungsfonds (von 1/4-1/3) übernommen. Und auch später findet sich die Notenemission mehrfach auf Grund eines Bankdepositenmonopols des Fiskus. Aber selbstverständlich blieb es dabei nicht. Die Noten, anfangs durch Holzschnitt, dann in Kupferstich hergestellt, nutzten sich infolge der schlechten Papierqualität schnell ab. Mindestens wurden sie infolge der Kriege und Münzmetallknappheiten unleserlich. Verkleinerung der Appoints bis auf die winzigsten Einheiten, Repudiation mindestens der bis zur Unleserlichkeit abgenutzten Zettel, Erhebung eines Druckkostenbetrags bei Ersatz durch neue27, vor allem aber die Beseitigung des Metallschatzes28 oder doch erschwerte Einlösbarkeit durch Verlegung der Einlösungsstelle in das Innere29, oder eine zunächst relativ kurzfristige, dann auf mehrfach verlängerte Fristen (22-25 Jahre) verteilte Einziehung30, die aber dann meist gegen neue Zettel, oft unter Herabsetzung des Nennbetrages31 erfolgte, immer erneut auch mindestens teilweise Ablehnung der Annahme der Zettel als Steuerzahlungsmittel, diskreditierten das Papiergeld stets erneut, ohne daß natürlich der oft wiederholte Befehl, daß jede große Zahlung in bestimmten Proportionen in Papier zu leisten sei32 oder das gelegentliche völlige Verbot der Metallzahlung daran etwas geändert hätte. Andrerseits führte die mehrfache völlige Einziehung aller papierenen Zahlungsmittel zur Geldknappheit und Preissenkung und eine planvolle Vermehrung der Umlaufsmittel, wie sie wiederholt versucht wurde, scheiterte an der dann sofort einsetzenden Versuchung zur hemmungslosen Inflation aus fiskalischen Gründen. Unter normalen Verhältnissen hielt sich das Verhältnis von Papier- zur Metallzirkulation etwa in der Grenze wie in England im 18. Jahrhundert (1:10 oder noch weniger). Kriege, Verlust der Minendistrikte an Barbaren und – in wesentlich geringerem Umfang – industrielle (genauer: kunstgewerbliche) Verwertung des Metalls in Zeiten großer Besitzakkumulation und buddhistischer Klosterstiftungen führten zur Inflation, der Krieg in seinen Folgeerscheinungen wiederholt zum Assignatenbankerott. Die Mongolen (Kublai Khan) hatten eine skalierte Emission von Metallzertifikaten (?) versucht, die von Marco Polo bekanntlich sehr bewundert wurde33. Aber es erfolgte eine ungeheure Papierinflation. Schon 1288 fand eine Devalvation um 80% statt. Der große Silberzufluß aber brachte wieder Silber in Umlauf. Nun wurde versucht, Gold, Silber und Kupfer in ein tarifarisches Verhältnis zu setzen (Gold zu Silber 10, faktisch 10, 25:1, die Silber-Unze = 2005 tsien: also Kupferentwertung auf die Hälfte). Aller private Besitz von Gold- und Silberbarren wurde verboten: die Edelmetalle sollten nur den Deckungsfonds für die Zertifikate darstellen. Die Edelmetall- und Kupfer-Industrie wurden verstaatlicht und Metallgeld überhaupt nicht mehr geprägt. Faktisch führte das aber zur reinen Papierwährung, mit dem Sturz der Dynastie: zur Repudiation.
Die Ming gingen zwar wieder zur geordneten Metallprägung über (wobei, charakteristisch für die Unstetheit der Preisrelation der Edelmetalle, Gold zu Silber wie 4:1 gerechnet worden sein soll), um jedoch sehr bald zunächst (1375) Gold und Silber, dann (1450) auch Kupfer als Geld zu verbieten, weil das daneben zugelassene Papiergeld sich entwertete. Die reine Papierwährung schien damit das endgültige Geldsystem zu werden. Indessen 1489 ist das letzte Jahr, aus welchem die Annalistik das Papiergeld erwähnt, und das 16. Jahrhundert sah Versuche forcierter Kupferprägung, die indessen gleichfalls mißlangen. Erträgliche Zustände schuf erst das Einströmen europäischen Silbers durch den im 16. Jahrhundert beginnenden direkten Verkehr. Ende des Jahrhunderts bürgerte sich die pensatorische Silberwährung (Barren-, in Wahrheit: Banko-Währung) für den Großverkehr ein, die Kupferprägung kam wieder in Gang und die Relation von Kupfer zu Silber veränderte sich zwar wieder sehr bedeutend zuungunsten des Kupfers34, aber das Papiergeld (jeder Art) blieb seit dem Verbot der Ming von 1620, das die Mandschus aufrecht erhielten, vollständig unterdrückt und der seit dem langsam aber bedeutend gestiegene monetäre Metallvorrat drückte sich in der gesteigerten geldwirtschaftlichen Struktur der Staatsabrechnungen aus. Die Emission von Staatsnoten in der zweiten Taiping-Rebellion endete mit assignatenartiger Entwertung und Repudiation.
Immerhin bedeutete der Umlauf des Silbers in Barren starke Schwierigkeiten. Es mußte in jedem Fall gewogen werden und es galt als legitim, daß die Provinzialbankiers ihre größeren Kosten durch andre als die in den Hafenstädten üblichen Wagen einbrachten. Die Feinheit mußte durch Schmiede geprüft werden. Die Zentralregierung verlangte für die anteilsmäßig stark steigenden Silberzahlungen für jeden Barren Angabe des Herkunftorts und der Prüfungsstelle. Das in Schuhform gegossene Silber hatte in jeder Gegend anderes Schrot.
Es ist klar, daß diese Zustände zur Banko-Währung führen mußten. Die Gilden der Bankiers in den Großhandelsorten, deren Wechsel überall honoriert wurden, nahmen die Gründung von solchen in die Hand und erzwangen die Zahlbarkeit aller Handelsschulden in Banko-Währung. Zwar hat es auch im 19. Jahrhundert an Empfehlungen der Wiedereinführung des staatlichen Papiergeldes nicht gefehlt (Denkschrift von 1831)35. Und die Argumente blieben ganz die alten, wie schon Anfang des 17. Jahrhunderts und im Mittelalter: die industrielle Verwendung von Kupfer gefährde den monetären Umlauf und damit die Preispolitik und überdies liefere die Banko-Währung die Verfügung über das Geld den Händlern aus. Aber es ist damals nicht dazu gekommen. Die Gehälter der Beamten – der mächtigsten Interessenten – waren wesentlich in Silber zahlbar. Breite Schichten von ihnen waren mit den Interessen des Handels an der Nichtintervention der Pekinger Regierung in die Währung solidarisch, weil in ihren Einkommenschancen auf den Handel angewiesen. Jedenfalls aber waren alle Provinzialbeamten einmütig gegen jede Stärkung der Finanzmacht und vor allem: der Finanzkontrolle der Zentralregierung interessiert, wie wir noch sehen werden.
Die Masse der kleinbürgerlichen und kleinbäuerlichen Bevölkerung aber war trotz der stark – aber in den letzten Jahrhunderten im ganzen kontinuierlich und langsam – sinkenden Kaufkraft des Kupfers, zum Teil: wegen dieses Vorgangs, an der Aenderung des bestehenden Zustandes nicht oder wenig interessiert. – Die banktechnischen Einzelheiten des chinesischen Zahlungs- und Kreditverkehrs mögen hier außer Betracht bleiben. Es sei nur noch bemerkt: daß der Taël, die pensatorische Rechnungseinheit, in drei hauptsächlichen und einigen nebensächlichen Formen vorkam und die mit einem Bankierstempel versehenen, in Schuhform gegossenen Barren höchst unverläßliches Schrot hatten. Irgend eine oktroyierte Tarifierung der Kupfer münzen bestand jetzt schon lange nicht mehr. Im Innern war die Kupferwährung die einzige effektive. Dagegen war der Silbervorrat und war namentlich das Tempo seines Wachsens seit 1516 ein außerordentlich bedeutendes.
Wir stehen nun vor den beiden eigentümlichen Tatsachen: 1. daß die sehr starke Vermehrung des Edelmetallbesitzes zwar unverkennbar eine gewisse Verstärkung der Entwicklung zur Geldwirtschaft herbeigeführt hat, insbesondere in den Finanzen, – daß sie aber nicht mit einer Durchbrechung, sondern mit einer unverkennbaren Steigerung des Traditionalismus Hand in Hand ging, kapitalistische Erscheinungen aber, soviel ersichtlich, in keinem irgendwie greifbaren Maß herbeigeführt hat. Ferner: 2. daß eine kolossale Vermehrung der Bevölkerung (über deren Umfang noch zu sprechen sein wird) eingetreten ist, ebenfalls ohne daß dafür eine kapitalistische Formung der Wirtschaft den Anreiz gegeben oder aber ihrerseits durch sie Impulse erhalten hätte, vielmehr gleichfalls verknüpft mit (mindestens!) stationärer Form der Wirtschaft. Das bedarf der Erklärung.
Im Okzident waren in der Antike und im Mittelalter die Städte, im Mittelalter die Kurie und der entstehende Staat Träger der Finanzrationalisierung, der Geldwirtschaft und des politisch orientierten Kapitalismus. Von den Klöstern Chinas sahen wir, daß sie geradezu als Schädlinge für die Erhaltung der Metallwährung gefürchtet wurden. Städte, die wie Florenz eine Standardmünze geschaffen und der staatlichen Münzpolitik die Wege gewiesen hätten, gab es in China nicht. Und der Staat scheiterte nicht nur, sahen wir, mit seiner Währungspolitik, sondern: auch mit dem Versuch der Durchführung der Geldwirtschaft.
Bezeichnend waren die bis in die neueste Zeit typischen Bemessungen der Tempel- und vieler sonstiger Pfründen36 als (vorwiegend) Naturaldeputate. So war denn auch die chinesische Stadt trotz aller Analogien in entscheidenden Punkten etwas anderes als die des Okzidents. Das chinesische Zeichen für »Stadt« bedeutet: »Festung«. Dies galt nun auch für die Antike und das Mittelalter des Okzidents. In China war die Stadt im Altertum Fürstenresidenz37 und blieb durchweg bis in die Neuzeit in erster Linie Residenz der Vizekönige und sonstigen großen Amtsträger: ein Ort, in dem, wie in den Städten der Antike und etwa in dem Moskau der Leibeigenschaftszeit, vor allen Dingen Renten, teils Grundrenten, teils Amtspfründen und andere direkt oder indirekt politisch bedingte Einkünfte, verausgabt wurden. Daneben waren die Städte natürlich, wie überall, Sitze der Kaufmannschaft und – jedoch in merklich geringerer Exklusivität wie im okzidentalen Mittelalter – des Gewerbes. Marktrecht bestand auch in den Dörfern unter dem Schutz des Dorftempels. Ein durch staatliches Privileg garantiertes städtisches Marktmonopol fehlte38.
Der Grundgegensatz der chinesischen, wie aller orientalischen, Städtebildung gegen den Okzident war aber das Fehlen des politischen Sondercharakters der Stadt. Sie war keine »Polis« im antiken Sinne und kannte kein »Stadtrecht« wie das Mittelalter. Denn sie war keine »Gemeinde« mit eigenen politischen Sonderrechten. Es hat kein Bürgertum im Sinne eines sich selbst equipierenden stadtsässigen Militärstandes gegeben, wie in der okzidentalen Antike. Und es sind nie militärische Eidgenossenschaften wie die »Compagna Communis« in Genua oder andere »conjurationes«, mit feudalen Stadtherren um Autonomie bald kämpfende, bald wieder paktierende, auf die eigene autonome Wehrkraft des Stadtbezirkes gestützte Mächte: Konsuln, Räte, politische Gilden- und Zunft verbände nach Art der Mercadanza entstanden39. Revolten der Stadtinsassen gegen die Beamten, welche diese zur Flucht in die Zitadelle zwangen, sind zwar jederzeit an der Tagesordnung gewesen. Immer aber mit dem Ziel der Beseitigung eines konkreten Beamten oder einer konkreten Anordnung, vor allem einer neuen Steuerauflage, nie zur Erringung einer auch nur relativen, fest verbrieften, politischen Stadtfreiheit. Eine solche war in der okzidentalen Form schon deshalb schwer möglich, weil niemals die Bande der Sippe abgestreift wurden. Der zugewanderte Stadtinsasse (vor allem: der begüterte) behielt seine Beziehung zum Stammsitz mit dem Ahnenlande und mit dem Ahnenheiligtum seiner Sippe, also: alle rituell und persönlich wichtigen Beziehungen, in dem Dorf, von wo er stammte. Aehnlich etwa wie der Angehörige des russischen Bauernstandes, auch wenn er als Fabrikarbeiter, Geselle, Händler, Fabrikant, Literat in der Stadt die Stätte seiner dauernden Tätigkeit gefunden hatte, innerhalb seines Mir draußen sein Indigenat (mit den in Rußland daran hängenden Rechten und Pflichten) behielt. Der Ζεὺς ἑρκεῖος des attischen Bürgers und seit Kleisthenes sein Demos oder das »Hantgemal« des Sachsen waren im Okzident Rudimente ähnlicher Zustände40. Aber dort war die Stadt eine »Gemeinde«, in der Antike zugleich Kultverband, im Mittelalter Schwurbruderschaft. Davon finden sich in China nur Vorstadien, aber keine Verwirklichung. Der chinesische Stadtgott war nur örtlicher Schutzgeist, nicht aber: ein Verbands gott, in aller Regel vielmehr: ein kanonisierter Stadtmandarin41.
Es fehlte – daran liegt dies – völlig der politische Schwurverband von wehrhaften Stadtinsassen. Es gab in China bis in die Gegenwart Gilden, Hansen, Zünfte, in einigen Fällen auch eine »Stadtgilde«, äußerlich ähnlich der englischen »Gilda mercatoria«. Wir werden sehen, daß die kaiserlichen Beamten mit den verschiedenen Verbänden der Stadtinsassen sehr stark zu rechnen hatten, daß, praktisch angesehen, diese Verbände in überaus weitgehendem Maß, weit intensiver als die kaiserliche Verwaltung, und in vieler Hinsicht auch weit fester als die durchschnittlichen Verbände des Okzidents, die Regulierung des ökonomischen Lebens der Stadt in der Hand hielten. In mancher Hinsicht erinnerte der Zustand chinesischer Städte scheinbar an den der englischen teils in der Zeit der firma burgi teils der Tudorzeit. Nur schon rein äußerlich mit dem nicht gleichgültigen Unterschied: daß auch damals zu einer englischen Stadt stets die »Charter« gehörte, welche die »Freiheiten« verbriefte. Dergleichen aber existierte in China nicht42. Im schroffsten Gegensatz zum Okzident, aber in Uebereinstimmung mit den indischen Verhältnissen, hatten vielmehr die Städte, als kaiserliche Festungen, im Effekt wesentlich weniger rechtlich garantierte »Selbstverwaltung«43 als die Dörfer: die Stadt bestand formell aus »Dorfbezirken« unter je einem besonderen tipao (Aeltesten) und gehörte oft mehreren unteren (hsien), in manchen Fällen sogar mehreren oberen (fu) Verwaltungsbezirken mit gänzlich gesonderter staatlicher Verwaltung an44 – sehr zum Vorteil von Spitzbuben. Es fehlte den Städten schon rein formell die Möglichkeit, Verträge – privatrechtlicher oder politischer Art – zu schließen, Prozesse zu führen, überhaupt korporativ aufzutreten, wie sie die Dörfer – wir werden sehen durch welches Mittel – besaßen. Die auch in Indien (wie in der ganzen Welt) gelegentlich vorkommende faktische Beherrschung einer Stadt durch eine machtvolle Kaufgilde bedeutete dafür keinen Ersatz.
Der Grund liegt in der verschiedenen Herkunft der Städte hier und dort. Die Polis der Antike war – wie stark grundherrlich sie auch unterbaut sein mochte – zuerst als Seehandelsstadt entstanden; China aber war vorwiegend ein Binnengebiet. Soweit auch, rein nautisch betrachtet, der tatsächliche Aktionsradius der chinesischen Dschunken gelegentlich und so entwickelt die nautische Technik (Bussole und Kompaß45 war, so geringfügig war doch die relative Bedeutung des Seehandels, verglichen mit dem zugehörenden Binnenkörper. Und überdies hatte China seit Jahrhunderten auf eigene Seemacht – die unentbehrliche Grundlage des Aktivhandels – verzichtet und schließlich, im Interesse der Erhaltung der Tradition, die Beziehungen zum Ausland bekanntlich auf einen einzigen Hafen (Kanton) und eine kleine Zahl (13) konzessionierter Firmen beschränkt. Dieses Ende war nicht zufällig. Schon der »Kaiserkanal« wurde, wie jede Karte und auch die erhaltenen Berichte ergeben, geradezu nur gebaut, um den durch Piraterie und vor allem durch die Taifune unsichern Seeweg für die Reissendungen von Süd nach Nord zu vermeiden: amtliche Berichte führten noch in der Neuzeit aus, daß der Seeweg für den Fiskus solche Verluste mit sich bringe, daß die gewaltigen Kosten des Umbaus des Kanals sich rentieren würden. Die spezifische okzidentale Binnenstadt des Mittelalters andererseits war zwar, wie die chinesische und vorderasiatische, regelmäßig eine Gründung von Fürsten und Feudalherren zur Gewinnung von Geldrenten und Steuern. Aber zugleich wurde die europäische Stadt sehr früh ein hochprivilegierter Verband mit festen Rechten, die planvoll erweitert wurden und erweitert werden konnten, weil der feudale Stadtherr damals die technischen Mittel zur Stadtverwaltung nicht besaß und: die Stadt ein Militärverband war, der einem Ritterheer die Tore erfolgreich schließen konnte. Die großen vorderasiatischen Städte, etwa Babylon, wurden demgegenüber früh von der Gnade der bureaukratischen königlichen Kanalbauverwaltung in ihrer ganzen Existenz abhängig. Trotz der sehr geringen Intensität der chinesischen Zentralverwaltung galt dies auch von der chinesischen Stadt. Auch ihr Gedeihen hing sehr stark nicht von dem ökonomischen und politischen Wagemut ihrer eigenen Bürger, sondern von dem Funktionieren der kaiserlichen Verwaltung, vor allem: der Stromverwaltung, ab46. Unsere okzidentale Bureaukratie ist jung und teilweise geschult erst an den Erfahrungen der autonomen Stadtstaaten. Das chinesische kaiserliche Beamtentum war sehr alt. Die Stadt war hier – vorwiegend – ein rationales Produkt der Verwaltung, wie schon ihre Form zu zeigen pflegte. Zuerst war die Pallisade oder Mauer da, dann wurde die oft im Verhältnis zum ummauerten Areal unzulängliche Bevölkerung, eventuell zwangsweise47, herangeholt, und mit der Dynastie wechselte, wie in Aegypten, entweder auch die Hauptstadt selbst oder doch ihr Name. Die schließliche Dauerresidenz Peking war bis in die Neuzeit nur in äußerst geringem Maße ein Handels- und Exportindustrieplatz.
Eine moderne Entwicklungsgeschichte Chinas (alte Zeit), bringt E. Conrady in Band III der »Weltgeschichte« (1911) von v. Pflugk-Harttung. Erst während dieses Drucks kam mir das neue Werk von de Groot: »Universismus«. Die Grundl. d. Rel. u. Ethik, des Staatsw. u. der Wiss. Chinas (Berlin 1918) zur Hand. Von kurzen einführenden Skizzen sei ganz besonders auf die kleine Broschüre eines der besten Fachkenner verwiesen: Frhr. v. Rosthorn, Das soziale Leben der Chinesen (1919), aus der älteren Literatur gleicher Art etwa auf J. Singer, Ueber soziale Verhältnisse in Ostasien (1888).
Belehrender als viele Darstellungen ist das Durcharbeiten der von den englischen Interessenten jahrzehntelang unter dem Namen »Peking Gazette« übersetzten Sammlung (ursprünglich nur zum internen Gebrauch bestimmten) kaiserlichen Verfügungen an die Reichsbeamten. Die sonstige Literatur und die übersetzten Quellenschriften sind zu den Einzeldarlegungen zitiert. Für den Nichtfachmann ist sehr erschwerend der Umstand, daß die dokumentarischen und monumentalen Quellen nur zum kleinsten Teil übersetzt sind. Ein sinologischer Fachmann stand mir zur Kontrolle leider nicht zur Seite. Nur mit schweren Bedenken und unter den größten Vorbehalten wird daher hier dieser Teil mit abgedruckt.
Dazu tritt ein Durcheinander von Abgaben an Tee, Salz, Käse, Kleie, Wachs, Oel, Papier, Eisen, Kohle, Saflor, Leder, Hanf u.a., welches sinnloserweise vom Annalisten nach dem Gesamtgewicht (3200253 Pfund) angegeben ist, Was die Getreidequantitäten anlangt, so rechnete man, wie andern Orts erwähnt, als Monatsbedarf einer Person 1 1/2 schi (doch wechselte die Größe des schi erheblich). Die Silbereinnahme der letzten Rechnung, die in den beiden ersten fehlt, ist entweder aus dem Handelsmonopol oder durch Einführung der noch heute bestehenden Umrechnung des Kupferkurants in Silber durch die Steu ereinheber zu erklären, oder dadurch, daß die letzte Rechnung eine Ist-Rechnung, die ersten Sollbudgets (?) sind.
Die erste Abrechnung der Ming-Dynastie von 1360 weist demgegenüber nur 3 Posten auf:
Getreide........... 29433350 schi,
Geld (in Kupfer und Papiergeld) 450000 Unzen (Silber), Seidenstoffe......... 288546 Stück.
Also ein erheblicher Fortschritt der Silbervermehrung und ein Fortfall der zahlreichen spezifizierten Naturalien, die damals offenbar nur in den Bezirkshaushalten erschienen, wo sie verbraucht wurden. Sehr viel ist mit den Zahlen eben deshalb nicht anzufangen, weil man nicht sicher weiß, was vorabgezogen wurde.
1795-1810 flossen der Zentralregierung zu: 4,21 Mill. schi Getreide (à 120 chines. Pfund), dagegen eine sehr starke relative und absolute Vermehrung der Silbereinkünfte, ermöglicht durch die sehr stark aktive Zahlungsbilanz Chinas im Außenhandel mit den Abendländern seit dem amerikanischen Silbersegen. (Die neuere Entwicklung hat uns hier nicht zu interessieren.)
Uebung der alten Zeit war, nach der Annalistik, die der Hauptstadt nahe gelegenen Bezirke die geringwertigen Naturalien, die Außenbezirke mit steigender Entfernung zunehmend hochwertige Güter liefern zu lassen. Ueber die Steuern und ihre Wirkung siehe weiter unten.