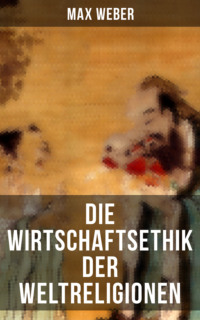Kitabı oku: «Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen», sayfa 5
Die – wie wir sehen werden – außerordentlich geringe Intensität der kaiserlichen Verwaltung brachte es zwar, wie schon angedeutet, mit sich, daß tatsächlich die Chinesen in Stadt und Land »sich selbst verwalteten«. Wie die Sippen – deren Rolle öfter zu erörtern sein wird – auf dem Lande, so waren neben ihnen, und für denjenigen, der keiner oder doch keiner alten und starken Sippe angehörte: statt ihrer, in der Stadt die Berufsverbände souveräne Herren über die ganze Existenz ihrer Mitglieder. Nirgends (außer – in anderer Art – in den indischen Kasten) war die unbedingte Abhängigkeit des einzelnen von der Gilde und Zunft (beide wurden terminologisch nicht geschieden) so entwickelt wie in China48. Mit Ausnahme der wenigen Monopolgilden seit jeher ohne jegliche offizielle Anerkennung durch die staatliche Regierung, hatten sie tatsächlich oft die absolute Jurisdiktion über ihre Mitglieder sich zugeeignet49. Ihrer Kontrolle unterlag alles, was ökonomisch für ihre Angehörigen von Bedeutung war: Maß und Gewicht, Währung (Stempelung der Silberbarren)50, Straßenerhaltung51, Kontrolle der Kreditgebarung der Mitglieder und: »Konditionenkartell«, würden wir sagen52: Feststellung der Lieferungs-53, Lager- und Zahlungsfristen, der Versicherungssätze und der Zinsraten54, Unterdrückung fiktiver oder sonst illegaler Geschäfte, Sorge für die ordnungsmäßige Abfindung der Gläubiger bei Geschäftsübertragung55, Regelung der Geldsortenkurse56, Bevorschussung von lange lagernden Waren57, für die Handwerker vor allem: Regulierung und Beschränkung der Lehrlingszahl58 und eventuell Wahrung des Produktionsgeheimnisses59. Einzelne Gilden verfügten über ein Millionenvermögen, angelegt oft in gemeinsamem Grundbesitz, erhoben Steuern von ihren Mitgliedern, Eintrittsgelder und Kautionen (für Wohlverhalten) von Neueintretenden, richteten Schauspiele aus und sorgten für das Begräbnis verarmter Genossen60.
Zu der Masse der Berufsverbände stand der Zutritt jedem, der das betreffende Gewerbe betrieb, offen (und war, normalerweise, für ihn pflichtmäßig). Aber es fanden sich nicht nur zahlreiche Reste alter, als tatsächlich erbliches Monopol oder geradezu erbliche Geheimkunst betriebener Sippen- und Stammesgewerbe61, sondern daneben auch Gildemonopole, welche durch die fiskalische oder fremdenfeindliche Politik der Staatsgewalt geschaffen wurden62. Und die leiturgische Bedarfsdeckung, zu welcher die chinesische Verwaltung im Mittelalter immer wieder periodisch überzugehen suchte, läßt es möglich erscheinen, daß der Uebergang vom inter ethnisch arbeitsteiligen Sippen- und Stammesgewerbe mit Wanderbetrieb zum ortssässigen frei zur Lehre zugänglichen Handwerk für manche Gewerbe durch Zwischenstufen zwangsmäßig von oben für Staatslieferungen organisierter und an den Beruf gebundener Gewerbeverbände hindurch sich vollzogen hat. Dies bedingte, daß in einem sehr breiten Teil des Gewerbes Sippen- und Stammesgewerbecharakter erhalten blieb. Unter den Han waren mannigfache gewerbliche Hantierungen noch strikte Familiengeheimnisse, und die Kunst der Herstellung von Fuchou-Lack z.B. starb in der Taiping-Rebellion völlig aus, weil die Sippe, die das Geheimnis hütete, ausgerottet war. Es fehlte im allgemeinen die städtische Monopolisierung des Gewerbes. Zwar die von uns als »Stadtwirtschaft« bezeichnete Art der lokalen Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land hatte sich entwickelt – wie sie es überall tat – und auch einzelne stadtwirtschaftspolitische Maßregeln finden sich. Aber jene Art systematischer Stadtpolitik, welche die zur Herrschaft gelangten Zünfte im Mittelalter – die ja die »Stadtwirtschafts politik« erst wirklich durchzuführen suchten – getrieben haben, ist trotz mancher Ansätze nie zur Vollendung gediehen. Insbesondere hat die öffentliche Gewalt zwar gelegentlich immer wieder zu leiturgischer Bindung gegriffen, nicht aber ein System von Zunftprivilegien geschaffen, wie es das hohe Mittelalter kannte. Gerade das Fehlen dieser rechtlichen Garantien verwies ja die Berufsverbände in China auf den Weg rücksichtsloser Selbsthilfe in einem Maß, wie sie im Okzident unbekannt blieb. Sie bedingte es auch, daß feste, öffentlich anerkannte, formale und verläßliche Rechts grundlagen einer freien, genossenschaftlich regulierten Handels- und Gewerbeverfassung, wie sie der Okzident kannte und wie sie der Entwicklung des Klein kapitalismus im abendländischen mittelalterlichen Gewerbe zugute kamen, in China fehlten. Daß sie fehlten, hatte seinen Grund in dem Fehlen einer eigenen politisch-militärischen Macht der Städte und Gilden, und diese Tatsache wiederum findet ihre Erklärung in der frühen Entwicklung der Beamten- (und: Offiziers-)Organisation in Heer und Verwaltung.
Für die Entstehung der seit aller sicheren geschichtlichen Erinnerung bestehenden Zentralgewalt und ihres Patrimonialbeamtentums ist in China, wie in Aegypten, die Notwendigkeit der Stromregulierung als Voraussetzung aller rationalen Wirtschaft entscheidend gewesen, wie sehr deutlich z.B. eine Bestimmung in einem bei Mencius erwähnten, ins 7. Jahrhundert vor Chr. verlegten, angeblichen Kartell der Feudalfürsten beweist63. Im Gegensatz zu Aegypten und Mesopotamien stand allerdings, wenigstens im nördlichen China, der politischen Keimzelle des Reiches, der Ueberschwemmungsschutz durch Deiche und der Kanalbau zu Binnenschiffahrtszwecken (vor allem: Fouragetransportzwecken) voran, nicht in gleichem Maß der Kanalbau zum Zweck der Bewässerung, an dem in Mesopotamien die Anbaufähigkeit des Wüstengebietes überhaupt hing. Die Stromregulierungsbeamten und die schon in sehr alten Dokumenten – damals als eine Klasse hinter den »Nährständen« und vor den »Eunuchen« und »Lastträgern« – erwähnte »Polizei« bildeten den Keim der präliterarischen, reinen Patrimonialbureaukratie –.
Es fragt sich, inwieweit diese Verhältnisse Konsequenzen nicht nur – wie fraglos ist – politischer, sondern auch religiöser Natur gehabt haben. Der Gott Vorderasiens war nach dem Modell des irdischen Königs geformt. Für den mesopotamischen und ägyptischen Untertan, der den Regen kaum kannte, hing alles Wohl und Wehe, vor allem die Ernte, an dem Tun des Königs und seiner Verwaltung. Der König »schuf« direkt die Ernte. Das war auch in einigen Teilen des südlichen China, wo die Wasserregulierung alles andere an Wichtigkeit überragte, wenigstens entfernt ähnlich, wenn auch nicht annähernd gleich zwingend. Der direkte Uebergang von dem Hackbau zur Gartenkultur war allerdings dadurch bedingt. Im nördlichen China stand dagegen, trotz der auch hier erheblichen Entwicklung der Bewässerung, die Frage der Naturereignisse, des Regens zumal, für die Ernte weit stärker im Vordergrund. In Vorderasien nun begünstigte die alte zentralisierte, bureaukratische Verwaltung unzweifelhaft die Möglichkeit der Vorstellung des höchsten Gottes als eines Himmelskönigs, der Welt und Menschen aus dem Nichts »geschaffen« hat und nun als überweltlicher ethischer Herrscher von der Kreatur die Leistung ihrer Pflicht und Schuldigkeit verlangt: – eine Gottesidee, die tatsächlich nur hier in dieser Stärke die Oberhand behalten hat. Sogleich ist jedoch hinzuzufügen: daß sie die Oberhand behielt, ist aus jenen ökonomischen Bedingungen allein nicht ableitbar. Auch in Vorderasien selbst ist der himmlische König ja gerade dort zur höchsten, schließlich – allerdings erst bei Deuterojesaja im Exil – zu einer schlechthin überweltlichen Machtstellung emporgestiegen, wo er, in Palästina im Gegensatz zu den Wüstengebieten, nach seiner Gnade Regen und Sonnenschein als Quelle der Fruchtbarkeit sandte64. Es spielten also offenbar andere Momente bei dem Gegensatz der Gotteskonzeptionen mit. Diese lagen zum erheblichen Teil nicht auf wirtschafts- sondern auf außen politischem Gebiet. Wir müssen da etwas weiter ausholen.
Der Gegensatz der vorder- und der ostasiatischen Gottesvorstellungen war keineswegs von jeher in starker Schroffheit vorhanden. Das chinesische Altertum kannte einerseits für jeden Lokalverband einen aus dem Geist des fruchtbaren Erdbodens (sehê) und dem Erntegeist (tsi) zusammengeschmolzenen, bereits als ethisch strafende Gottheit entwickelten bäuerlichen Doppelgott (sche-tsi) und andererseits die Tempel der Ahnengeister (tsong-miao) als Gegenstand des Sippenkults. Diese Geister zusammen (sche-tsi-tsong-miao) bildeten den Hauptgegenstand der ländlichen Lokalkulte, den zunächst wohl noch naturalistisch, als eine halbmaterielle magische Kraft oder Substanz vorgestellten Heimatsschutzgeist, dessen Stellung etwa jener des (schon früh wesentlich personaler vorgestellten) westasiatischen Lokalgottes entsprach. Mit steigender Fürstenmacht wurde der Geist des Acker landes zum Geist des Fürsten gebietes. Mit Entwicklung des vornehmen Heldentums entstand offenbar auch in China, wie meist, ein persönlicher Himmelsgott, etwa dem hellenischen Zeus entsprechend, vom Gründer der Tschou-Dynastie zusammen mit dem Lokalgeist in dualistischer Verbindung verehrt. Mit der Entstehung der kaiserlichen Macht, zunächst als oberlehensherrlicher Gewalt über den Fürsten, wurde das Opfer für den Himmel, als dessen »Sohn« der Kaiser galt, dessen Monopol; die Fürsten opferten den Geistern des Landes und der Ahnen, die Hausväter den Ahnengeistern des Geschlechts. Der, wie überall, so auch hier, animistisch-naturalistisch schillernde Charakter der Geister, vor allem des Himmelsgeistes (Schang-ti), der sowohl als der Himmel selbst wie als Himmelskönig vorgestellt werden konnte, wendete sich nun aber in China, gerade bei den mächtigsten und universellsten von ihnen, immer mehr ins Unpersönliche65, genau umgekehrt wie in Vorderasien, wo über die animistisch-halbpersönlichen Geister und die Lokalgottheit sich der persönliche überweltliche Schöpfer und königliche Regent der Welt heraushob. Die Gottesvorstellung der chinesischen Philosophen blieb lange höchst widerspruchsvoll. Für Wang Tschung noch war Gott zwar nicht anthropomorph zu fassen, aber er hatte doch einen »Leib«, eine Art Fluidum scheint es. Andererseits begründete der gleiche Philosoph seine Leugnung der Unsterblichkeit auch wieder mit der völligen »Formlosigkeit« Gottes, zu welcher der Menschengeist – ähnlich der israelitischen »ruach« – nach dem Tode zurückkehre: eine Auffassung, die auch in Inschriften Ausdruck gefunden hat. Immer stärker wurde aber die Nicht-Persönlichkeit gerade der höchsten überirdischen Mächte betont. In der konfuzianischen Philosophie verschwand die Vorstellung eines persönlichen Gottes, die noch im 11. Jahrhundert Vertreter fand, seit dem 12. Jahrhundert, unter dem Einfluß des noch von Kaiser Kang Hi (Verfasser des »Heiligen Ediktes«) als Autorität behandelten Materialisten Tsche Fu Tse. Daß sich diese Entwicklung zur Unpersönlichkeit66 nicht ohne dauernde Rückstände der Personalkonzeption vollzog, ist später zu erörtern. Gerade im offiziellen Kult aber gewann sie die Oberhand. – Auch im semitischen Orient war zunächst das fruchtbare Land, das Land mit natürlichem Wasser, »Land des Baal« und zugleich dessen Sitz, und auch hier wurde der bäuerliche Baal des Landes im Sinne des ertragbringenden Bodens zum Lokalgott des ortsgebundenen politischen Verbandes: des Heimatlandes. Aber dies Land galt nun dort als »Eigentum« des Gottes, und ein »Himmel«, der, nach chinesischer Art, unpersönlich und doch beseelt, als Konkurrent eines Himmelsherrn hätte auftreten können, wurde nicht konzipiert. Der israelitische Jahwe war zuerst ein bergsässiger Sturm- und Natur katastrophengott, der in Gewitter und Wolken den Helden zu Hilfe in den Krieg heranzog, der Bundesgott der kriegerisch erobernden Eidgenossenschaft, deren Verband durch Vertrag mit ihm, vermittelt durch seine Priester, unter seinen Schutz gestellt worden war. Dauernd blieb daher die auswärtige Politik seine Domäne, deren Interessenten auch alle größten unter seinen Propheten: diese politischen Publizisten in den Zeiten der ungeheuren Angst vor den mächtigen mesopotamischen Raubstaaten, waren. Durch diesen Umstand gewann er seine endgültige Formung: die auswärtige Politik war seine Tatenbühne mit Krieg und Völkerschicksal in ihren Peripetien. Deshalb war und blieb er zunächst und vor allem der Gott des Außer ordentlichen: des Kriegsschicksals, seines Volkes. Da aber dies Volk nicht selbst ein Weltreich schaffen konnte, sondern ein kleiner Staat inmitten der Weltmächte blieb und schließlich ihnen erlag, so konnte er ein »Weltgott« nur als überweltlicher Schicksalslenker werden, vor dessen Augen auch das eigene auserwählte Volk nur kreatürliche Bedeutung hatte, je nach seinem Verhalten bald gesegnet und bald verworfen wurde.
Demgegenüber wurde das chinesische Reich in historischer Zeit trotz aller Kriegszüge doch immer mehr ein befriedetes Weltreich. Zwar der Anfang der chinesischen Kulturentwicklung stand unter rein militaristischen Zeichen. Der schih, später der »Beamte«, ist ursprünglich der »Held«. Die spätere »Studienhalle« (Pi yung kung), in welcher, dem Ritual nach, der Kaiser persönlich die Klassiker auslegte, scheint ursprünglich ein »Männerhaus« (ἀνδρεῖον) in dem über fast die ganze Welt bei allen spezifischen Kriegs- und Jagdvölkern verbreiteten Sinn gewesen zu sein, das heißt: der Aufenthaltsort der Bruderschaft der durch die noch heute erhaltene »Bekappungs« -Zeremonie, zweifellos nach vorausgegangener Erprobung, wehrhaft gemachten Jungmannschaft in der Altersstufe ihrer familienfremden »Kasernierung«. In welchem Maß das typische Altersklassensystem dabei entwickelt war, bleibt fraglich. Daß die Frau ursprünglich die Ackerbestellung allein in der Hand hatte, scheint sich etymologisch wahrscheinlich machen zu lassen: jedenfalls aber nahm sie an den außer häuslichen Kulten nie teil. Das Männerhaus war offenbar das Haus des (charismatischen) Kriegshäuptlings: hier vollzogen sich diplomatische Aktionen, wie die Unterwerfung von Feinden, hier wurden die Kriegswaffen verwahrt, hierher die Trophäen (abgeschnittene Ohren) gebracht, im Verband der Jungmannschaft das rhythmische – das heißt: disziplinierte – Bogenschießen geübt, nach dessen Ergebnissen der Fürst sich seine Gefolgen und Amtsträger auswählte (daher die zeremoniale Bedeutung des Bogenschießens bis in die jüngste Zeit). Es ist möglich – wenn auch nicht sicher –, daß auch die Ahnengeister dort Rat spendeten. Trifft dies alles zu, dann würden dem die Nachrichten über die ursprüngliche Mutterfolge entsprechen: »Mutterrecht« scheint primär überall, soviel heut ersichtlich, die Konsequenz der militaristischen Familienfremdheit des Vaters gewesen zu sein67. In geschichtlicher Zeit lag das weit zurück. Der individuelle Heldenkampf, auch in China, wie anscheinend über die ganze Erde hin (bis Irland), durch die Verwertung des Pferdes, zunächst als Zugtier des Kriegswagens, auf die Höhe gebracht, ließ die infanteristisch orientierten Männerhäuser zerfallen: der hochtrainierte und kostspielig bewaffnete Einzelheld trat in den Vordergrund. Auch dies »homerische« Zeitalter Chinas lag aber weit zurück und es scheint, daß hier so wenig wie in Aegypten oder Mesopotamien die ritterliche Kriegs technik je zu einer so individualistischen Sozial verfassung geführt hat, wie im »homerischen« Hellas und im Mittelalter. Die Abhängigkeit von der Stromregulierung und damit von der fürstlichen bureaukratischen Eigenregie ist vermutlich das entscheidende Gegengewicht gewesen. Die Stellung von Kriegswagen und Gepanzerten wurde den einzelnen Bezirken auferlegt, ähnlich wie in Indien. Kein persönlicher Kontrakt also, wie beim okzidentalen Lehensverband, sondern die katastermäßig reglementier te Gestellungspflicht war die Grundlage auch des Ritterheeres. Doch immerhin war der »vornehme Mann« Kiün tse, (gentleman), des Konfuzius ursprünglich der waffengeübte Ritter. Aber die Wucht der statischen Tatsachen des Wirtschaftslebens ließ die Kriegsgötter nie zu einem Olymp aufsteigen: der chinesische Kaiser vollzog den Ritus des Pflügens, er war ein Schutzpatron des Ackerbauers geworden und also längst nicht mehr ein Ritterfürst. Zwar die rein chthonischen Mythologeme68 haben keine beherrschende Bedeutung erlangt. Aber seit der Herrschaft der Literaten war die zunehmend pazifistische Wendung der Ideologien naturgegeben, – und: umgekehrt, wie wir sehen werden.
Der Himmelsgeist wurde nun – zumal nach der Vernichtung des Feudalismus – im Volks glauben ganz wie die ägyptischen Gottheiten aufgefaßt nach Art einer idealen Beschwerdeinstanz gegen die irdischen Amtsträger, vom Kaiser angefangen bis zum letzten Beamten. Wie in Aegypten (und in nicht ganz so ausgeprägter Art auch in Mesopotamien) aus dieser bureaukratischen Vorstellung heraus der Fluch des Bedrückten und Armen besonders gefürchtet war: – wir werden sehen, wie das auf die benachbarte israelitische Ethik zurückwirkte –, so auch in China. Diese Vorstellung und nur sie stand, als eine Art superstitiöser Magna Charta, und zwar als eine schwer gefürchtete Waffe, den Untertanen gegen die Beamten und ebenso gegen alle Privilegierten, auch die Besitzenden, zur Seite: ein ganz spezifisches Merkmal bureaukratischer und zugleich pazifistischer Gesinnung.
Die Zeit irgendwelcher wirklicher Volkskriege jedenfalls liegt in China jenseits der historischen Epochen. Freilich war mit der bureaukratischen Staatsordnung die kriegerische Epoche Chinas nicht abgebrochen. Sie führte seine Heere nach Hinterindien und bis in die Mitte von Turkestan. Die älteren literarisch-dokumentarischen Quellen rühmen allen andern voran den Kriegs helden. In historischer Zeit ist nach der offiziellen Auffassung allerdings nur einmal ein siegreicher General als solcher vom Heer zum Kaiser proklamiert worden (Wang Mang um Chr. G); – tatsächlich ist natürlich das gleiche weit öfter geschehen, aber in den rituell gebotenen Formen oder durch rituell anerkannte Eroberung oder Revolte gegen einen rituell inkorrekten Kaiser. In der für die Prägung der geistigen Kultur entscheidenden Zeit zwischen 8. und 3. Jahrhundert vor Chr. war das Reich ein sehr lockerer Verband politischer Herrschaften, welche zwar sämtlich formell die Oberlehensherrlichkeit des politisch ohnmächtig gewordenen Kaisers anerkannten, aber untereinander in Fehde und vor allem im Kampf um die Hausmeierstellung standen. Der Unterschied gegenüber dem Heiligen Römischen Reich des Okzidents bestand vor allem darin, daß der kaiserliche Oberlehensherr zugleich und vor allem – ein in vorgeschichtliche Zeit zurückreichender wichtiger Sachverhalt – nach Art etwa des okzidentalen Papstes in der von Bonifaz VIII. beanspruchten Stellung: der legitime Ober priester war. Diese unentbehrliche Funktion bedingte seine Erhaltung. Durch sie bildete er ein wesentliches Element des Kulturzusammenhalts der in ihrem Umfang und ihrer Machtstellung stetig wechselnden Teilstaaten. Die (wenigstens theoretische) Gleichheit des Rituals bildete den Kitt jenes Zusammenhalts. Hier wie im okzidentalen Mittelalter bedingte diese religiöse Einheit die rituelle Freizügigkeit der vornehmen Familien zwischen den Teilstaaten: aus dem Dienst des einen Fürsten trat der vornehme Staatsmann rituell ungehemmt in den Dienst eines anderen über. Die Herstellung des Einheitsreichs seit dem 3. Jahrhundert vor Chr., welche seitdem nur auf kurze Zeiten unterbrochen wurde, befriedeten das Reich – wenigstens dem Prinzip und der Theorie nach – nach innen. »Rechtmäßige« Kriege waren seitdem in seinem Innern nicht mehr möglich. Die Abwehr und Unterwerfung der Barbaren aber war eine rein sicherheitspolizeiliche Aufgabe der Regierung. Der »Himmel« konnte daher hier nicht die Form eines in Krieg, Sieg, Niederlage, Exil und Heimatshoffnung verehrten, in der Irrationalität der außenpolitischen Schicksale des Volks sich offenbarenden Heldengottes annehmen. Dafür waren, wenn man von der Zeit der Mongolenstürme absieht, seit der Errichtung der großen Mauer diese Schicksale im Prinzip nicht mehr wichtig und nicht irrational genug, standen gerade in den Zeiten der ruhigen Entwicklung der religiösen Spekulation nicht greifbar genug, als drohende oder als überstandene Fügungen, als beherrschende Probleme der ganzen Existenz, jederzeit vor Augen, waren vor allem nicht eine Angelegenheit der Volks genossen. Die Untertanen wechselten nur den Herren bei Thronusurpationen ebenso wie bei gelungenen Invasionen, und in beiden Fällen bedeutete dies lediglich einen Wechsel des Steuerempfängers, nicht einen Wechsel der sozialen Ordnung69. Die Jahrtausende alte unerschütterte Ordnung des politischen und sozialen Innenlebens wurde daher hier das, was der göttlichen Obhut anheimfiel und sie offenbarte. Auch der israelitische Gott nahm von den sozialen Innenbeziehungen Notiz: als Anlaß der Bestrafung seines Volkes wegen Abfalls von den von ihm eingesetzten alten Bundesordnungen durch kriegerisches Mißgeschick. Aber diese Verletzungen waren, gegenüber der weit wichtigeren Abgötterei, nur eine Kategorie der Sünde unter anderen. Für die chinesische Himmelsmacht dagegen waren die alten sozialen Ordnungen Eins und Alles. Als Hüter ihrer Stetigkeit und ungestörten Geltung und als Hort der durch die Herrschaft vernünftiger Normen garantierten Ruhe, nicht als Quelle irrationaler, befürchteter oder erhoffter, Schicksalsperipetien, waltete der Himmel. Solche Peripetien waren Unruhe und Unordnung. Sie waren daher spezifisch dämonischen Ursprungs. Die Garantie der Ruhe und inneren Ordnung leistete am besten eine in ihrer Unpersönlichkeit und gerade durch sie als über alles Irdische spezifisch erhaben qualifizierte Macht, welcher Leidenschaft, und vor allem »Zorn«: das wichtigste Attribut Jahwes, fremd bleiben mußte. Diese politischen Grundlagen des chinesischen Lebens also begünstigten den Sieg derjenigen Elemente des Geisterglaubens, welche zwar überall in aller zum Kult sich entwickelnden Magie vorgeformt waren, aber im Okzident durch die Entfaltung der Heldengötter und, endgültig, eines persönlichen ethischen Welterlösergottes von Plebejer schichten, in der Entwicklung gebrochen wurden. Die eigentlich chthonischen Kulte mit ihrer typischen Orgiastik sind zwar auch in China durch die Ritter- und später die Literatenaristokratie ausgetilgt worden70. Es finden sich weder Tänze – der alte Kriegstanz war verschwunden – noch Sexualorgiastik, noch musikalische Orgiastik, noch andere Rauschformen, kaum auch Rückstände vor, und nur ein einziger Ritualakt scheint »sakramentalen« Charakter angenommen zu haben; aber gerade er war ganz unorgiastisch. Der Himmelsgott siegte auch hier: – die Philosophen motivierten dies nach Se Ma Tsien's Konfuzius-Biographie damit: daß die Götter der Berge und Wasserbäche die Welt regieren, weil von den Bergen der Regen kommt. Aber er siegte als Gott der himmlischen Ordnung, nicht der himmlischen (Kriegs-)Heerscharen. Es war die spezifisch chinesische, aus andern Gründen und in anderer Art auch in Indien in der Oberhand gebliebene Wendung der Religiosität, welche an der Unverbrüchlichkeit und Gleichmäßigkeit des die Geister zwingenden magischen Rituals und des für ein Ackerbauvolk grundlegenden Kalenders, beide: die Naturgesetze und die Ritualgesetze in Eins setzend und nun an diese Einheit des »Tao«71 anknüpfend, das Zeitlose, Unabänderliche zur religiös höchsten Macht erhob. Nun wurde statt eines überweltlichen Schöpfergottes ein übergöttliches, unpersönliches, immer sich gleiches, zeitlich ewiges Sein, welches zugleich ein zeitloses Gelten ewiger Ordnungen war, als letztes und höchstes empfunden. Die unpersönliche Himmelsmacht »sprach nicht« zu den Menschen. Sie offenbarte sich ihnen durch die Art des irdischen Regimentes, also in der festen Ordnung der Natur und des Herkommens, das ein Teil der kosmischen Ordnung war, und – wie überall: – durch das, was den Menschen geschah. Gutes Ergehen der Untertanen dokumentierte die himmlische Zufriedenheit, also: das richtige Funktionieren der Ordnungen. Alle schlimmen Ereignisse dagegen waren Symptome einer Störung der providentiellen himmlisch-irdischen Harmonie durch magische Gewalten. Diese für China durchaus grundlegende optimistische Vorstellung von der kosmischen Harmonie ist aus dem primitiven Geisterglauben allmählich herausgewachsen. Das Ursprüngliche72 war hier wie anderwärts der Dualismus der guten (nützlichen) und der bösen (schädlichen) Geister, der »Shen« und der »Kwei«, welche das ganze Universum erfüllten und in den Naturereignissen ebenso wie im Handeln und Ergehen der Menschen sich äußerten. Auch die »Seele« des Menschen galt – entsprechend der überall verbreiteten Annahme von einer Mehrheit der beseelenden Kräfte – als zusammengesetzt aus der dem Himmel entstammenden Shen- und der irdischen Kwei-Substanz, welche sich nach dem Tode wieder trennten. Die allen Philosophenschulen gemeinsame Lehre faßte dann die »guten« Geister als das (himmlische und männliche) Yang-Prinzip, die »bösen« als das (irdische und weibliche) Yin-Prinzip zusammen, aus deren Verbindung die Welt entstanden sei. Beide Prinzipien waren ewig, wie Himmel und Erde. Dieser konsequente Dualismus war aber hier, wie fast überall, optimistisch abgeschwächt und getragen durch die Identifikation des dem Menschen Heil bringenden magischen Charisma der Zauberer und Helden mit den heilbringenden Shen-Geistern, die der segenspendenden Himmelsmacht, dem Yang, entsprangen. Da nun der charismatisch qualifizierte Mensch offensichtlich Macht über die bösen Dämonen (die Kwei) hatte, und feststand: daß die Himmelsmacht die gütige höchste Leiterin auch des sozialen Kosmos war, so mußten also die Shen-Geister im Menschen und in der Welt in ihrem Funktionieren gestützt werden73. Dazu genügte es aber, daß die dämonischen kwei-Geister in Ruhe gehalten wurden: dann funktionierte die vom Himmel geschützte Ordnung richtig. Denn ohne Zulassung des Himmels waren die Dämonen unschädlich. Die Götter und Geister waren mächtige Wesen. Kein einzelner Gott oder vergötterter Heros oder noch so mächtiger Geist aber war »allwissend« oder »allmächtig«. Die nüchterne Lebensweisheit der Konfuzianer konstatierte im Fall des Unglücks frommer Menschen unbefangen: daß »Gottes Wille oft unstet« sei. Alle diese übermenschlichen Wesen waren zwar stärker als der Mensch, standen aber tief unter der unpersönlichen höchsten Himmelmacht und auch unter einem kaiserlichen Pontifex, der in der Himmelsgnade stand. Nur diese und die ihr ähnlichen unpersönlichen Mächte kamen – im Gefolge dieser Vorstellungen – für die überpersönliche Gemeinschaft als Kultobjekte in Betracht und bestimmten ihr Schicksal74. Das Schicksal des einzelnen konnten dagegen die magisch zu beeinflussenden Einzelgeister bestimmen.
Mit diesen verkehrte man ganz urwüchsig auf dem Tauschfuß: soundsoviel rituelle Leistungen für soundsoviel Wohltaten. Zeigte sich dann, daß ein Schutzgeist nicht stark genug war, die Menschen trotz aller Opfer und Tugenden zu schützen, so mußte man ihn wechseln. Denn nur der Geist, der sich als wirklich machtvoll bewährte, verdiente Verehrung. Ein solcher Wechsel geschah tatsächlich oft und insbesondere der Kaiser verlieh den Göttern, die sich bewährt hatten, Anerkennung als Objeketn der Verehrung, Titel und Rang75 und setzte sie eventuell wieder ab. Nur das bewährte Charisma eines Geistes legitimierte. Zwar war – wie gleich zu besprechen – der Kaiser für Unglück verantwortlich. Aber auch dem Gott, der durch Los-Orakel oder sonstige Weisungen ein mißglücktes Unternehmen veranlaßt hatte, gereichte dies zur Schande. Noch 1455 hielt ein Kaiser dem Geist des Tsai-Berges offiziell eine strafende Rede. Und in anderen Fällen wurden solchen Geistern Kulte und Opfer gesperrt. Der »Rationalist« unter den großen Kaisern und Einiger des Reichs: Schi-hoang-ti, ließ einen Berg zur Strafe dafür, daß der Geist sich renitent gezeigt und ihm den Zutritt erschwert hatte, kahlschlagen, wie Se Ma Tsien in dessen Biographie er wähnt.
Ihm, dem Kaiser selbst, ging es aber natürlich, getreu dem charismatischen Prinzip der Herrschaft, ganz ebenso. Von dieser eingelebten politischen Realität ging ja diese ganze Konstruktion aus. Auch er mußte sich durch seine charismatischen Qualitäten als vom Himmel zum Herrscher berufen bewähren. Das entsprach durchaus den – erbcharismatisch temperierten – genuinen Grundlagen charismatischer Herrschaft. Charisma war überall eine außeralltägliche Kraft (maga, orenda), deren Vorhandensein sich in Zaubermacht und Heldentum offenbarte, bei den Novizen aber durch Erprobung in der magischen Askese festgestellt (je nach der Abwandlung der Vorstellung auch: als »neue Seele« erworben) werden mußte. Die charismatische Qualität war aber (ursprünglich) verlierbar: der Held oder Magier konnte von seinem Geist oder Gott »verlassen« werden. Nur solange sie sich bewährte: durch immer neue Wunder und immer neue Heldentaten, mindestens aber: dadurch, daß der Magier oder Held nicht sich selbst und seine Gefolgschaft offenkundigen Mißerfolgen aussetzte, erschien ihr Besitz gewährleistet. Heldenstärke galt ursprünglich ja ebenso als magische Qualität wie die im engeren Sinne »magischen« Kräfte: Regenzauber, Krankheitszauber und die außeralltäglichen technischen Künste76. Entscheidend für die Kulturentwicklung war wesentlich Eins: die Frage, ob das militärische Charisma des Kriegsfürsten und das pazifistische Charisma des (in der Regel: meteorologischen) Zauberers beide in einer Hand lagen oder nicht. Im ersten Fall (dem des »Cäsaropapismus«) aber: welches von beiden primär die Grundlage der Entwicklung der Fürstenmacht wurde. In China nun haben – wie früher schon eingehend dargelegt wurde – grundlegende, für uns aber vorhistorische Schicksale, vermutlich durch die große Bedeutung der Stromregulierung mitbedingt77, das Kaisertum aus dem magischen Charisma hervorgehen lassen und weltliche und geistliche Autorität in einer Hand, jedoch unter sehr starkem Vorwalten der letzteren, vereinigt. Das magische Charisma des Kaisers mußte sich zwar auch in kriegerischen Erfolgen (oder doch dem Fehlen eklatanter Mißerfolge), vor allem aber in gutem Erntewetter und gutem Stande der inneren Ruhe und Ordnung bewähren. Die persönlichen Qualitäten aber, die er, um charismatisch begnadet zu sein, besitzen mußte, wurden von den Ritualisten und Philosophen ins Rituelle und weiterhin ins Ethische gewendet: er mußte den rituellen und ethischen Vorschriften der alten klassischen Schriften entsprechend leben. Der chinesische Monarch blieb so in erster Linie ein Pontifex: der alte »Regenmacher« der magischen Religiosität78, ins Ethische übersetzt. Da der ethisch rationalisierte »Himmel« eine ewige Ordnung schützte, waren es ethische Tugenden79 des Monarchen, an denen sein Charisma hing. Er war, wie alle genuin charismatischen Herrscher, ein Monarch von Gottes Gnaden nicht in der bequemen Art moderner Herrscher, welche auf Grund dieses Prädikates beanspruchten, für begangene Torheiten »nur Gott«, und das heißt praktisch: gar nicht, verantwortlich zu sein. Sondern im alten genuinen Sinne der charismatischen Herrschaft. Das hieß nach dem soeben Ausgeführten: er hatte sich als »Sohn des Himmels«, als der von ihm gebilligte Herr, dadurch auszuweisen: daß es dem Volke gut ging. Konnte er das nicht, so fehlte ihm eben das Charisma. Brachen also die Flüsse durch die Deiche, blieb der Regen trotz aller Opfer aus, so war dies, wie ausdrücklich gelehrt wurde, ein Beweis, daß der Kaiser jene charismatischen Qualitäten nicht besaß, welche der Himmel verlangte. Er tat dann – so noch in den letzten Jahrzehnten – öffentlich Buße für seine Sünden. Ein solches öffentliches Sündenbekenntnis verzeichnet die Annalistik schon für die Fürsten des Feudalzeitalters80 und die Sitte hat bis zuletzt fortbestanden: noch 1832 folgte auf eine solche öffentliche Beichte des Kaisers alsbald der Regen81. Wenn auch das nicht half, hatte er Absetzung, in der Vergangenheit wohl Opferung, zu gewärtigen. Er war der amtlichen Rüge der Zensoren ausgesetzt82 wie die Beamten. Vollends ein Monarch, welcher den alten festen sozialen Ordnungen, einem Teil des Kosmos, der als unpersönliche Norm und Harmonie über allem Göttlichen stand, zuwiderhandelte: – der z.B. etwa das absolute göttliche Naturrecht der Ahnenpietät alteriert hätte –, würde damit (nach der immerhin nicht schlechthin gleichgültigen Theorie) gezeigt haben, daß er von seinem Charisma verlassen und unter dämonische Gewalt geraten war. Man durfte ihn töten, denn er war ein Privatmann83. Nur war die dafür zuständige Macht natürlich nicht jedermann, sondern es waren das die großen Beamten (etwa so wie bei Calvin die Stände das Widerstandsrecht hatten)84. Denn auch der Träger der staatlichen Ordnung: das Beamtentum, galt als mitbeteiligt am Charisma85 und daher in gleichem Sinn als eine Institution heiligen Rechtes, wie der Monarch selbst, mochte auch der einzelne Beamte persönlich, wie bis in die Gegenwart, ad nutum amovibel sein. Auch ihre Eignung war daher charismatisch bedingt: jede Unruhe oder Unordnung sozialer oder kosmisch-meteorologischer Art in ihrem Sprengel bewies: daß sie nicht die Gnade der Geister hatten. Ohne alle Frage nach Gründen mußten sie dann aus dem Amt weichen.