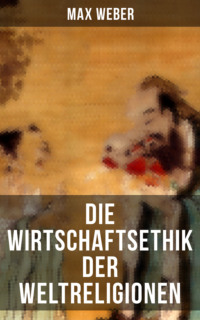Kitabı oku: «Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen», sayfa 7
Wie bei ausgedehnten patrimonialstaatlichen Gebilden unter unentwickelter Verkehrstechnik durchweg, so blieb auch hier das Maß der Zentralisation der Verwaltung eng begrenzt. Auch nach Durchführung des Beamtenstaates blieb nicht nur der Gegensatz der »inneren«, d.h. im altkaiserlichen Patrimonium angestellten, zu den »äußeren«, den Provinzialbeamten und der Rangunterschied beider bestehen, sondern es blieb – mit Ausnahme einer Anzahl der höchsten Aemter in jeder Provinz – die Aemterpatronage und vor allem, nach stets neuen vergeblichen Zentralisationsversuchen, fast die gesamte Finanzwirtschaft schließlich den einzelnen Provinzen überlassen. Darum ist freilich in allen großen Finanzreformperioden immer erneut gekämpft worden. Wang-An-Schi (11. Jahrhundert) ebenso wie andre Reformer haben die effektive Durchführung der Finanzeinheit: Ablieferung aller Steuererträge nach Abzug der Kosten der Erhebung und: Reichsbudget, gefordert. Die ungeheuren Transportschwierigkeiten und das Interesse der Provinzialbeamten haben stets wieder Wasser in diesen Wein gegossen. Außer unter ganz ungewöhnlich energischen Herrschern haben die Beamten – wie schon die Zahlen der publizierten Katastrierungen ergaben – ganz regelmäßig sowohl die steuerpflichtige Fläche als die Kopfzahl der Zensiten um ca. 40% zu niedrig angegeben136. Die lokalen und provinzialen Unkosten mußten ferner natürlich vorabgezogen werden. Dann aber ergab sich für den Zentralfiskus eine höchst schwankende Resteinnahme. Schließlich kapitulierte er: Die Statthalter wurden seit Anfang des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart wenigstens der Tatsache nach ähnlich den persischen Satrapen auf einen in Normal pauschalien festgesetzten, nur theoretisch nach Bedarf variablen, Tribut gesetzt. Davon wird noch zu reden sein. Diese Steuerkontingentierung hatte Folgen für die Machtstellung der Provinzialstatthalter auf allen Gebieten.
Sie präsentierten die meisten Beamten des Bezirkes zur Anstellung. Diese erfolgte zwar durch die Zentralgewalt. Aber schon die kleine Zahl der offiziellen Beamten137 führt zu dem Schluß: daß unmöglich sie selbst die Verwaltung ihrer riesigen Sprengel zu führen in der Lage sein konnten. Bei den schlechthin alles umfassenden Pflichten eines chinesischen Beamten konnte ein Bezirk vom Umfang eines preußischen Kreises, der einen Beamten hatte, selbst von Hunderten solcher nicht sachgemäß verwaltet werden. Das Reich glich einer Konföderation von Satrapien mit pontifikaler Spitze. Die Macht lag formell – auch nur: formell – bei den großen Provinzialbeamten. Die Kaiser ihrerseits aber verwendeten nach der Schaffung der Reichseinheit in ingeniöser Weise die dem Patrimonialismus eigentümlichen Mittel der Erhaltung ihrer persönlichen Gewalt: kurze Amtsfristen: offiziell drei Jahre, nach deren Ablauf der Beamte in eine andere Provinz versetzt werden sollte138, Verbot der Anstellung eines Beamten in seiner Heimatprovinz, Verbot der Anstellung von Verwandten im gleichen Sprengel, und ein systematisches Spionagesystem in Gestalt der sogenannten »Zensoren«. All dies aber, ohne damit – aus gleich zu erwähnenden Gründen, – sachlich eine präzise Einheitlichkeit der Verwaltung herzustellen. Das Prinzip, in den zentralen Kollegialbehörden den Präsidenten des einen Yamen zugleich als Mitglied anderer Kollegien anderen zu unterstellen, hemmte die Präzision der Verwaltung, ohne die Einheitlichkeit wesentlich zu fördern. Erst recht versagte sie gegenüber den Provinzen. Die einzelnen großen lokalen Verwaltungsbezirke bestritten, sahen wir – mit gelegentlichen Unterbrechungen in Zeiten starker Herrscher – ihre heimischen Ausgaben aus den Steueraufkünften vorab und machten falsche Katasterangaben. Soweit die Provinzen finanziell – als Militär- oder Arsenalstandorte – »passiv« waren, bestand ein verwickeltes System von Anweisungen auf die Einnahmen der Ueberschußprovinzen und im übrigen kein verläßlicher Etat, weder der Zentrale noch der Provinzen, sondern traditionelle Appropriationen. Klarer Einblick in die Finanzen der Provinzen fehlte der Zentralgewalt, wir werden sehen mit welchem Resultat. Bis in die letzten Jahrzehnte waren es die Provinzialstatthalter und nicht die Zentralregierung: – die dafür nicht einmal ein Organ besaß –, welche die Verträge mit den fremden Mächten abschlossen. Fast alle wirklich wichtigen Verwaltungsanordnungen gingen formell von den Provinzialstatthaltern, in Wahrheit, wie wir sehen werden, von den ihnen untergeordneten, und zwar den unoffiziellen, Beamten aus. Die Anordnungen der Zentralgewalt wurden daher bis in die Gegenwart von den Unterinstanzen oft mehr als ethisch maßgebliche Vorschläge oder Wünsche, denn als Befehle behandelt, wie dies ja der pontifikalen, charismatischen, Natur des Kaisertums entsprach. Sie stellten auch inhaltlich, wie jeder Blick zeigt, mehr Kritiken der Amtsführung als Anordnungen dar. Der einzelne Beamte persönlich war freilich jederzeit frei absetzbar. Aber die reale Macht der Zentralgewalt zog davon keinen Vorteil. Denn das Prinzip: keinen Beamten in seiner Heimatprovinz anzustellen, und der vorschriftsmäßige dreijährige Wechsel von Provinz zu Provinz oder doch von Amt zu Amt, führte zwar dazu, daß diese Beamten der Zentralgewalt gegenüber nicht zu selbständigen Mächten nach Art feudaler Vasallen emporwuchsen und daß also die äußerliche Einheit des Reichs erhalten blieb. Aber um den Preis: daß diese offiziellen Beamten in ihren Amtssprengeln niemals bodenständig wurden. Der Mandarin, welcher, begleitet von einer ganzen Schar von Sippengenossen, Freunden und persönlichen Klienten, sein Amt in einer ihm unbekannten Provinz antrat, deren Dialekt er in aller Regel nicht verstand, war zunächst schon sprachlich meist auf die Dienste eines Dolmetschers angewiesen. Er kannte ferner das örtliche Recht der Provinz nicht, welches auf zahlreichen Präzedenzfällen beruhte, die er – da sie der Ausdruck heiliger Tradition waren – nicht ohne Gefahr zu verletzen wagen durfte. Und er war deshalb völlig abhängig von den Belehrungen eines unoffiziellen, ebenso wie er selbst literarischen, aber mit den örtlichen Gewohnheiten kraft örtlicher Abstammung genau vertrauten Beraters, einer Art von »Beichtvater«, der als sein »Lehrer« bezeichnet und von ihm mit Respekt, oft mit Devotion, behandelt wurde. Nächstdem war er abhängig von seinen nicht zu den offiziellen, vom Staat bezahlten, dem Fremdbürtigkeitszwang unterliegenden Beamten, sondern zu dem von ihm aus seiner Tasche zu bezahlenden unoffiziellen Beamtenstab gehörigen Gehilfen. Diese wählte er naturgemäß aus der Zahl der aus der Provinz gebürtigen, zum Staatsdienst qualifizierten, aber noch nicht mit einem Amt beliehenen Amtsanwärter, auf deren örtliche Personen- und Sachkunde er sich verlassen konnte, aber auch, in Ermangelung aller eigener Orientiertheit, mußte. Und endlich war er, wenn er einen Gouverneurposten in einer neuen Provinz übernahm, abhängig von der geschulten Sach- und Ortskunde der Chefs der üblichen Ressorts139 jeder Provinz, welche immerhin einige Jahre Kenntnis der örtlichen Verhältnisse vor ihm voraus hatten. Es ist völlig klar, was die Folge sein mußte: die wirkliche Macht lag in der Hand jener unoffiziellen, ortsgebürtigen Unterbeamten, welche in ihrer Geschäftsführung zu kontrollieren und zu korrigieren ganz außerhalb der Macht der offiziellen Beamten lag, und ihnen um so weniger möglich war, je höher ihr eigener Rang war. Die Orientiertheit sowohl der von der Zentralverwaltung angestellten Lokal- wie der Zentralbeamten über die lokalen Verhältnisse war daher viel zu labil, um konsequent und rational durchgreifen zu können.
Das weltberühmte und höchst wirksame Mittel des chinesischen Patrimonialismus, eine feudal-ständische Emanzipation der Amtsträger von ihrer Macht zu unterbinden: die Einführung der Examina und die Verleihung der Aemter nach Bildungsqualifikationen, statt nach Geburt und ererbtem Rang, war zwar für den Charakter der chinesischen Verwaltung und Kultur von einschneidendster Bedeutung, wie später zu besprechen sein wird. Aber einen präzis funktionierenden Mechanismus in den Händen der Zentralin stanz vermochte man angesichts jener Verhältnisse dadurch nicht herzustellen. Wir werden aber, wenn wir auf die Beamtenbildung näher zu sprechen kommen, sehen, daß dem auch Hindernisse, die aus der innersten Eigenart der (zum Teil religiös bedingten) Standesethik des Beamtentums folgten, sich in den Weg stellten. Die Patrimonialbureaukratie war zwar in China wie im Okzident der feste Kern, an dessen Entfaltung die Bildung des Großstaats anknüpfte. Das Auftreten von Kollegialbehörden und die Entwicklung von »Ressorts« waren dabei hier wie dort die typischen Erscheinungen. Aber der »Geist« der bureaukratischen Arbeit war hier und dort – wie wir sehen werden – ein überaus verschiedener.
Soweit dieser abweichende »Geist« auf rein soziologischen Momenten beruhte, hing er mit dem System der öffentlichen Lasten zusammen, wie es sich in China in Verbindung mit dem Schwanken der Geldwirtschaft entwickelt hatte.
Der ursprüngliche Zustand war hier wie anderwärts der: daß dem Häuptling bzw. Fürsten ein Ackerlos (Kong tien, dem homerischen τέμενος entsprechend) ausgewiesen und von den Volksgenossen gemeinsam bestellt wurde140. Hier liegt der Ursprung der allgemeinen Fronpflicht, die dann in der zwingenden Notwendigkeit der Wasserbauten ihre weitere Stütze fand. Diese »Schaffung« des Landes durch die Strom bauverwaltung legte auch den immer wieder auftauchenden und noch jetzt (wie in England) terminologisch erhaltenen Gedanken des Bodenregals des Kaisers nahe, – der aber die Scheidung verpachteter Domänen und besteuerten Privatlandes hier so wenig wie in Aegypten hinderte. Die Steuern andrerseits scheinen sich teils – nach einzelnen Resten in der Terminologie – aus den üblichen Geschenken, teils aus Tributpflichten Unterworfener, teils aus dem Bodenregalanspruch entwickelt zu haben. Staatsland, Steuerpflicht, Fronpflicht standen in wechselnden Relationen dauernd nebeneinander. Was von ihnen vorwog, richtete sich teils nach dem jeweiligen Grade der – wie wir sahen, aus Valutagründen höchst labilen – Geldwirtschaft des Staats, teils nach dem Grade der Befriedung, teils schließlich nach dem Maß der Verläßlichkeit des Beamtenapparats.
Die ursprüngliche Herkunft des Patrimonialbeamtentums aus der Vorflut- und Kanalisierungsarbeit, also aus dem Bauwesen, die Herkunft der Machtstellung des Monarchen aus den, zunächst im Wasserregulierungsinteresse, unumgänglichen Fronden der Untertanen (wie in Aegypten und Vorderasien), die Herkunft des Einheitsreichs aus dem immer weiter um sich greifenden Interesse an Einheitlichkeit dieser Wasserregulierung für immer größere Gebiete im Zusammenhang mit dem Bedürfnis nach politischer Sicherung des Kulturlandes gegen die Nomadeneinbrüche drücken sich anschaulich darin aus, daß nach der Legende der »heilige« (legendäre) Kaiser Yü die Vorflut und den Kanalbau reguliert, und der erste rein bureaukratische Herrscher, der »Schi Hoang Ti«, zugleich als größter Bauherr für Kanäle, Straßen und Festungen und, vor allem, als Erbauer der großen Mauer galt (die in Wahrheit von ihm nur zu einem gewissen Abschluß gebracht wurde). Diese Bauten dienten sämtlich, neben der Bewässerung, fiskalischen, militärischen und Verproviantierungsinteressen, der berühmte Kaiserkanal vom Yangtse zum Hoangho z.B. dem Transport des Reistributs aus dem Süden nach der neuen Hauptstadt (Peking) des Mongolenkhans141. 50000 Fronarbeiter waren in einem bestimmten Zeitpunkt nach einem amtlichen Bericht an der Eindeichung eines Flusses beschäftigt und die Bauzeiten erstreckten sich über viele Jahrhunderte stückweiser Fertigstellung. Als die eigentlich ideale Form der Deckung des öffentlichen Bedarfes galt noch dem Mencius die Fron und nicht die Steuer. Wie in Vorderasien siedelte der König seine Untertanen trotz ihres Widerstandes um, nachdem die Divination den geeigneten Ort für eine neue Hauptstadt bezeichnet hatte. Teils strafweise Deportierte, teils im Wege der Zwangsrekrutierung beschaffte Soldaten bewachten die Deiche und Schleusen und stellten einen Teil der Arbeitskräfte für die Bauten und Rodungen. Schritt für Schritt wurde in den Grenzprovinzen des Westens durch die Arbeitskräfte des Heeres der Wüste Boden abgewonnen142. Schwermütige Klagen über die furchtbare Last dieses eintönigen Schicksals, vor allem bei den Fronden an der großen Mauer, finden sich in erhaltenen Gedichten143. Die klassische Lehre mußte sehr nachdrücklich gegen die Vergeudung der Untertanenfronden zu privaten fürstlichen Bauzwecken nach ägyptischer Art Front machen, welche auch hier die Begleiterscheinung der Entwicklung einer bureaukratischen Organisation der öffentlichen Arbeiten war. Anderseits: sobald das Fronsystem in Verfall geriet, begann nicht nur in den zentralasiatischen Gebieten das Vordringen der Wüste auf Kosten des ihr abgerungenen, heute völlig versandeten Kulturbodens144, sondern wankte die politische Leistungsfähigkeit des Reichs überhaupt. Ueber die mangelhafte Bestellung der Krongüter durch die Bauern wird in den Annalen geklagt. Nur Ausnahmepersönlichkeiten vermochten den Fronstaat einheitlich zu organisieren und zu leiten.
Die Fron blieb aber die klassische Form der Staatsbedarfsdeckung. Wie naturalwirtschaftliche (durch Fronden bewirkte) und geldwirtschaftliche (durch Submission bewirkte) Deckung der Staatsbedürfnisse sich praktisch zueinander verhielten, zeigt (für das 17. Jahrhundert) eine Erörterung vor dem Kaiser über die Frage, nach welchem von beiden Systemen gewisse Reparaturen am Kaiserkanal zu bewerkstelligen seien. Man beschloß, die Bauten gegen Geld zu vergeben, da sonst die Reparaturen zehn Jahre in Anspruch genommen hätten145. Eine Entlastung der Zivilbevölkerung wurde immer wieder – in Friedenszeiten – durch Heranziehung des Heeres zum Frondienst versucht146.
Neben den Militärgestellungen, Fronden und Leiturgien finden sich schon in früher Zeit Steuern. Die Fron auf dem Königsland scheint besonders früh (im 6. Jahrhundert v. Chr.) im Teilstaat Tsin abgeschafft zu sein, dessen Herrscher später (im 3. Jahrhundert v. Chr.) der »erste Kaiser« des Gesamtreiches wurde.
Abgaben haben natürlich schon in weit älterer Zeit existiert. Die Bedürfnisse des kaiserlichen Hofhalts waren, wie fast überall, als spezifische Naturalabgaben auf die einzelnen Gebiete verteilt147, und dies System ist in Resten bis in die Gegenwart erhalten geblieben. Das Naturalabgabensystem stand mit der Schaffung des patrimonialen Heeres und Beamtentums im engsten Zusammenhang. Denn beide wurden hier wie sonst aus den fürstlichen Magazinen verpflegt und es entwickelten sich feste Naturalpräbenden. Dennoch war zuweilen auch die Geldwirtschaft des Staats daneben, zum mindesten unter der Han-Dy nastie, um den Beginn unserer Zeitrechnung, schon weit vorgeschritten, wie die Urkunden zeigen148. Und dies Nebeneinander von gelegentlichen Fronden (für Bauzwecke vor allem, daneben für Kurierdienste und Verkehr), Natural- und Geldabgaben und Gebühren, mit fürstlicher Oikenwirtschaft für gewisse Luxusbedürfnisse149 des Hofes, hat unter, im allgemeinen, zunehmender Verschiebung nach der Seite der Geldwirtschaft bis in die Gegenwart fortbestanden.
Diese Verschiebung nach der Seite der Geldsteuern hat sich auch und vor allem auf die bis in die allerletzte Zeit weitaus wichtigste Steuer: die Grundsteuer, erstreckt, deren interessante Geschichte hier im einzelnen zu verfolgen nicht die Absicht ist150. Wir kommen darauf weiter unten, soweit nötig, bei Erörterung der Agrarverfassung etwas näher zu sprechen. An dieser Stelle genügt es zu sagen, daß auch hier, wie in den Patrimonialstaaten des Okzidents, das gelegentlich stärker differenzierte Steuersystem, weil das nicht in Grund und Boden angelegte Vermögen für die Steuertechnik der extensiven kaiserlichen Verwaltung nicht »sichtbar« blieb, zunehmend in der Richtung der Unifizierung der Steuern durch Verwandlung aller anderen Abgaben in Zuschläge zur Grundsteuer sich entwickelte. Diese Tendenz zur Verflüchtigung alles nicht sichtbaren Besitzes ist vielleicht für die stets erneuten Versuche, den Staatsbedarf tunlichst naturalwirtschaftlich: durch Fronden und Leiturgien, zu decken, mitbestimmend gewesen. Daneben und in Wahrheit wohl in erster Linie auch: die Währungsverhältnisse. Für die Grundsteuer selbst aber galten zwei ebenfalls in extensiv verwalteten Patrimonialstaaten universelle Entwicklungstendenzen: Einmal die zur Umwandlung in Geldabgaben, von welcher auch alle anderen Lasten, insbesondere die Fronden und sonstigen Leiturgien, ergriffen wurden. Ferner aber die Tendenz zur Umwandlung in eine Repartitionssteuer und schließlich in einen fest kontingentierten Tribut, der auf die Provinzen nach festem Maßstabe verteilt wurde. Der ungemein wichtige Vorgang wurde schon einmal kurz berührt. Die Befriedung des Reichs unter der Mandschu-Dynastie gestattete dem Hof den Verzicht auf bewegliche Einkünfte und führte zu dem berühmten, als Quelle der neuen Blüte Chinas im 18. Jahrhundert gepriesenen Edikt von 1713, welches die Grundsteuerpflichtigkeiten der Provinzen – der Absicht nach – in feste Abgaben verwandelte. Wir werden davon gleich zu reden haben. Neben der Grundsteuer spielten namentlich die Salzgabelle, die Bergwerke und erst in letzter Linie die Zölle eine Rolle in den Einkünften der Zentralverwaltung. Auch für sie wurde aber der nach Peking abzuführende Betrag tatsächlich ein traditionell feststehender. Erst die Kriege mit europäischen Mächten und die finanzielle Notlage im Gefolge der Taiping-Revolution (1850-64) ließen die »Likin« -Zölle unter der glänzenden Finanzverwaltung Sir Robert Harts in den Vordergrund der Finanzen des Reichs treten.
Die Befriedung des Reichs im Zusammenhang mit dieser Steuerkontingentierung und ihren Folgen: der Entbehrlichkeit und dem Wegfall der Fronausnutzung, des Paßzwangs und aller Freizügigkeitsschranken, aller Kontrolle über Berufswahl, Hausbesitzverhältnisse und Produktionsrichtung, hat eine gewaltige Vermehrung der Bevölkerung im Gefolge gehabt. Während es scheint, daß die nach den freilich zum Teil äußerst problematischen Katasterziffern sehr stark schwankende Volksdichte Chinas zu Beginn der Mandschu-Herrschaft nicht wesentlich höher war als unter Schi-Hoang-Ti fast 1900 Jahre zuvor, jedenfalls aber die angebliche Volkszahl jahrhundertelang zwischen 50 und 60 Millionen schwankte, wuchs sie von Mitte des 17. bis Ende des 19. Jahrhunderts von 60 auf etwa 350-400 Millionen151, entfaltete sich der sprichwörtliche chinesische Erwerbstrieb im kleinsten wie im größten und wurden auch sehr bedeutende Einzelvermögen akkumuliert. Was nun aber als etwas höchst Auffallendes an dieser Epoche erscheinen muß, ist: daß trotz dieser erstaunlichen Entwicklung der Volkszahl und ihres materiellen Befindens nicht nur die geistige Eigenart Chinas in eben dieser Zeit gänzlich stabil blieb, sondern auch auf ökonomischem Gebiet, trotz jener scheinbar so überaus günstigen Bedingungen, nicht der geringste Ansatz zu einer modern-kapitalistischen Entwicklung sich findet. Daß ferner auch der einst bedeutende Eigenhandel Chinas nach außen keinerlei Neubelebung erfuhr, sondern nur Passivhandel in einem einzigen, den Europäern unter strenger Kontrolle geöffneten Hafen (Kanton) stattfand. Daß auch von einem von innen, aus eigenem kapitalistischen Interesse der Bevölkerung heraus, entstandenen Streben, diese Schranke zu sprengen, nicht das mindeste (sondern ausschließlich: das Gegenteil) bekannt ist. Und daß überhaupt auf dem Gebiet der Technik, Wirtschaft und Verwaltung auch nicht die geringste, im europäischen Sinn, »fortschrittliche« Entwicklung einsetzte, vollends aber die Steuerkraft des Reichs, wenigstens dem Anschein nach, keinem ernsten Stoß gewachsen war, als die Erfordernisse der Außenpolitik dies gebieterisch erheischt hätten. Wie ist dies alles angesichts jener bei aller Kritik doch nicht zu bezweifelnden ganz ungewöhnlich mächtigen Volkszunahme zu erklären? Das ist unser Zentralproblem.
Es hatte sowohl ökonomische wie geistige Ursachen. Die ersteren, von denen jetzt zunächst zu sprechen ist, waren durchaus staatswirtschaftlicher und also politisch bedingter Natur, teilten aber mit den »geistigen« den Umstand: daß sie aus der Eigenart der führenden Schicht Chinas: des Beamten- und Amtsanwärterstandes (der »Mandarinen«), hervorgingen. Von ihnen ist jetzt zu reden, und zwar zunächst von ihrer materiellen Lage.
Der chinesische Beamte war, sahen wir, zunächst auf Naturalpräbenden aus den königlichen Magazinen angewiesen. Später traten in zunehmendem Maß Geldgehalte an die Stelle. So blieb es. Formell also zahlte die Regierung ihren Beamten Gehalt. Aber einmal zahlte sie nur einem kleinen Bruchteil der wirklich in der Verwaltung tätigen Kräfte aus ihren eigenen Mitteln Gehalt, und dann bildete dies Gehalt nur einen kleinen, oft geradezu einen verschwindenden Teil ihres Einkommens. Der Beamte hätte davon gar nicht leben und noch weniger die ihm amtlich obliegenden Kosten der Verwaltung daraus bestreiten können. Das Verhältnis war vielmehr in Wahrheit stets dies: daß der Beamte, ebenso wie ein Feudalherr oder Satrap, der Zentralregierung (und der Unterbeamte der Provinzialregierung) für die Ablieferung bestimmter Abgabenbeträge haftete, seinerseits aber fast alle Kosten seiner Verwaltung aus den von ihm wirklich erhobenen Abgaben: Steuern und Gebühren, bestritt und den Ueberschuß für sich behielt. So wenig dies, in voller Konsequenz wenigstens, offiziell anerkanntes Recht war, so zweifellos galt es tatsächlich, und zwar definitiv infolge der seit der Kontingentierung der Regierungseinnahmen bestehenden Verhältnisse.
Die sogenannte Fixierung der Grundsteuer im Jahre 1713 war der Sache nach eine finanzpolitische Kapitulation der Krone vor den Amtspfründnern. Denn in Wahrheit wurde ja nicht etwa die Steuerpflichtigkeit der Grundstücke in eine feste Grundrente verwandelt (wie z.B. in England), sondern es wurde vielmehr dasjenige, was den Provinzialbeamten von der Zentralverwaltung als Steueraufkommen ihres Bezirks angerechnet wurde: der Betrag also, von welchem sie einen Pauschalquotienten als Tribut an die Krone abzugeben hatten, fixiert und so – auf den Effekt gesehen – nur die Höhe der Besteuerung der Pfründen dieser Satrapen durch die Zentralverwaltung für alle Zeiten festgelegt152. Dem genuinen Charakter aller spezifisch patrimonialen Verwaltung entsprechend wurde das Einkommen, welches der Beamte aus der Verwaltung seines Bezirks zog, als seine Pfründe behandelt, die von seinen Privateinkünften nicht wirklich geschieden war153. Die Inhaber der Amtspfründen ihrerseits dagegen waren soweit wie möglich davon entfernt, die Grundsteuer (oder irgendwelche andere Pflichtigkeit) der Steuerzahler als in ihrem Gesamtaufkommen pauschaliert zu behandeln. Und es konnte auch praktisch gar keine Rede davon sein, daß die Reichsregierung eine solche Festlegung hätte ernstlich beabsichtigen können. Der Amtsinhaber mußte ja, wiederum dem patrimonialen Prinzip entsprechend, von den ihm zur Verfügung stehenden Einnahmen nicht nur alle sachlichen Bedürfnisse der bürgerlichen Verwaltung und Rechtspflege seines Bezirks bestreiten, sondern, und zwar vor allem, auch seinen unoffiziellen – von Kennern selbst für die kleinste Verwaltungseinheit (hsien) auf zwischen 30 und 300 schwankend geschätzten, gar nicht selten aus dem Abhub der Bevölkerung rekrutierten – Beamtenstab, ohne den er, wie wir sahen, in der ihm fremden Provinz die Verwaltung zu führen gar nicht in der Lage war. Seine persönlichen waren von den Verwaltungsausgaben nicht geschieden. Die Zentralverwaltung hatte also keinerlei Uebersicht über die wirklichen Bruttoeinkünfte der einzelnen Provinzen und Bezirke, der Provinzialstatthalter keine über diejenigen der Präfekten usw. Auf seiten der Steuerzahlenden andererseits stand nur der eine Grundsatz fest: sich nach Möglichkeit der Erhebung nicht traditionell feststehender Abgaben zu widersetzen, und wir werden sehen, daß und warum sie dies innerhalb weiter Grenzen mit großem Erfolg zu tun in der Lage waren. Indessen abgesehen von der prekären Natur dieses wesentlich von der Machtlage abhängigen Widerstands gegen die trotz allem stets erneut versuchten Uebererhebungen hatten die Beamten zwei Mittel, die Einkünfte zu steigern. Einmal die Erhebung eines Zuschlags für die Erhebungskosten (mindestens 10%) und für jegliche Nichtinnehaltung des Termins, mochte diese vom Schuldner freiwillig oder unfreiwillig oder (und oft genug) geradezu absichtlich durch die Beamten herbeigeführt sein. Dann aber und namentlich: die Umwechslung der Naturalsteuer in Geld, der Geldsteuer zuerst in Silber, dann wieder in Kupfer und nochmals in Silber, zu wechselnden Kursen, deren Bestimmung der Steuereinnehmer sich vorbehielt154. Vor allen Dingen aber ist zu bedenken, daß jegliche Amtshandlung eines Beamten, nach patrimonialen Grundsätzen, durch »Geschenke« zu entgelten war und gesetzliche Gebührentarife nicht existierten. Mit Einschluß dieser Extraverdienste war die Gesamtbruttoeinnahme des Beamten dazu da, zunächst die sachlichen Unkosten seines Amtes und die diesem obliegenden Verwaltungsaufgaben vorab zu bestreiten. Der Bruchteil, den diese eigentlichen »Staats«-Ausgaben der inneren Verwaltung ausmachten, war aber meist überaus gering. Demnächst und namentlich aber war dies Bruttoeinkommen des auf der untersten Staffel, unmittelbar an der Steuerquelle selbst, stehenden Beamten nun der Fonds, aus welchem die über ihm stehenden Beamten ihre Einnahmen schöpften. Er hatte an seinen Vorgesetzten abzuführen nicht nur den vergleichsweise recht oft nicht großen Betrag, den nach dem überkommenen Kataster beizubringen ihm oblag. Sondern außerdem und vor allem hatte er ihm beim Amtsantritt und sodann in regelmäßigen Fristen »Geschenke« zu machen, so hoch wie nur irgend möglich, um dessen für sein eigenes Schicksal maßgebendes Wohlwollen zu erhalten155. Und er hatte dabei dessen unoffizielle Berater und Subalternbeamte, soweit sie von Einfluß auf sein Schicksal sein konnten (bis zum Türhüter herab, wenn er eine Audienz wünschte) mit reichlichen Trinkgeldern zu versehen. Dies setzte sich von Staffel zu Staffel bis zu dem Palasteunuchen fort, der auch von den allerhöchsten Beamten seinen Tribut nahm. Das Verhältnis zwischen offiziell bekanntgegebenem und tatsächlichem Steueraufkommen aus der Grundsteuer allein wird von guten Kennern156 wie 1: 4 geschätzt. Das Kompromiß von 1712/13 zwischen der Zentralregierung und den Provinzial-beamten entsprach in geldwirtschaftlicher Form etwa der naturalwirtschaftlichen Fixierung der Feudalpflichten im Okzident. Mit dem Unterschiede zunächst: daß es sich in China, wie in allen spezifischen Patrimonialstaaten, nicht um Lehen, sondern um Pfründen handelte, und nicht um Militärdienstleistungen sich selbst ausrüstender Ritter, auf deren Heeresdienst der Fürst angewiesen war, sondern um Natural- und, vor allem, Geldtribute der für Patrimonialstaaten typischen Gebühren- und Steu erpfründner, auf deren Verwaltungsleistungen die Zentralgewalt angewiesen war. Und noch ein weiterer wichtiger Unterschied gegenüber dem Okzident lag vor. Dort kannte man die Pfründe, auch die Gebühren- und Steuerpfründe ja auch. Am frühesten auf kirchlichem, später, nach dem kirchlichen Muster, auf dem Gebiet der Patrimonialstaaten. Aber sie war dann entweder lebenslänglich (außer bei Entsetzung auf Grund eines förmlichen Verfahrens) oder auch erblich appropriiert, wie das Lehen auch, oft sogar durch Kauf übertragbar. Und die Gebühren, Zölle, Steuern, auf denen sie ruhte, waren durch Privileg oder feste Gewohnheit fixiert. In China war, sahen wir, gerade der »etatsmäßige« Beamte frei absetzbar und versetzbar, ja: mußte er in kurzen Fristen versetzt werden. Teils (und vor allem) im Interesse der Erhaltung der politischen Macht der Zentralverwaltung; daneben aber auch – wie gelegentlich hervortritt: – damit auch andere Anwärter die Chance hätten, einmal an die Reihe zu kommen157. Das Beamtentum als Ganzes war im Genuß des gewaltigen Pfründeneinkommens gesichert, der einzelne Beamte dagegen gänzlich prekär gestellt und daher, da der Erwerb des Amts (Studien, Kauf, Geschenke und »Gebühren«) ihm gewaltige Kosten gemacht und ihn oft in Schulden gestürzt hatte, genötigt, in der kurzen Amtszeit soviel als möglich aus dem Amt herauszuwirtschaften. Er war infolge des Fehlens fester Taxen und Garantien dazu auch in der Lage. Daß das Amt dazu da sei, ein Vermögen zu erwerben, verstand sich durchaus von selbst, und nur das Uebermaß galt als tadelnswert158.
Aber noch andere und weiter reichende Wirkungen gingen auf diesen Zustand zurück. Zunächst: die Machtstellung der Zentralverwaltung gegenüber den Personen der Beamten wurde allerdings durch das System der Versetzungen auf das wirksamste gesichert. Jeder Beamte war infolge dieser fortwährenden Umschichtungen und des steten Wechsels seiner Chancen der Konkurrent jedes anderen um die Pfründe. Ihre Lage war infolge dieser Unmöglichkeit, ihre persönlichen Interessen zu vereinigen, gänzlich prekär nach oben: die ganze autoritäre innere Gebundenheit dieses Beamtentums hing damit zusammen. Zwar gab es unter den Beamten »Parteien«. Zunächst nach Landsmannschaften und, damit zusammenhängend, nach der überkommenen Eigenart der Schulen, die sie erzogen hatten. Der »konservativen« Schule der nördlichen Provinzen stand in den letzten Jahrzehnten die »fortschrittliche« der mittleren Provinzen und die »radikale« der Kantonesen gegenüber; von dem Gegensatz der Anhänger der Erziehung nach der Methode der Sung gegen die der Han innerhalb eines und desselben Yamen sprachen kaiserliche Edikte noch in dieser Zeit. Indessen infolge des Grundsatzes der Fremdbürtigkeit der Beamten und der steten Versetzung von Provinz zu Provinz und weil überdies die Anstellungsbehörde sorgsam auch darauf hielt, die rivalisierenden Schulen und Landsmannschaften in einem und demselben Amtsbezirk und derselben Aemterstaffelung möglichst zu mischen, konnte sich wenigstens auf dieser Basis kein landsmannschaftlicher Partikularismus entwickeln, der die Einheit des Reichs gefährdet hätte: – dieser hatte ganz andere Grundlagen, wie gleich zu erwähnen ist. Auf der anderen Seite war aber die Schwäche der Beamten nach oben mit ihrer schon erörterten ebenso großen Schwäche nach unten erkauft. Und eine noch weit wichtigere Folge der Struktur dieses Pfründentums war der extreme administrative und wirtschaftspolitische Traditionalismus, den sie mit sich führte. Soweit dieser gesinnungs mäßig begründet war, ist später von ihm zu sprechen. Aber er hatte daneben auch höchst »rationale« Gründe.