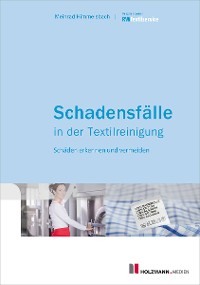Kitabı oku: «Schadensfälle in der Textilreinigung», sayfa 2
3. Ballonkleid: Flecken nach der Reinigung
Ich seh etwas, was du nicht siehst
Juristen und Versicherungsvertreter laden Textilreinigern immer mehr Pflichten auf, damit diese im Streitfall auf der sicheren Seite sind. Diese Pflichten sind kaum realisierbar und bieten zudem eben diese Sicherheit nicht. Manchmal entstehen gerade durch eine sorgfältige Warenschau zusätzliche Risiken, wie der folgende Schadensfall aufzeigt. Eine satirische Bewertung.
Eine gute Risikoaufklärung bei der Abgabe von Textilien zur Pflegebehandlung wird Textilreinigern von juristischer und Versicherungsseite immer wieder empfohlen. Aktuelle Anlässe sind in diesen Fällen oftmals Gerichtsurteile, die dem Reiniger neue (oder bereits bekannte) Aufklärungspflichten auferlegen. Auf bekannte Risiken sollte möglichst umfangreich hingewiesen werden. Diese Beratungsgespräche sollten nicht durch ein Formblatt, sondern durch ein handschriftlich erstelltes Dokument festgehalten und vom Kunden unterzeichnet werden. Natürlich muss der Name des Kunden lesbar sein, die Auftragsnummer notiert und alles mit Datum versehen werden. Sollte man eine Warenart grundsätzlich nur auf Kundenrisiko bearbeiten, so könnte das je nach Lesart des Gerichts bereits eine Benachteiligung des Kunden darstellen. Vorschädigungen sollten am besten von zwei Mitarbeitern gesehen und schriftlich festgehalten sowie durch Unterschrift bestätigt werden. So viel zur Theorie.
Wie sieht es in der Praxis damit aus? Sicherlich gibt es Betriebe, die diese Vorgehensweise umzusetzen versuchen. Aber Stammkunden meint man so zu kennen, dass die Aufklärung nicht jedes Mal neu durchgeführt werden muss. Und wenn viel los ist, nimmt man die Sachen auch mal ohne Durchsicht entgegen. Fünf Anzüge und 20 Hemden eines Kunden durchzumustern würde die Geduld der nächsten Kunden überstrapazieren. Auch wenn eine Kundin kurz nach Ladenschluss erscheint, ist die Gründlichkeit des Beratungsgespräches meist nicht mehr gewährleistet. Dass trotz gründlicher Warenschau und dokumentierter Vorschädigung Probleme entstehen können, zeigt der folgende Schadensfall.
Schadensbild
Eine Kundin brachte ein Ballonkleid zur Reinigung. Die gut geschulte Verkäuferin schaute sich das Kleid genau an und stellte mehrere kleine Defekte im Stoff fest, den sie im Schadensbuch vermerkte. Das Durchsehen des Kleids, das Gespräch mit der Kundin über die Vorschädigung und das Dokumentieren der Vorschädigung nahmen dabei natürlich einen gewissen Zeitraum ein. Das Kleid wurde daraufhin normal gereinigt und gebügelt. Bei der Abholung sah die Kundin sich das Kleid nochmals genau an und stellte sofort Flecken fest, die bei der Abgabe des Textils nicht vorhanden waren. Im Annahmeprotokoll steht tatsächlich nichts von einer Verfleckung.

Nach der Reinigungsbehandlung kann man die Eiweißflecken deutlich erkennen.
Da man gemeinsam das Kleid durchgesehen hatte, muss die Ladnerin zugeben, dass vor der Behandlung keine Flecken „vorhanden“ waren. Die Kundin verlangt Ersatz für das Kleid und die Kosten für die Reinigung zurück. Obwohl eine ziemlich optimale Beratung stattgefunden hat, sieht sich die Textilreinigung mit einer aus ihrer Sicht ungerechtfertigten Forderung konfrontiert. Die Forderung der Kundin befeuert sich sogar aus der umfangreichen Warenschau am Ladentisch.
Schadensursache
Der Kundin zu erklären, dass eiweißhaltige Verfleckungen in erster Linie durch die Wärmebehandlung beim Trocknen und Bügeln sichtbar werden können, war zunächst erfolglos. Aufgrund der erdrückenden Argumentationslage sucht die Reinigung Unterstützung durch ein Sachverständigengutachten.
Tatsächlich handelt es sich um eine eiweißhaltige Gebrauchsverschmutzung, deren Verursachung nicht in den Verantwortungsbereich der Textilreinigung fällt. Durch den Einfluss von Wärme, die beim Trocknungsprozess unvermeidbar ist, wurde die Gebrauchsverschmutzung sichtbar, jedoch nicht verursacht.
Ironische Schadensvermeidung
Die zentrale Frage für den Textilreiniger lautet: Wie kann man solche Reklamationen erfolgreich verhindern? Die Anwort: Durch eine umfangreiche und optimale Aufklärung. Diese sollte möglichst handschriftlich von einem Mitarbeiter erfasst werden und folgende Punkte – mit viel Augenzwinkern – enthalten:
„Sehr geehrte Kundin, Sie überlegen, uns Ihr Kleid zur Reinigungsbehandlung zu übergeben. Nach einer gründlichen Durchsicht haben wir unten aufgeführte Risiken festgestellt. Sollten Sie diese Risiken nicht eingehen wollen, bitten wir Sie, von der Absicht Abstand zu nehmen, das Kleid bei uns reinigen zu lassen.
• Risiken:
Nähte des Oberstoffes können aufgehen, Knöpfe können abgehen. Schweißflecken könnten sichtbar werden. Es könnte sein, dass die vorhandenen Flecken nicht zu entfernen sind. Es ist möglich, dass nicht sichtbare Flecken sichtbar werden. Es könnte sein, dass der Stoff an den vorhandenen oder den unsichtbaren Flecken durch die Flecksubstanz bereits geschädigt ist und dadurch bricht. Die Farbe könnte durch Herstellermängel oder durch Lichteinflüsse auch beispielsweise bereits im Ladengeschäft oder im Lager eines Versandhändlers geschädigt sein. Das Pflegekennzeichen könnte sich ablösen oder unleserlich werden. Der Reißverschluss könnte Schaden nehmen. Das Kleid könnte auch durchs Bügeln verändert werden. Obwohl wir uns an die Temperaturempfehlung des Herstellers halten, können durch den Bügelprozess Schädigungen in der Farbgebung wie auch in der Stoffstruktur zutage treten. Zudem könnte das Kleid, ohne dass eine Fehlbehandlung vorliegt, eingehen. Auch könnte sich zwischen der letzten Benutzung des Kleids vor der Reinigung und der Benutzung nach der Reinigung Ihre Figur weiterentwickelt haben, was dazu führt, dass das Kleid nicht mehr (optimal) sitzt. Falls Sie das Kleid nicht innerhalb einer Woche nach Fertigstellung abholen, könnte es an den Schultern Abdrücke vom Kleiderbügel bekommen. Auch könnte der optische Aufheller unter der Plastikfolie reagieren und zu einer gelblichen Farbtonverschiebung führen. Achtung Allergiker: Es könnten sich trotz größter Sorgfalt feinste Spuren von Wasch-, Reinigungs- und Detachiermittel nach der Bearbeitung im Kleid befinden.
Bei der von uns zur Verfügung gestellten Tragetasche könnten, wenn weitere Gegenstände dazugepackt werden, die Henkel reißen, und das Kleid kann durch Herunterfallen neu verschmutzen. Achtung: Das Kleid ist nicht auf dem Fahrrad zu transportieren, da es in die Fahrradspeichen gelangen und zu einem Sturz führen kann.
Bitte beachten Sie unsere Glaseingangstüren. Es besteht die Gefahr, dass Sie dagegenlaufen oder sich an der Tür anlehnen, obwohl sie bereits offen ist. Beachten Sie auch, das Wechselgeld nicht in den Mund zu nehmen. Es könnten dadurch Keime übertragen werden.
• Bestätigung der Kundin: Ich übernehme diese (mir auch vorgelesenen) Risiken.
Ort, Datum, Unterschrift.
P. S. Wie Sie wissen, ist Textilreinigung ein Glücksspiel und für Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren nicht erlaubt. Eltern haften für ihre Kinder. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinner werden benachrichtigt.“
Der Sachverständige empfiehlt
Eine gute Beratung ist grundsätzlich sehr nützlich. Sie schützt jedoch nicht in allen Fällen vor unberechtigten Forderungen.
Für das Massengeschäft kann es besser sein, am Ladentisch keine Beratung anzubieten und eventuelle Problemfälle erst bei der Warenschau auszusortieren. So spart man wertvolle Zeit im Laden und kann mancher unberechtigten Reklamation besser begegnen.
4. Brautkleid (I):
Vordetachur mit optischem Aufheller
Den Schmutz schön aufgehellt
Nach dem „schönsten Tag“ kommt ein Brautkleid aus Polyester und Viskose zum Textilreiniger. Zunächst scheint es, als ob alle Flecken beseitigt werden konnten. Doch dann reklamiert die Kundin helle Stellen am unteren Saum. Den Grund findet der Sachverständige in der Waschmittelchemie.
Ein wunderbares, cognacfarbenes Brautkleid mit Corsage und „Pulswärmern“ wurde für den „schönsten Tag im Leben“ eigens in den USA gekauft und durch eine Schneiderin für die Braut nach Maß angepasst. Der Tag der Hochzeit war traumhaft, es wurde ausgelassen gefeiert. Am Ende des Tages hatte das Kleid, wie es landauf, landab üblich ist, diverse Verschmutzungen und vor allem am unteren Saum, mit dem das Kleid den Boden berührte, „einschlägige“ Flecken.
Viele verheiratete Frauen haben bekanntermaßen die Angewohnheit, gelegentlich ihr Brautkleid hervorzuholen und (soweit noch möglich) anzuziehen, um sich an ihren Hochzeitstag zu erinnern. So soll das umgerechnet rund 2.500 Euro teure Kleid in die Reinigung gegeben werden, um die Tragespuren zu beseitigen.
In der Reinigung gibt man sich große Mühe mit der Beseitigung des Schmutzes am unteren Saum. Das Kleid, augenscheinlich aus 100 Prozent Polyester, wird einer ausgiebigen Vordetachur unterzogen. Dazu wird eine Waschmittellösung aus Vollwaschmittel hergestellt und der Saum sowohl von innen als auch von außen kräftig eingebürstet. Anschließend wird das Kleid schonend nassgereinigt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Sämtliche Flecken konnten beseitigt werden. Der Textilreiniger ist mit sich und seiner Arbeit mal wieder richtig zufrieden. Bei der Abholung des Kleides zeigt sich die Kundin ebenfalls zufrieden. So muss es sein!
Eine Woche später kommt die Kundin jedoch zurück und reklamiert helle Stellen im gesamten Bereich des unteren Saumes, die bei näherer Betrachtung tatsächlich gut sichtbar sind. Zur Klärung der Schadensursache kommt das Kleid zum Gutachter.
Das Kleid besteht aus 55 Prozent Polyester und 45 Prozent Rayon. Bei dem Fasermaterial Rayon handelt es sich um die englische Übersetzung des deutschen Wortes Viskose. Viskose wird aus Cellulose hergestellt und lässt sich der Gruppe der Celluloseregeneratfasern zuordnen.

Das Brautkleid mit der bereits sichtbaren Farbveränderung am unteren Rand des Rockes.
Waschmittelchemie ist ein großes Fachgebiet, in dem es ständig Neuerungen gibt. Neben den bewährten Waschmitteln gibt es heute für jeden Einsatz verschiedenste Kombinationen klassischer Inhaltsstoffe mit neu entwickelten Komponenten.
Vereinfacht kann man konfektionierte Waschmittel zunächst in drei Gruppen einteilen: Feinwaschmittel, Buntwaschmittel, Vollwaschmittel. Bei den Feinwaschmitteln handelt es sich um pH-neutrale Waschmittel ohne Bleichmittel und ohne optischen Aufheller. Bei den Buntwaschmitteln um alkalische Waschmittel, die in erster Linie durch die Alkalität eine höhere Waschwirkung erzielen. Sie enthalten ebenfalls keine Bleichmittel und optischen Aufheller. Vollwaschmittel sind alkalisch eingestellt und enthalten neben Bleichmitteln auch optische Aufheller.
Optische Aufheller sind mit Farbstoffen vergleichbar, die besonders gut auf Cellulosefasern aufziehen können. Diese „Farbstoffe“ wandeln unsichtbares UV-Licht in sichtbares Licht um. Dadurch wird die mit Vollwaschmitteln gewaschene Wäsche wie beispielsweise Hemden, Unterwäsche, Frottierware und Tischwäsche besonders strahlend weiß.
Auf Polyesterfasern können die meisten optischen Aufheller im Rahmen einer Waschbehandlung jedoch nicht oder nur minimal aufziehen. Polyesterfasern lassen sich ja auch nur mit speziellen Färbeverfahren anfärben. Mit diesem Hintergrundwissen ergibt sich die Lösung des „Brautkleidfalles“ fast von alleine.
Schadensursache
Der Textilreiniger hatte in der Vergangenheit bereits viele Brautkleider mit der von ihm vorbereiteten Waschlösung angebürstet. Da es sich um Stoffe aus reinem Polyester handelte, war dies bislang selbst bei pastellfarbigen Kleidern problemlos. Erst als ein aus Polyester und Cellulosefasern gefertigtes Kleid damit bearbeitet wurde, sind Aufhellungen eingetreten. An den behandelten Stellen sind die Aufheller auf den Viskosefaseranteil aufgezogen und führen zu der reklamierten Schädigung. Eine Überprüfung dieser Hypothese mit der Quarzanalyselampe bestätigt dies eindrucksvoll, wie das folgende Bild zeigt.

Mit der Quarzanalyselampe lässt sich der optische Aufheller gut sehen.
Schadensregulierung
Da die Gebrauchsflecken auch mit einer Lösung aus Buntwaschmittel zu entfernen gewesen wären, liegt die Verantwortung für die Farbveränderung beim Textilreiniger. In diesem Falle beträgt der Zeitwert entsprechend der von den deutschen Sachverständigen beschlossenen und vom DTV (Deutscher Textilreinigungs-Verband; www.dtv-bonn.de) herausgegebenen Zeitwerttabelle max. 50 Prozent vom Anschaffungspreis, also 1.250 Euro.
Der Sachverständige empfiehlt
Auch weil Brautkleider in der Anschaffung eine besondere Investition darstellen, erfordert ihre Reinigung höchste Aufmerksamkeit. Die Beschäftigung mit den jeweils verwendeten Materialien und dem geeigneten Pflegeverfahren stellt eine fachliche Herausforderung dar. Ein schönes Gebiet, um Fachwissen und handwerkliches Können zu kombinieren und auszuspielen.
5. Brautkleid (II):
Struktur- und Maßänderungen von Seide
Traum in Tüll und Tuft
Die Traumhochzeit in Weiß – welche Braut wünscht sich das nicht? Und für den „schönsten Tag des Lebens“ wird der Geldbeutel weit aufgemacht. Friseur, Gastronomie, Blumenhandel, Fotograf oder Oldtimervermieter – jeder möchte ein Stück von der „Hochzeitstorte“. Auch die Reinigungen freuen sich über das ein oder andere Brautkleid, das zur Bearbeitung hereingegeben wird.
Der Fototermin im Park, das Tanzen und manch gelungenes Hochzeitsspielchen hinterlassen dann doch am Brautkleid eindrückliche Spuren. Von der Reinigung erhofft man sich deren Beseitigung – gerade, wenn das Fest so teuer geworden ist, dass man das Kleid noch weiterverkaufen muss, um den finanziellen Engpass zu verringern. Falls es der Reinigung gelingt, die Gebrauchsspuren zu beseitigen und man tatsächlich eine Käuferin findet, sind immerhin erfahrungsgemäß noch zwischen 30 und 50 Prozent des Neupreises zu erzielen. Aber wehe, es gelingt nicht!
In dem vorliegenden Fall ging die Reinigungskundin vor Gericht, da die Textilreinigung ihrer Forderung nach 1.080 Euro Schadensersatz nicht nachgekommen ist. Begründet wurde die Forderung damit, dass die Struktur des Kleides verändert sei, es lappig und knittrig erscheine und deshalb nicht mehr verwendbar sei. Sie fordere nicht den Neupreis von 1.200 Euro, sondern nach Abzug der Wertminderung durch einmaligen Gebrauch „nur“ 90 Prozent des Kaufpreises.
Die Reinigung erklärte, dass das Kleid entsprechend der Herstellerempfehlung, nämlich „F“, bearbeitet worden sei. Da die Verschmutzungen jedoch nicht (vollständig) entfernt werden konnten, war der Kundin eine Nassbehandlung auf ihr Risiko angeboten worden. Trotz des erläuterten Risikos hatte sich die Brautmutter für diese Nassbehandlung entschieden und eine entsprechende Risikoübernahme unterschrieben.
Schadensbild
Durch die fachlich korrekte Nassbehandlung hatte sich die Oberflächenstruktur des Kleides erheblich verändert. Das Gericht trat mit folgender Frage an den Gutachter heran: „Wurde die Nassreinigung fachlich korrekt durchgeführt?“ Diese Frage konnte bejaht werden, die Klage der Kundin wurde abgewiesen.

Durch eine Nassbehandlung hat sich die Oberflächenstruktur des Brautkleides aus Doupionseide erheblich verändert.
Was wäre bei einer anderen Fragestellung des Gerichtes an den Gutachter herausgekommen? Beispielsweise hätte man auch fragen können, ob es aus fachlicher Sicht richtig ist, bei einem Kleid aus Seidentuft eine Nassbehandlung als Möglichkeit der besseren Fleckenentfernung durchzuführen.
Schadensursache
Bei dem für das Kleid verwendeten Stoff handelt es sich um Doupionseide. Das Seidengewebe enthält in der Kette Filamentgarne. Der Schuss jedoch besteht aus Schappegarnen aus Maulbeerspinnerseide. Diese Garne werden aus „Seidenabfällen“, wie beispielsweise nicht abhaspelbaren Kokonteilen, im Kammgarnverfahren gewonnen. Der Faden weist Unregelmäßigkeiten auf, die dem Gewebe den typischen, etwas unruhig strukturierten Charakter verleihen. Eine ähnliche Struktur, wie sie auch für Wildseide typisch ist. Im Unterschied zu Geweben aus Wildseide (Tussahseide) weist die Doupionseide jedoch einen edlen Glanz auf.
Für die meisten Seidengewebe, die für Brautkleider Verwendung finden, wird keine Wildseide (Tussahseide), sondern Maulbeerspinnerseide verarbeitet.
Feuchtigkeitseinwirkung in Verbindung mit mechanischer Beanspruchung führt bei diesen Geweben allermeist zu einer Struktur- und Maßänderung. Die Nassbehandlung eines Kleides aus Doupionseide ist deshalb keinesfalls zu empfehlen, da eine gravierende Strukturveränderung eintritt und somit kein eventuelles Risiko, sondern eine Gewissheit darstellt.
Alternative Vorgehensweise
Aus fachlicher Sicht bietet sich eine andere Vorgehensweise an. Nach der Reinigung noch vorhandene Flecken können mittels Nachdetachur vorsichtig, auch großflächig, entfernt werden. Vielfach genügt ein konfektioniertes, leicht alkalisches Detachiermittel („Blutlöser“), die Bearbeitung mit einer weichen Bürste und Dampf aus der Detachierpistole, um den Flecken zu Leibe zu rücken.

Feuchtigkeitseinwirkung in Verbindung mit mechanischer Beanspruchung führt bei Doupionseide zu Struktur- und Maßänderungen.
Das Antrocknen der durchfeuchteten Detachierstellen mit Druckluft verhindert eine stärkere Randbildung. Nach einem vollständigen Durchtrocknen der Seide über Nacht muss das Kleid nochmals angebürstet werden, um die verbliebene, schwache Randbildung durch den darauffolgenden Reinigungsprozess vollständig zu beseitigen. Eventuell muss dieser Vorgang mehrmals wiederholt werden. Ein geübter Detacheur wird sich diese Vorgehensweise jedoch sehr schnell aneignen können und damit fantastische Erfolge erzielen. Selbstverständlich kann diese Vorgehensweise auch bei bunten Seidentuftstoffen angewendet werden.
Mehrarbeit honorieren lassen
Warum soll man sich diese Mehrarbeit nicht auch honorieren lassen? Warum nicht für die Bearbeitung eine Seidentuftkleides beispielsweise 200 Euro verlangen, wenn es fleckfrei, gut gebügelt und vor allem unbeschädigt zurückgegeben werden kann? Dann können Kundin und Reinigung zufrieden sein. Auch die überlasteten Gerichte freuen sich über jeden Fall, der nicht bei ihnen landet. Also alle zufrieden? Sagen wir „fast alle“. Denn die Sachverständigen warten dann vergeblich auf den Postboten.
Der Sachverständige empfiehlt
Seidentuftstoffe aus Doupionseide sollten keinesfalls nassgereinigt werden, egal mit welchem System. Es empfiehlt sich, auch bei größeren Verschmutzungen, eine Fleckbehandlung durch Nachdetachur durchzuführen.
INFORMATION | STATISTIK
Jede zehnte Braut in Weiß
380.000 Hochzeiten gab es im Jahr 2011 in Deutschland (Statistisches Bundesamt).
13.000 Euro kostet eine Hochzeit durchschnittlich (Jost, Inhaberin Agentur Traumhochzeit).
800 bis 1.200 Euro betragen die Durchschnittkosten für ein Brautkleid (Becher, Messe Interbride).
„Groß“ gefeiert wird nur jede zweite Hochzeit (Messe Interbride). z Jede zehnte Braut tritt die Hochzeit klassisch in Weiß an (Messe Interbride). z Von 1.000 Bundesbürgern heirateten im Jahr 2011 4,6 Personen (Statistisches Bundesamt).
Ausgehend von diesen Zahlen bedeutet das, dass 0,23 weiße Hochzeitskleider pro 1.000 Einwohner zur Reinigung anfallen.
Beispiel Kleinstadt (20.000 Einwohner): 20 mal 0,23 = 4,6 weiße Brautkleider pro Jahr.
Beispiel kleine Großstadt (200.000 Einwohner): 200 mal 0,23 = 46 weiße Brautkleider pro Jahr.