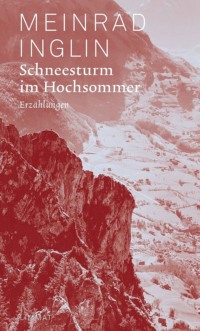Kitabı oku: «Schneesturm im Hochsommer», sayfa 3
Die Lawine
Auf der Eisenbahnbrücke, die das Doppelgeleise über die tiefste Schlucht der Bergstrecke hinwegführt, brüllte eines stürmischen Winterabends die Schildwache «Halt!» und ging mit schussfertig erhobenem Gewehr durch das Schneegestöber auf eine vermummte Gestalt zu, die sich der Brücke näherte. Die Gestalt blieb stehen, schob das verschneite Kopftuch beiseite und blickte mit einem blühend geröteten jungen Bäuerinnengesicht der Schildwache lächelnd entgegen. «Erschießt mich nur nicht!», rief sie.
«Ja so!», sagte der Soldat erfreut und nahm das Gewehr aus dem Anschlag. «Hab Euch nicht gleich erkannt.»
Die stattlich gewachsene, aber noch mädchenhaft wirkende Bauernfrau, die auf dem Weg vom Dorf zu ihrem Heimwesen hier auf einem hohen Steg den Bahndamm überschreiten musste, und der Soldat, der zu bestimmten Stunden hier die Brücke bewachte, hatten bei jeder Begegnung freundliche oder scherzhafte Worte gewechselt und einander jedes Mal besser gefallen. Der Soldat, ein lustiger lediger Bauernbursche, hätte sie zu seinem Vergnügen gern einmal besucht, aber da sie den Ehering trug, fand er sich nicht genügend dazu ermutigt.
«Seid Ihr auf dem Heimweg?», fragte er.
«Ja. Ich bin im Dorf unten gewesen. Aber hab Euch nur sagen wollen, dass man hier jetzt nicht mehr sicher ist.»
«Wegen der Laui, meint Ihr? Ja, auf dem Posten reden sie auch davon, aber unser Leutnant gibt nicht viel darum …»
«Der wird es ja wissen. Aber gelt, Euch hab ich es jetzt gesagt …»
«Halt!», rief der Soldat in diesem Augenblick einer zweiten Gestalt zu, die durch das Schneetreiben daherkam, dann schlug er, da nun diese Gestalt erstaunlicherweise nicht stehen blieb, mit einem erneuten brüllenden «Halt!» das Gewehr noch einmal an und wollte schon abdrücken, als ihm die Bäuerin den Gewehrlauf beiseitelenkte.
«Das ist doch der Seppetoni!», rief sie erschrocken. «Den werdet Ihr mir doch nicht erschießen wollen!»
«Der Tölpel, natürlich! Der ist hier schon vorgestern von einer Schildwache fast angeschossen worden … He du, geh heim!»
Der Schwachsinnige kam, vorgebeugt unter der Last eines beladenen Rückenkorbes, noch näher und grinste, unverständliche Laute ausstoßend, mit seinem armseligen, stoppelbärtigen Gesichte die Schildwache an. Erst auf den Befehl der Bäuerin ging er zurück und stapfte brummend über den Steg.
«Er hat halt Freude an den Soldaten», erklärte sie. «Ich bin ihm vorausgegangen, aber er hat mich rascher eingeholt, als ich dachte. Er ist bei uns Knecht.»
«Knecht? Da habt Ihr Euch einen rechten ausgesucht!»
«Ja, was wollt Ihr, wenn alles Mannenvolk im Militärdienst ist? Ich möchte ihn ja am liebsten wieder fortschicken, er ist ein Dreckfink und nicht immer gutartig, manchmal muss ich fast Angst vor ihm haben. Aber er kann tränken, misten, Holz scheiten und trägt mir die Ware vom Dorf herauf. Jetzt hat er ordentlich geladen, weil wir ein paar Tage lang nicht mehr hinuntergehen … eben wegen der Laui.»
«Aber wenn sie kommt, so fährt sie doch unter der Brücke durch das Tobel hinab?»
«Das schon, aber trotzdem ist man auf der Brücke nicht sicher …» Und die Bäuerin erklärte dem Soldaten, dass nach den Erfahrungen der Anwohner eine Staublawine niedergehen könnte.
Der Soldat blickte den Berg hinan, aber da ließ sich heute nur ein wenig vom unregelmäßig bewaldeten, durch das Flockengewirbel verschleierten nahen Steilhang sehen. Der Berg war über der Brücke mit einem lückenhaften Wald umgürtet, dann stieg er mit spärlich gegliederten kahlen Hängen noch zweitausend Meter hoch hinauf. Durch die breiteste Waldlücke fuhr im Frühling die Grundlawine oberhalb der Brücke in die Schlucht hinab, staute den Bach und trieb den Schneekegel zwischen den granitenen Brückenpfeilern durch, ohne Schaden anzurichten. Jetzt aber hatte seit drei Tagen und Nächten der immer noch andauernde Wintersturm den Berg mit trockenem Schnee überhäuft, der an den obersten Steilhängen den Halt zu verlieren und mitsamt den lockeren Massen der unteren Hänge durch den alten Lawinenzug hinabzustürzen drohte, doch eben nicht als schwere, schürfende Grundlawine, sondern als haltlos rasende Staublawine, die auf ihre berüchtigte Art die Luft unwiderstehlich vor sich her fegen, Tannen knicken und auf der Brücke einen Eisenbahnwagen umlegen konnte, noch eh der anbrausende Schnee auch nur die Pfeiler umbrandete.
«Übermorgen werden wir abgelöst», sagte der Soldat, «vielleicht wartet die Laui noch so lange, und sonst leg ich mich halt auf den Bauch, dann kann sie mir blasen.»
«Übermorgen?», fragte die Bäuerin und sah enttäuscht aus, dann wiederholte sie die Warnung mit einem so warmherzigen Eifer, dass der Soldat beim Abschied ihre Hand nun nicht gleich losließ.
Die Bäuerin fasste auch ihrerseits fester zu. «Kommt einen Augenblick da hinüber!», bat sie und zog ihn von der Brücke weg.
«Warum nicht!», sagte der Soldat. «Hier könnte man uns vom Posten aus noch sehen, und dann würden sie weiß der Teufel was für eine Geschichte draus machen.»
Die Bäuerin aber watete nach wenigen Schritten zu einem verschneiten eisernen Kreuze, wischte den Schnee von der daran angebrachten Tafel und wies schweigend auf die Schrift hin.
Der Soldat las, nicht zum ersten Mal, dass an dieser Stelle vor zwei Jahren der dreiundzwanzigjährige Josef Mattli tödlich verunglückt sei.
«Das ist mein Mann selig», erklärte die Bäuerin leise. «Er war auf dem Heimweg aus dem Militärdienst und wurde hier vom Luftdruck der Laui ins Tobel hinuntergeworfen. Nur sein Gewehr lag noch da.»
Der Soldat blickte zwischen der Tafel und der Frau verwundert hin und her und wusste nicht gleich etwas zu sagen.
«Nur damit Ihr seht, dass eine Staublawine hier keinen Spaß macht!», erklärte sie, trat vom Kreuze weg und lächelte wieder.
Jetzt schaute der Soldat sie mit andern Augen an. «O ich Esel!», sagte er leise, schob sich liederlich den Helm in den Nacken, sodass sein ganzes verdutztes Gesicht zu sehen war, und wandte keinen Blick von der halb verlegenen, halb belustigten jungen Witfrau. Plötzlich steckte er da, wo er stand, pflichtvergessen sein Gewehr mit dem Kolben in den tiefen Schnee, trat auf die Bäuerin zu und fasste sie an beiden Armen. Gedämpft, aber eindringlich, mit fester Stimme, sagte er: «Heut Nachmittag hab ich meinen letzten Ausgang gehabt. Ich muss noch einmal auf Patrouille und zweimal hier Schildwach stehen, dazwischen bin ich auf Pikett und kann nicht weg. Und Ihr wollt nicht mehr herunterkommen?» Da sie schwieg, rief er: «Am liebsten käm ich grad jetzt mit Euch heim.»
«Da wär Euer Leutnant aber nicht zufrieden, oder?»
«Nicht zufrieden? Jaha, wenn’s nur das wäre! Aber ich frage ihn, ob er mir nicht doch noch einen Ausgang bewilligt … Wie weit ist’s von hier zu Euch hinauf?»
«Zehn Minuten. Ich hab untertags aber viel zu tun, und nachts würde Euch niemand den Weg zu uns zeigen.»
Sie berieten eine Weile, erwogen diese und jene Möglichkeit, küssten sich dann zum Abschied und standen in der anbrechenden Dämmerung noch lange fest umschlungen da, während der Schneesturm sie lose wie mit einem weißen Bettlaken umhüllte, nicht fester als die flüchtige Gelegenheit es versprach, die sie im Kopfe hatten. –
Der Soldat wurde abgelöst und kehrte hinter dem Korporal auf den Posten zurück, wo er den Leutnant sofort um Bewilligung eines zweistündigen Ausgangs bat. Da er keinen triftigen Grund angeben konnte und der Posten bei dem durch Urlaube geschwächten Bestand der Kompagnie nur ungenügend besetzt war, bekam er die Bewilligung nicht. Er schwieg einen Augenblick mürrisch, dann warf er mit einem Unterton des Widerspruchs die Bemerkung hin: «Die Einheimischen hier sagen alle, das sei ja Gott versucht, wenn man jetzt da oben noch Schildwachen stelle und patrouilliere.»
«Schelbert», erwiderte der Leutnant zurechtweisend, «darüber entscheide ich allein, solang kein anderer Befehl kommt, verstanden?»
«Zu Befehl, Herr Leutnant!», rief Schelbert, die Absätze zusammenklopfend, und schien sich fortan, etwas unzufriedener, wortkarger, doch selbstverständlich mit dem strengen Wachdienst wieder abzufinden, bis sein Schicksal ihn auf die merkwürdigste Art außer Reih und Glied warf.
Am folgenden Morgen trat der Leutnant aus der frisch verschneiten Baracke, an der untersten rechtsufrigen Schluchtrampe, auf den ebenen Platz hinaus, immer noch hoch über der Mündung des Bergbaches in den Fluss des engen Haupttals, und blickte zur Brücke hinauf, wo Schelbert von sieben bis neun wieder Schildwach stand. Er sah ihn dort oben, ohne ihn auf diese Entfernung erkennen zu können, und dachte an seine Bemerkung von gestern Abend, die er dem etwas leichtfertigen, aber sonst tüchtigen Burschen nicht allzu übelnahm, obwohl die Mannschaft seither von der Gefahr schon offener munkelte. Der Schneesturm hatte da unten aufgehört und die Sicht auf den Berg über der Brücke freigegeben, doch in der Höhe blies er weiter und stäubte den lockeren Schnee wie Rauchfahnen von den obersten Gratwächten weg. Die Lawinengefahr bestand also weiter. Man war aber im Dienst, um eine Aufgabe auch dann zu erfüllen, wenn es gefährlich wurde. Hier war noch dies und jenes gefährlich, und man tat es dennoch. Zudem konnte die Schildwache da oben eine Lawine bei dieser Sicht schon von weitem erkennen und von der Brücke wegspringen, um sich geschützt an die Bahnrampe zu legen. Überhaupt, wie konnte man sich aus solchen Gefahren etwas machen, wenn man auch nur einen Augenblick an das stündlich bedrohte Leben der Soldaten fast aller andern Armeen in diesem mörderischen Kriege dachte!
Der Leutnant beschloss, die unregelmäßig auszuführende Tagespatrouille jetzt abzuschicken und sie mitzumachen, er bestimmte zwei Mann dafür und stieg mit ihnen, da es auf neun Uhr ging, hinter der Ablösung her zur Brücke hinauf. Eine Frau ging von Schelbert weg, als er abgelöst wurde, und der Leutnant fragte ihn nach ihr. Er antwortete wahrheitsgemäß, das sei eine Bäuerin von da oben, die häufig hier durchkomme und jetzt heimgehe. «Trotz der Lawinengefahr!», bemerkte der Leutnant. Schelbert schwieg. «Kommen Sie gleich mit auf Patrouille, Schelbert!», befahl der Leutnant. «Sie stehen für heute auf der Liste.»
«Zu Befehl!», rief Schelbert und hing sich unwirsch das Gewehr an.
Der Leutnant ging den Dreien voran auf die Brücke hinaus, wobei er den schmalen eisernen Laufsteg zwischen Geländer und Geleise unter den zugewehten gestrigen Stapfen im Schnee nur erraten konnte und zweimal zwischen Steg und äußeren Holzbohlen ein gähnendes Loch eintrat, das wohl einen Absatz klemmen und den Mann zu Fall bringen konnte. Auf der Mitte der Brücke stieg er mit den Zweien, die ihre Gewehre dem Dritten übergaben, einem Gefreiten, die Außenleiter hinab und in das mächtige eiserne Gefüge hinein.
Während die beiden Füsiliere die Schlösser der überall verteilten Minenkästen prüften, ging er selber zur Kontrolle einer Minenkammer auf dem schneeverwehten Plattensteg vorsichtig weiter bis zum nächsten Pfeiler und hatte sich dabei immer wieder unter gekreuzten eisernen Strebebalken durchzubücken. Dieser Steg besaß kein Geländer, und wer hier nicht schwindelfrei war oder sonst ausglitt, konnte leicht in die tiefe Schlucht hinunterstürzen; ein Offizier und ein Unteroffizier waren hier auf einem Kontrollgang so um ihr Leben gekommen. Als der Leutnant von diesem Gang zurückkam, sah er den Schelbert im vereisten Gebälk eigenmächtig mit einer Verwegenheit über dem Abgrund herumklettern, als ob es da etwas herauszufordern gälte. Er wunderte sich, schwieg aber dazu.
Alles war in Ordnung, die Brücke konnte in die Luft fliegen, wenn es notwendig würde. Die Patrouille stapfte oben auf dem Schienenweg weiter bergan, warf einen prüfenden Blick in die nächste Telefonkabine, zog ein Signalwerk auf und betrat einen längeren Tunnel, dessen Eingang von der Schildwache eines zur Kompagnie gehörenden nahen Unteroffizierspostens bewacht wurde. In diesem Augenblick signalisierte draußen am Eingang der Glockenhammer einen talwärts fahrenden Zug. Der Leutnant zögerte kurz, dann befahl er zwei Meter Abstand von Mann zu Mann und schritt, mit der Taschenlampe voranleuchtend, auf dem groben Schotter weiter in den stockdunklen Schacht hinein. Er hätte den Zug draußen abwarten können, aber man sollte nicht sagen, dass er selber sich auch nur das Geringste geschenkt habe. Vielleicht konnte man sich in eine Nische drücken, vielleicht auch nicht, aber für diesen zweiten Fall bestanden genaue Verhaltungsmaßregeln, die jeder kannte. Außerdem wusste jeder, dass vor Monaten ein bergwärts kontrollierender Offizier sich links in der Zugsrichtung hingeworfen hatte, statt rechts dem Zug entgegen, und am vorschriftswidrig getragenen Mantel unter die Räder gerissen worden war.
Der Leutnant ging an der letzten Nische vorbei und sah nach etwa dreißig Schritten vor sich in einer Kurve schon einen Schimmer Tageslicht, als der Zug von der offenen Strecke, wo der Schnee die Geräusche dämpfte, in den Tunnel einbog und mit dem voranstürzenden Ungetüm der elektrischen Maschine krachend auf ihn zuschoss. «Abliegen!», brüllte er noch, warf sich zwischen Tunnelwand und Geleise der Länge nach hin, dass der Helm hart aufschlug, und sperrte wie hinter feuernden Geschützen den Mund auf. Die Räder rasten mit einem ohrenbetäubenden eisernen Lärm Funken schlagend an ihm vorüber, und die Trittbretter, denen er kurz entgegenschielte, schienen so knapp an seinem Helm vorbeizusausen, dass er den Kopf wieder senkte. Die letzten Wagen des langen leeren Güterzuges, der mit Schnellzugseile talwärts glitt, verschwanden neben ihm wie weggewischt. Er sprang auf, leuchtete mit der Taschenlampe seine Leute an und sah nur zwei, die sich langsam erhoben; erschrocken fragte er nach dem Dritten und rief mit einem bangen Unterton in das Dunkel zurück: «Füsilier Schelbert!»
Der Gerufene meldete sich, kam mit einem Gegenstand in den Händen gelassen daher und erklärte ruhig, er sei vor dem Zug in die für ihn noch erreichbare Nische zurückgerannt. «Schelbert», rief der Leutnant erzürnt, «das ist nun allerdings Gott versucht, diesmal kann man es mit Recht sagen. Sie wissen, dass das verboten ist. Im Dunkeln vor dem Zug herrennen! Der reine Zufall, dass Sie nicht über Schotter und Schwellenköpfe gestolpert sind! In der Nische wären Sie dann geschnetzelt angekommen.»
«Und wenn ich nicht zurückgerannt wäre, Herr Leutnant, so würde ich jetzt wahrscheinlich mausetot neben den Schienen liegen», entgegnete Schelbert im Ton eines fast heiteren Widerspruches, als ob er diesmal seiner Sache mindestens so sicher wäre wie bei der gestrigen Widerrede, und wies den Gegenstand vor, einen schweren Bremsklotz, der genau dort zu Boden geschmettert worden sei, wo er sich hätte hinlegen sollen.
Der Leutnant leuchtete den Bremsklotz mit der Taschenlampe an, dann befahl er, um vorerst einmal ans Tageslicht zu kommen: «Vorwärts, wir wollen weiter!» Während er dem Ausgang zuschritt, hörte er die Leute hinter sich über das Vorgefallene reden und gewann den Eindruck, dass es wirklich ungefähr so geschehen sein müsse. Der Vordermann Schelberts behauptete jedenfalls, er habe bei allem übrigen Lärm hinter sich einen harten Aufschlag gehört, den er sich erst jetzt erklären könne, und Schelbert selber erzählte, dass der Klotz, der natürlich noch ein paar Sprünge gemacht habe, neben ihm an die äußerste Nischenwand geprallt und dort liegen geblieben sei. Ungewöhnlich war es nicht, dass auf dieser Strecke ein Bremsklotz absprang; gewisse ausländische Güterwagen, aus denen auch dieser Zug bestand, waren so verlottert, dass man nach ihrer Durchfahrt häufig abgesprungene Eisenteile fand, darunter auch manchmal einen Bremsklotz, ja dass untüchtige Wagen auf der Station ersetzt werden mussten. Ungewöhnlich war nur dieser Zufall, der dem Fehlbaren recht und seinem Vorgesetzten unrecht gab. Der Leutnant machte sich indes nicht allzu viel daraus und bemerkte am Ende nur noch, man könne ja ausnahmsweise einmal Glück haben, auch wenn man sich falsch benehme, aber das entschuldige nichts.
Die Patrouille kehrte um Mittag auf den Posten zurück, eben als wieder ein schneetreibender kalter Wind einsetzte, der gegen Abend zum schon gewohnten Sturm anwuchs. Der Leutnant meldete diesmal in seinem schriftlichen Abendrapport an seinen Vorgesetzten die Lawinengefahr, doch mehr, um es gemeldet zu haben, als um etwas zu erwirken. Nach Mitternacht ließ das Fauchen um die Baracke allmählich nach, und im ersten Tageslichte sah es wieder genau so aus wie gestern Morgen, der Sturm hatte da unten aufgehört und die Sicht auf den Berg über der Brücke freigegeben, aber in der Höhe blies er weiter. Die Ordonnanz am Barackenfenster, die tagsüber regelmäßig abgelöst wurde und mit der außer Rufweite stehenden Brückenschildwache Augenverbindung zu halten hatte, rief jedenfalls, dass der Wind immer noch Schnee von den obersten Gratwächten wegstäube. Das war um acht Uhr. Eine Viertelstunde später stieß diese Ordonnanz, um besser zu sehen, plötzlich das Fenster auf und rief laut: «Was ist das?»
Der Leutnant lief ans Fenster und sah am obersten Steilhang unter dem Grat ein pulveriges Schneegewölk, das sich rasch in die Länge zog und einen Augenblick aussah wie ein hochgeschwollen über Felsen polternder riesiger Wildbach. Er rannte hinaus und schrie zur Brücke hinauf, wo von sieben bis neun wie gestern Morgen wieder Schelbert Schildwache stand, schrie, die Hände als Schalltrichter vor dem Mund, aus vollem Halse: «Schelbert, fort, die Lawine, die Lawine!» Die Leute rannten auch hinaus und starrten schreiend und winkend zu ihrem Kameraden hinauf, der weder zu hören noch zu sehen schien und in unbegreiflich wirkender Ahnungslosigkeit dem Brückengeländer entlang patrouillierte. Schon war die obere Berghälfte von hastig aufquellenden pulverigen Schwaden halb verschleiert, die Lawinenfront überfuhr als breite, wulstige Brandung die mittleren Hänge, und ihr voran sauste es dunstig wie zerstäubtes Wasser, das der Sturm von schäumenden Wellenkämmen wegfegt, gegen den alten Lawinenzug hinab. Der Leutnant schrie nach Gewehren, um den unbegreiflichen Mann da oben durch Schüsse zu wecken, aber da schrak der Mann endlich selber auf; er hielt, wie man sah, knapp an, das Gesicht gegen den Berg gewandt, dann rannte er los, stolperte und fiel hin, was alle begreiflich fanden, die je über die schneeverwehte Brücke gegangen waren. Er stand wieder auf, unbehilflicher, als man ihm zugetraut hätte, drehte sich plötzlich torkelnd rundherum und flog über das Brückengeländer hinaus. Alle sahen es, einige wie auf den Mund geschlagen, andere mit erregten Rufen. Er flog, in Dunst gehüllt, aber vom unheimlichen Hintergrund eines brodelnden weißen Gewölks noch deutlich abgehoben, wehrlos ins Leere hinaus, und gleichzeitig nahte von dorther ein pfeifendes Sausen wie vom heranstürzenden Föhn. Im nächsten Augenblick rannten alle Leute, von einem Sturmwind gepackt, der die Tür und das offene Fenster zuschmetterte, hinter die Baracke, es wurde dunkler, als ob ein Gewitter ausbräche, die Luft war voller Schneestaub, und von der Schlucht her donnerte das dumpfe Gepolter der aufschlagenden Lawinenmasse.
Der Leutnant befahl die Mannschaft in die Baracke hinein, ließ durch den Gefreiten den beiden nächsten Bahnstationen telefonisch den Niedergang der Lawine melden und schickte gleichzeitig eine vom Korporal geführte Patrouille zur Brücke hinauf, mit dem Befehl, allfällige Züge in genügender Entfernung anzuhalten, wenn das Geleise verschüttet oder die elektrische Fahrleitung beschädigt sein sollte. Darauf meldete er den Vorfall seinem Hauptmann, bat um das Aufgebot der Kompagniereserve, bestellte Schaufeln, Pickel, Sondierstangen, einen Lawinenhund, und führte, den Wachtmeister als seinen Stellvertreter und drei Mann in der Baracke zurücklassend, die übrigen Leute mit ihrem Schanzwerkzeug und der einzigen Schneeschaufel auf die Suche nach dem Verunglückten in die Schlucht hinab.
Die niedergegangenen Schneemassen bedeckten die Schluchtsohle verschieden hoch auf einer Breite von hundert bis zweihundert Metern und einer von unten her nicht abzuschätzenden Länge, sie waren hart gepresst und boten gegen die Brückenpfeiler hinauf den Anblick eines zerrissenen, von Altschnee überlagerten Gletscherabbruches. Die Schluchthänge dagegen waren von pulverigem Schnee so hoch überstäubt, dass man stellenweise bis über die Hüften darin versank. Da und dort ragten dunkle Gegenstände aus der harten Masse, und die Leute liefen eilig danach, aber es waren abgesplitterte Stämme, Strünke und Äste. Der Leutnant sammelte seine Mannschaft am untersten Ausläufer, wo der gestaute Bach versiegte, und ließ sie in lockerer Linie langsam suchend über die Schneeschuttmassen hinauf vorrücken. Es schien hoffnungslos, irgendwo nach der verunglückten Schildwache graben zu wollen, und so musste wenigstens versucht werden, wenn nicht sie selber, so doch eine Spur von ihr an der Oberfläche zu finden.
Die Suchmannschaft kam in die Nähe der kirchturmhohen Brückenpfeiler und wollte die Hoffnung schon aufgeben, als das Unglaublichste geschah. Aus dem Pulverschnee am linken Schluchthang arbeitete sich mit müden Bewegungen ein weiß überstäubter Mann an den Rand der Lawinenmasse hinauf, und der Mann war – die Leute, die ihn entdeckten, rannten, seinen Namen schreiend, zu ihm hinab –, der Mann war Schelbert.
Er stand da, als seine Kameraden ihn umringten und der Leutnant vor ihn hintrat, blickte sie mit verstörten Augen an und schien die Sprache verloren zu haben.
«Schelbert», sagte der Leutnant, «jetzt fange ich an zu glauben, dass Sie einen Schutzengel haben. Ist doch das reinste Wunder, dass Sie noch leben!»
Schelbert blickte ihn an und schwieg.
«Er ist noch nicht ganz beisammen», sagte einer seiner Kameraden leise. «Vielleicht ist er auf den Kopf gefallen.»
Sie suchten ihn dadurch zu wecken, dass sie alles erzählten, was sie gesehen hatten, und ihm Einzelheiten in Erinnerung riefen. Sie sagten ihm, dass er als Schildwache da oben die Lawine zu spät bemerkt habe, dass er beim Fortrennen gestolpert, hingefallen und gleich nach dem Aufstehen vom Luftdruck über das Geländer hinaus geschleudert worden sei. «Wir haben doch jetzt die ganze Lawine nach dir abgesucht, wir dachten, du seiest mausetot.»
Schelbert schwieg noch immer, hörte aber jetzt so angestrengt zu, als ob er wirklich versuchte, sich das alles in Erinnerung zu rufen.
«Sie haben beim Sturz wahrscheinlich das Bewusstsein verloren», erklärte der Leutnant. «Aber vielleicht fällt Ihnen doch dies und jenes noch ein. Es wäre interessant zu wissen, wie und wo Sie gelandet sind … vermutlich doch weiter unten, oder? Und dann sind Sie, bevor wir kamen, da hinaufgegangen?»
Schelbert machte eine Kopfbewegung, die man für ein Ja nehmen konnte.
«Vielleicht wollten Sie Helm und Gewehr suchen, die haben Sie beim Sturz doch verloren, nicht?»
«Helm und Gewehr?», fragte er nun dumpf und dachte einen Augenblick nach. «Die muss ich vielleicht da oben suchen.»
«Auch möglich. Sie wurden ja nur so herumgewirbelt, das hat man gesehen. Aber der Luftdruck muss Sie nicht nur hochgenommen, sondern nachher getragen und glimpflich abgesetzt haben … oder Sie sind von einer Art Unterströmung, die unter der Brücke durchkam, aufgefangen worden … Verstehen kann man es nicht, es scheint ganz unglaublich. Aber die Hauptsache ist, dass Sie davongekommen sind.»
Damit schickte er ihn mit den übrigen Leuten in die Baracke zurück und ging der Reservemannschaft entgegen, die mit Pickeln und Schaufeln durch die Schlucht heraufkam. Er traf seinen Hauptmann dabei, erstattete Meldung und hatte Mühe, ihm das Vorgefallene glaubhaft zu machen. Die Mannschaft wurde auf dem kürzesten Weg zur Brücke hinaufgeführt, wo sie die hoch überpulverten Geleise auszuschaufeln hatte. Die untere Station schickte einen Reparaturwagen mit Arbeitern, die den Strom ausschalteten und die von verbogenen Trägern herunterhängende Fahrleitung zu flicken begannen.
Schelbert wich allen Fragen aus, er blieb schweigsam, nachdenklich, ja bedrückt, wie ein Mensch, der etwas Schweres zu ertragen hat, ohne es verstehen zu können. Aber plötzlich verlangte er, seinem Leutnant und dem Herrn Hauptmann eine Aussage zu machen. Er wurde in die Barackenkammer des Wachtkommandanten gewiesen, nahm beim Eintritt der beiden Offiziere mit finsterer Miene stramm Stellung an und gestand, dass er ein schweres Wachtvergehen zu bekennen habe. Der Hauptmann bat den Leutnant, ein Protokoll aufzunehmen, und das Verhör begann.
Schelbert erzählte, wie er als Schildwache bei der Brücke jene Bäuerin kennengelernt habe, eine junge Witwe, und sie gern vor der Ablösung noch daheim besucht hätte. Er habe vom Leutnant keine Bewilligung zum Ausgang mehr erhalten, aber sich nicht damit abfinden können. Die Bäuerin sei dann gestern noch einmal zur Brücke herabgekommen, da hätten sie zusammen einen Plan gemacht, und genau nach diesem Plane habe er heute Morgen seinen Schildwachposten verlassen und die Zeit bei der jungen Bauernfrau verbracht.
Der Leutnant schlug mit der flachen Hand auf den Tisch und blickte den Geständigen verblüfft an, der Hauptmann bemerkte sehr ernst, ein solcher Fall werde nicht disziplinarisch erledigt werden können, sondern vor Divisionsgericht kommen.
Schelbert nahm dies ruhig hin und fuhr unbeirrt in seinem Berichte fort. Daraus ging hervor, dass er sich vom Korporal um sieben Uhr als Schildwache bei der Brücke aufführen ließ, jedoch schon mit der Absicht, nicht hier stehen zu bleiben. Kaum war der Korporal verschwunden, als die junge Frau mit ihrem halb verblödeten Knecht über den Steg kam. Der Knecht war als Soldat verkleidet, er trug die Uniform und Ausrüstung ihres verunglückten Mannes, der vor zwei Jahren an dieser Stelle vom Lawinenwind in die Schlucht hinuntergefegt worden war. Sie sagten ihm, dass er hier nun Schildwach stehen müsse, bis Schelbert zurückkehre, sie schärften ihm ein, wie er sich zu verhalten habe, um nicht aufzufallen, und warnten ihn auch vor der Lawine wie vor den Zügen. Der armselige Mensch, der hier schon mancher Schildwache neugierig grinsend zugesehen hatte, stellte sich gelehrig an und begann den Dienst, erfüllt vom Gefühl seiner Wichtigkeit, mit kindischer Freude. Schelbert und die Frau aber stiegen eilig zu dem nahen Heimwesen hinauf. Während sie noch beisammen waren, hörten sie am gegenüberliegenden Berghang die Staublawine niedergehen. Sie rannten zur Brücke hinab, suchten den verkleideten Knecht und fanden ihn nicht mehr. Schelbert stieg ins Tobel hinunter, um dort nach der Leiche zu suchen, und wurde dabei von der Suchmannschaft des Wachtpostens entdeckt. Von ihr erfuhr er das Geschehene, und weil dabei nur von seiner eigenen wunderbaren Rettung die Rede war, konnte er in seiner Verwirrung die Wahrheit nicht gleich sagen.
Dies war sein Bericht. Das Protokoll wurde ihm vorgelesen, er unterschrieb es und bat am Ende, dass man doch jetzt den Verunglückten in der Schlucht suchen möge. Der Hauptmann versprach, die verlangten Leute vom Lawinendienst mit den Sondierstangen und dem Hunde sofort an die Arbeit zu schicken.
«Schelbert, Sie wissen offenbar, was Sie getan haben», schloss der Hauptmann. «Das Divisionsgericht ist streng und wird Sie zu einer schweren Strafe verurteilen. Dass Sie aber aus eigenem Antrieb bekannt haben und also die Strafe auf sich nehmen wollen, wird als Milderungsgrund sehr ins Gewicht fallen. Ich meinerseits verzichte besonders aus diesem Grunde, Sie hier sogleich einzusperren. Sie gehen jetzt zu Ihrem Zuge zurück!»
«Zu Befehl, Herr Hauptmann!», rief Schelbert, und dann bemerkte er noch, mit demselben schweren Ernst, den er während seiner ganzen Aussage bewahrt hatte, Helm und Gewehr seien noch dort oben bei der Frau, er habe in der Hast vergessen, sie mitzunehmen.
Der Hauptmann fragte den Leutnant, dann Schelbert, ob von seinem Zuge einer das Heimwesen kenne, und da man keinen wusste, entschied er, dass Schelbert selber Helm und Gewehr hole.
So kam es, dass vor der Ablösung der Kompagnie der verwandelte Soldat und die mitschuldige junge Frau einander noch einmal trafen. Was sie dabei besprachen und was sie vorher zusammen erlebt hatten, kam erst bei den Verhandlungen vor Divisionsgericht an den Tag. Bis dahin bewahrte Schelbert ein Schweigen, das nichts preisgab als den bloßen Tatbestand. Am Vorabend aber gelang es dem menschlich erfahrenen Verteidiger, dem spröden Burschen Geständnisse zu entlocken, die seine zwar offenbare, aber doch nicht ganz durchsichtige innere Wandlung erklärten und begründeten.
Er hatte, wie er beschämt und ungeschickt gestand, bei der jungen Bäuerin mehr gefunden als das gesuchte flüchtige Vergnügen, nämlich das, was einem so leichtsinnigen Burschen wohl nur einmal begegnet, was ihm plötzlich die Augen öffnet und ihn, wenn er etwas wert ist, nun erst zum Manne macht. Noch eh jene Stunde zu Ende war, fragte er sie, ob sie seine Frau werden wolle. Sie erwiderte, sie sei mit ihrem ersten Manne nicht glücklich gewesen und möchte sich diesmal nicht wieder so rasch und unbedacht entschließen, doch gefalle er ihr, sonst hätte sie ihn ja niemals zum Besuche ermuntert, und sie werde ernsthaft darüber nachdenken. Da fuhr drüben mit dem unheimlichen Fauchen, das sie kannte, die Lawine den Berg hinunter. Sie rannten zur Brücke hinab, und als sie den Knecht nicht fanden, packte die Frau den Soldaten mit beiden Händen an den Schultern und sagte erschüttert, mit Sätzen, die er nur allmählich in ihrem Zusammenhang verstand, dass sie nicht wisse, ob dies ein Fluch oder ein Segen sei. Sie habe gewünscht, ihren ersten Mann loszuwerden, und die Lawine habe ihn weggenommen. Dann habe sie gewünscht, diesen beschwerlichen Knecht loszuwerden, und auch ihn habe die Lawine genommen, im gleichen Soldatenkleid, mit dem gleichen Gewehr und Helm wie ihren Mann, als ob sie das erste Unglück hätte wiederholen und bekräftigen wollen.