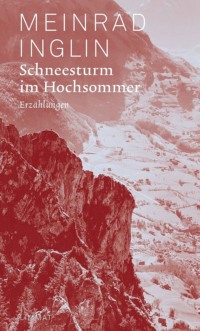Kitabı oku: «Schneesturm im Hochsommer», sayfa 4
«Dafür hat sie mich verschont», antwortete Schelbert, als er es begriff. «Auch ich hätte hier das Leben verlieren können; stattdessen ist mir, als ob ich es bei dir erst recht gewonnen hätte. Für mich hat es nun dieser arme Mensch verloren, und er hat es in der gleichen Uniform verloren wie der Mann, der nicht zu dir passte; dies alles sollte nicht umsonst geschehen sein, auch wenn der unglückliche Knecht dadurch von seinem elenden Dasein erlöst worden ist. Ich kann es nur so ansehen, und wenn du es auch so ansiehst, ist es für uns beide ein Segen.»
Da kamen sie überein, das Ereignis als ein ungeheures Zeichen anzusehen, das sie beide für immer aufeinander anweise, und sie versprachen sich noch auf der Brücke feierlich, Mann und Frau zu werden. Darauf stieg der Mann in die Schlucht hinab, um den Verunglückten zu suchen, und die Frau rief ihm nach, dass sie daheim auf ihn warte.
Er hätte es leicht gehabt, vor seinem Leutnant den wunderbar Geretteten zu spielen, sein schweres Wachtvergehen zu verheimlichen und vielleicht später bei der Schneeschmelze den Verunglückten zu suchen und beiseitezuschaffen, aber nach dem, was auf der Brücke geschehen war, konnte er zuerst nur schweigen. Als er dann wieder bei der Frau eintraf, um Gewehr und Helm zu holen, sagte er zu ihr: «Ich habe mich als Schildwache schwer vergangen, schwerer, als du begreifen kannst, und ich bin immer noch ein Soldat. Meinst du nicht, dass da etwas Dreckiges an mir hängen bliebe, auch wenn alles andere so kommen musste, wie es kam?»
«Doch!», antwortete sie rasch. «Du musst es bekennen und die Strafe annehmen. Es ist für uns ja auch dann noch kein ganz sauberer Anfang, weil wir doch daran schuld sind, dass der Seppetoni um sein armes Leben gekommen ist. Ich will eine heilige Messe für ihn stiften, und bei der Brücke sollte auch er ein Kreuz haben. Bekenne du nur, wir wollen das nicht auch noch mittragen!»
«Das freut mich», sagte er. «Ich habe es schon gestanden, ich werde vor Divisionsgericht kommen und viele Monate absitzen müssen, aber dann bin ich es los.»
Sie erschrak über eine so schwere Strafe, aber sie musste ihm recht geben und versprach, getreulich auf ihn zu warten. –
Dies alles erfuhr der Verteidiger auf eine etwas umständlichere, sprödere Art am Vorabend der Verhandlungen; er stellte es in seiner Verteidigungsrede schonend, aber eindringlich so dar und rückte damit den schwierigen Fall erst in jenes rechte Licht, das ihn über das starre Gesetz hinaus dem lebendigen menschlichen Urteil unterbreitete. Das Gericht tönte in seinem Wahrspruch denn auch an, eine so außerordentliche Verknüpfung von Zufällen, die zu einer so entschiedenen inneren Wandlung des Fehlbaren und am Ende noch zu einem so erfreulichen Ergebnis führe, könne man fast nur noch Schicksal nennen. Es verurteilte den Angeklagten zu sechs Monaten Gefängnis, jedoch bedingt, zu einer Strafe also, die ihn wohl noch bedrohen und an sein Vergehen erinnern, aber nicht mehr erreichen konnte, da er selber keinen Augenblick an seiner künftigen Bewährung zweifelte. Sein Leutnant beglückwünschte ihn dazu und meinte, es sei märchenhaft, wie sich ihm alles zum Guten gewendet habe. Schelbert erwiderte ernsthaft: «Es hat so kommen müssen.»
Als der sehr nüchtern denkende Hauptmann die Begründung des Urteils gelesen hatte, sagte er lachend zu seinem Leutnant: «Der Aufwand, den das Schicksal da getrieben hat, um aus zwei einfachen Menschen ein Paar zu machen, scheint mir denn doch etwas reichlich.»
«Zugegeben!», erwiderte der Leutnant. «Aber ein Mensch wie dieser Schelbert ist mir auch noch nie vorgekommen. Er kann über Abgründen herumklettern, er fällt nicht herunter, er kann im Tunnel einem abspringenden Bremsklotz ausgesetzt sein, er wird nicht getroffen, er kann in diesem Tunnel vor dem Zug herrennen, er wird nicht überfahren, er kann als Schildwache auf einen Posten gestellt werden, wo eine Lawine alles hinwegfegt, er gerät nicht in die Lawine, er kann sich eines schweren Vergehens schuldig machen, er muß die Strafe nicht antreten. Es ist ihm bestimmt, eine junge Bäuerin zu heiraten, und da kann er das Verkehrteste, Verbotenste tun, er tut dennoch immer das Richtige und wird auf diesem scheinbar verrückten Umweg auf die unglaublichste Art geradenwegs ans Ziel geführt. Und zuletzt behauptet er noch, dass alles so habe kommen müssen! Wenn das nicht mehr ist als Glück, dann weiß ich nicht, was man Schicksal nennen sollte.»
Drei Männer im Schneesturm
Eines Tages im September stiegen drei Männer aus demselben Dorfe zu einer Wanderung ins Hochgebirge hinauf. Sie galten als tüchtige Bergsteiger, und niemand zweifelte, dass sie wohlbehalten zurückkehren würden; aber nur zwei von ihnen kehrten lebend zurück. Ein Unglück in den Bergen war kein seltenes Ereignis, fast jeden Sommer einmal brach die Rettungskolonne auf, um Verletzte oder tödlich Abgestürzte zu bergen; was die beiden von ihrem Erlebnis erzählten, klang denn auch durchaus glaubwürdig und hätte andern ebenso gut zustoßen können. Sie waren noch zu dritt in einen Schneesturm geraten, wie er auf Höhen über zweitausend Metern mitten im Sommer hereinbrechen kann, und bei schlechter Sicht einen Steilhang hinabgerutscht; dabei hatten zwei von ihnen Beinbrüche erlitten, und einer dieser Verletzten war später vor Erschöpfung gestorben. In diesem Bericht aber gab es eine Stelle, die nicht ganz klar schien und von jedem der beiden Zurückgekehrten unabsichtlich ein wenig anders erzählt, ja bei einer gelegentlichen Wiederholung sogar abgeändert wurde. Der Erzähler, den man auf diese Unstimmigkeit hinwies, verriet eine gewisse Verlegenheit, besonders der eine, der das Abenteuer heil überstanden hatte, ein Zugewanderter übrigens, der erst seit einem halben Jahr als Fotograf im Dorfe wohnte; von ihm munkelte man am Ende geradezu, dass er den Hinterlassenen seines verunglückten Kameraden ausweiche, als ob er ein schlechtes Gewissen hätte. Er war ein mächtig gebauter, geistig sehr regsamer Mensch mit gutherzigen Augen, der als Kurdirektor, Skilehrer oder Klavierspieler bald da, bald dort gewohnt und sich überall rasch beliebt, aber nirgends sesshaft gemacht hatte. Dieser unstete Mann, den viele nur nach seinem Vornamen Christoph nannten, wurde nun in der Tat vom Anblick der Hinterlassenen und von Fragen nach dem ungelösten Rest jenes Berichtes dermaßen geplagt, dass er das Dorf schon bald wieder verließ. Jahre später erzählte er in einem Kreis vertrauter Freunde sein Erlebnis, das ihm unvergesslich und bis zu jeder Einzelheit noch gegenwärtig war. Er erwähnte seine Begleiter, Karl und Otto, zufällige Bekannte, und begann:
Wir hatten eine zweitägige Wanderung bei strahlendem Licht über Gletscher und Gräte hinter uns. Am Morgen des dritten Tages standen wir um vier Uhr in der Dunkelheit vor der Klubhütte, streckten die Nasen in die Luft und suchten den Himmel nach Sternen ab. Der Himmel war wider Erwarten bedeckt. Karl und Otto wollten trotzdem aufbrechen, da wir keine gewagte Gipfeltour vorhatten, sondern abermals nur eine Wanderung, wenn auch eine langwierige durch ein abgelegenes, großartig wildes Gebiet. Mir war es recht. Ich gab immerhin noch zu bedenken, dass wir in den nächsten zwölf Stunden keine Hütte antreffen würden, aber dann brachen wir auf.
Nach einem dreistündigen Anstieg über Alphänge und alte Schneefelder erreichten wir den Grat, auf den wir es vor allem abgesehen hatten, einen mannigfaltigen, bald breiten, bald schmalen Rücken, der auf einer mittleren Höhe von zweitausendfünfhundert Metern sich weit gegen Osten hin streckt. Auf diesem Grate wanderten wir nach kurzer Rast dahin, einen kühlen Nordwestwind im Rücken, der uns nicht recht gefiel, aber vor uns eine Wunderwelt von Flühen, Schründen und urweltlichen Trümmerfeldern, von fernen Gipfeln, Kämmen und Gletschern, eine wahre Augenweide, die uns gar nicht daran denken ließ, umzukehren. Wir zogen tüchtig aus, stiegen da über einen Höcker hinweg, dort in einen Sattel hinab, umgingen irgendeinen Stock, dessen Namen kein Mensch kennt, und kamen immer wieder auf bequeme gleichmäßige Strecken des Gratrückens. Der Wind nahm zu, aber da wir mit ihm gingen, fiel uns das nicht besonders auf, bis er plötzlich weiße Körnchen vor uns hertrieb, weit zerstreute feine Schneekörner. Bis jetzt hatte man auf dieser kahlen Höhe den Wind nicht gesehen, jetzt sah man ihn. Als wir anhielten, mussten wir uns die Hüte schon fester aufdrücken. Wir begannen zu beraten, gleichmütig, wie es erprobten Bergsteigern ansteht, obwohl uns alles andere als Gleichmut erfüllte. «Wir müssten auf dem nächsten Wege bergab», sagte Karl ruhig, und das war ein ebenso einsichtiger wie überflüssiger Rat, da es, was auch er wusste, weithin nur Felsabbrüche und steile Kletterhänge, aber keine nächsten Wege bergab gab; wir konnten nur zurück oder vorwärts gehen. Ich schlug den Rückweg vor, und wir gingen zurück. Ungefähr zehn Minuten lang wanderten wir gegen den Wind, aber mit jeder Minute schien die Windstärke zu wachsen, und was wir im Nordwesten vor uns hatten, glich schon eher einem Schneetreiben als einer Aussicht. Otto blieb stehen und sagte: «So können wir es vielleicht eine Stunde lang aushalten, aber dann sind wir noch nicht weiter als sonst in zwei Stunden; lieber vorwärts.» Da Karl ihm zustimmte, kehrten wir um und gingen mit dem Winde wieder vorwärts. Es war falsch, wir hätten den Rückweg erzwingen müssen, den ich vorgeschlagen hatte, und ich ging nicht aus Überzeugung davon ab, sondern nur deshalb, weil auch mir das Gehen mit dem Winde leichter fiel. Diese schwächliche Nachgiebigkeit kann ich mir heute noch nicht verzeihen, so begreiflich sie erscheinen mag; ich habe diese ganze Geschichte gründlich durchdacht und mir alles vorgeworfen, was nach einer Schuld aussah. Ich will meinen Anteil redlich tragen.
Wir gingen also vorwärts, während der Wind uns immer kälter in den Nacken biss und den körnigen Schnee immer eiliger und dichter vor uns hinsäte. In unglaublich kurzer Zeit war alles weiß, so weit wir sehen konnten, und als wir nach einer Stunde den Abhang eines Stockes, der uns im Weg stand, auf der Windseite überqueren mussten, merkten wir ziemlich erstaunt, dass der Schnee, der auf dem Grate immer wieder weggefegt wurde, uns hier schon bis zu den Knöcheln reichte. Der Wind wuchs zum Sturm an, und der waagrecht geschleuderte Schnee blieb an uns haften wie Klebstoff. Wir begannen an die Ohren und Hände zu frieren und büßten es nun, dass wir keine Handschuhe mitgenommen hatten. Am unangenehmsten jedoch war die immer stärker beschränkte Sicht; wir sahen im Schneetreiben wie im dichtesten Nebel keine zwanzig, ja manchmal keine zehn Schritte weit und gingen immer langsamer, vorsichtiger, um nicht auf eines der ausweglosen Bänder zu geraten.
Der Grat läuft am Ende in eine unregelmäßige Hochebene aus, die im Nordosten durch einen leicht ansteigenden langen Kamm begrenzt wird. In diesem Kamm gibt es eine «Lücke», eine der bekannten, einander ähnlichen Lücken, die oft den einzig möglichen Durchstieg durch langgestreckte felsige Schranken oder Riegel bezeichnen und die in unseren Gebirgskarten ja auch sorgfältig eingetragen sind. Diese Lücke mussten wir finden, und wir bildeten uns ein, dass es drüben dann besser gehen werde, obwohl wir hätten wissen können, dass uns dort ein zwar abfallendes, aber trostlos weites, vor dem Winde ungeschütztes Gebiet erwartete.
Wir stapften also vom Grat auf die sogenannte Hochebene hinaus, die mit einer richtigen Ebene natürlich wenig zu tun hat, und hier reichte uns der Schnee schon bis an die Waden. Den Rücken gebuckelt, den Hut über den Ohren, die Hände in den Hosensäcken, gingen wir, leicht nach Nordosten haltend, auf den Kamm zu, den wir nach unserer Meinung gar nicht verfehlen konnten. Da ich vorhin sagte, der Wind sei zum Sturm angewachsen, so müsste ich jetzt sagen, er sei zum Orkan geworden, wenn diese Bezeichnung in unseren Breiten erlaubt wäre, zu einem atemraubenden eisigen Schneesturm, dem wir uns schräg nach links entgegenstemmen mussten, um nicht hingelegt zu werden. Wer so etwas nie erlebt hat, dürfte es kaum für möglich halten, aber ich erlebte es zum zweiten Mal und kann es bezeugen. Den ersten derartigen Sturm in einer unwegsamen Hochgebirgsgegend überstand ich vor etwa fünfzehn Jahren, und zwar mitten im Sommer, an einem achtundzwanzigsten Juli, einen Schneesturm, der die Straße vor der noch tief unter uns liegenden Passhöhe meterhoch verwehte, das Postauto zur Umkehr zwang, Telefonmasten knickte und das Hospiz von der Außenwelt abschnitt. Einige Zeitungen haben darüber berichtet, man kann es nachlesen, wenn man will. Unten in den Tälern merkt man wenig davon, man ärgert sich höchstens über die kühlen Regenschauer, und da oben schwingt der weiße Tod wie rasend sein riesiges Leintuch über ein paar armen Bergsteigern.
Dieses frühere Erlebnis stieg vor mir auf wie ein beängstigender Traum, als wir nun auf den Kamm losgingen, und mir schien, es sei wieder genau so wie damals, nur dass es jetzt September und nicht Juli war. Das Gelände begann endlich vor uns anzusteigen, wie wir es erwarteten, aber es war nur eine Bodenwelle, drüben ging es zu unserer Enttäuschung wieder bergab, und zwar so weit, dass wir Verdacht schöpften und nach kurzer Zeit denn auch nichts mehr vor uns hatten als den Abgrund. Wir vermuteten, dass wir zu weit nach Norden abgewichen waren, wo es schroff in die Tiefe ging.
Hier verrieten meine beiden Kameraden zum ersten Mal ihre gedrückte Stimmung, sie fluchten voll banger Sorge und suchten nun endlich den Kompass aus dem Rucksack hervor, was wir schon längst hätten tun sollen. Diese Unterlassungssünde nahm ich auf mich, ich hatte an den Kompass gedacht und ihn nur deshalb nicht hervorgeholt, weil ich meinte, dass wir ohne ihn auskommen würden, und weil es vor allem sehr widrig war, stehen zu bleiben, den Rucksack abzuhängen und aufzumachen. Das klingt vielleicht merkwürdig, aber es ist dennoch so; man fürchtet sich in einer derartigen Lage geradezu, das beruhigende Gehen und unablässige Denken auf ein bestimmtes Ziel hin zu unterbrechen, denn bei jedem Halt sind nicht nur Wind und Kälte viel schwerer zu ertragen, man wird auch von ganz unnötigen Gedanken überfallen und hat das Gefühl, kostbare Minuten zu verlieren.
Wir stellten fest, dass wir wirklich zu weit nach links geraten waren und hier unmittelbar über den steil abfallenden Nordwänden standen. Nun gingen wir auf unseren eigenen Spuren, die übrigens schon nach hundert Schritten kaum mehr zu erkennen waren, eine ordentliche Strecke zurück, dann steiften wir den Kompass ein und nahmen die Nordostrichtung. Auf diese Art kamen wir nach einer Stunde zum Kamm hinauf, wo wir uns sofort trennten, um die Lücke zu suchen. Karl und Otto gingen nach rechts; ich suchte nach links, geriet aber bald wieder zu weit bergab und sah noch einmal in der Karte nach dem Verlauf des Kammes, dann kehrte ich um und folgte, meine Schritte zählend, den Kameraden, die sich, wie ich an den verwischten Spuren gerade noch erkennen konnte, durch jede größere Scharte hinausgebeugt hatten. Der ziemlich zerrissene Kamm war überall von Schneewehen bedeckt wie von Wellen, die sich schäumend überschlagen. Nach ungefähr vierhundert Schritten musste die Lücke zu finden sein, wenn meine Berechnung stimmte, und dort fand ich sie auch. Karl und Otto, die noch über sie hinausgesucht hatten, kamen zurück und erklärten ebenfalls, dies sei die richtige Stelle.
Vorsichtig traten wir in den gabelförmigen Ausschnitt und blickten auf die andere Seite hinab, konnten aber nicht viel mehr erkennen als den obersten Ansatz eines Steilhanges, der sich im Schneegestöber verlor. Wir waren einig, dass uns hier das schwierigste Stück des Tages bevorstand, da wir mit dem Pfade nicht rechnen konnten. Dieser schmale, auch bei aperem Boden oft kaum sichtbare Pfad, der stellenweise nicht breiter ist als eine Handspanne, führt im Zickzack etwa hundert Meter weit den felsigen Hang hinab, war aber nun völlig verweht und nicht einmal zu erraten.
Die Lücke gewährte einen notdürftigen Schutz vor dem Sturm, und hier setzten wir uns in den Schnee, um zu essen. Wir hatten seit vier Stunden nicht mehr gerastet, waren hungrig und vom Waten ermüdet. Wir fanden es aber nach wenigen Minuten schon so ungemütlich und begannen derart zu frieren, dass Karl und Otto zum Aufbruch drängten. Außerdem hatten wir viel Zeit verloren, es war schon drei Uhr nachmittags, und wir mussten uns beeilen, wenn wir vor der Dunkelheit ins Tal hinabkommen wollten. So seilten wir uns denn an und stiegen ab. Ich ging als Letzter am Seil und konnte in der Lücke noch gut sichern, aber weiter unten wurde es schwieriger, der Schnee bot keinen genügenden Halt, und wo man ihn wegwischte oder mit dem Eispickel durchschlug, geriet man immer häufiger auf Felsplatten. Plötzlich rutschten wir ab. Ich weiß noch genau, wie es geschah. Wir waren schon im untersten Teil des Hanges, ich hatte gesichert, so gut ich konnte, Otto ging voraus, soweit das Seil es erlaubte, dann suchte er ziemlich lange, ohne einen richtigen Halt zu finden, und rief endlich: «So, jetzt, glaub’ ich … probiert’s!» Kaum hatte ich meine Sicherung aufgegeben, da schrie Karl, der zwischen uns ging, laut: «Halten!» Im selben Augenblick wurde ich durch einen Ruck am Seil aus dem Stand gerissen, rutschte Karl nach und stemmte meinen Pickel mit aller Kraft umsonst in den Hang. Ottos Sicherung versagte, wir rissen ihn mit, rutschten auf dem Schneehang, der gegen meine Befürchtung nicht ins Gleiten kam, etwa zehn Meter weit ab und stürzten zuletzt noch drei, vier Meter auf nur fußhoch verschneite harte Karren hinunter.
Beim Aufprallen überschlug ich mich, rutschte um eine Manneslänge weiter und griff mit beiden Händen in den Schnee, um mich festzuhalten, aber wir waren endgültig unten angelangt. Ich lag mit schmerzender Hüfte an einem schrägen Bord und hörte dicht über mir auf dem Absatz, wo meine Kameraden lagen, ein raues Stöhnen und jammerndes Fluchen. Ich prüfte meine Glieder, erhob mich und stellte aufatmend fest, dass ich mit einer tüchtigen Quetschung davongekommen war. Karl und Otto dagegen klagten über starke Schmerzen im linken Bein und fielen beim Versuche, aufzustehen, stöhnend gleich wieder hin. Es ergab sich, dass sie wahrscheinlich den linken Unterschenkel, mindestens aber das Wadenbein gebrochen hatten, sie konnten weder gehen noch auf beiden Beinen stehen. Otto blickte mich mit ungläubig erschrockenen Augen an, als ob er dies nicht fassen könnte, dann sank er auf eine ganz besondere, verzweifelte Art, so wie man sich verloren gibt, langsam zurück und legte die Stirn auf den gekrümmten Arm. Ähnlich benahm sich Karl. Mir war sofort klar, dass sie nicht wegen eines gebrochenen Beines verzweifelten, sondern in der Einsicht, dass für sie die ohnehin schlimme Lage unter solchen Umständen hoffnungslos wurde. Wir befanden uns hier auf den obersten felsigen Stufen einer ausgedehnten Schafweide, die mit einer Neigung nach Nordwesten gestaffelt gegen eine Alp abfällt, eine weite, zu dieser Zeit schon verlassene Rinderalp, von der ein zweistündiger schlechter Weg durch den Wald zu den verstreuten ersten Bergheimwesen hinunterführt. Man sah auch hier noch immer keine zehn Schritte weit, der Schneesturm fegte mit unverminderter Wucht über uns hin und drang uns jetzt, da wir nicht mehr gingen, schneidend kalt durch die Kleider; unsere Hände waren vor Kälte geschwollen und unempfindlich geworden. Man muss sich dies alles zugleich vor Augen halten, um die Verzweiflung meiner Kameraden zu verstehen. Auf einer Höhe von zweitausendvierhundert Metern, hoch über allen menschlichen Wohnungen, ohne Pfad, ohne Sicht, wie erblindet und halb erschöpft mit einem Beinbruch im eisigen Schneesturm, drei Stunden vor dem Zunachten – wer da noch Hoffnung hätte, dürfte kein erfahrener Bergsteiger sein.
Ich verzichtete auf jeden unbegründeten Trostversuch und sprach vielmehr ohne lange Überlegung den nächstliegenden Gedanken aus: «Ich laufe so rasch wie nur möglich hinab, trommle da unten ein paar tüchtige Burschen zusammen und führe sie hinauf, mit Bahren oder mit einem Hornschlitten …»
Ich blickte sie an und wartete, was sie dazu sagen würden, aber sie sagten nichts, sie wussten Bescheid. Sie wussten, dass ich bis zu den obersten Häusern hinab mindestens vier Stunden brauchen würde, dass ich eine Rettungskolonne dann nicht im Handumdrehen beisammenhätte und dass die Kolonne mit einem etwa sechsstündigen Aufstieg rechnen müsste, abgesehen von der Frage, ob ich nach so außerordentlichen Anstrengungen überhaupt noch fähig wäre, sie da hinaufzuführen, und abgesehen auch von der hohen Wahrscheinlichkeit, dass eine Rettungskolonne im Morgengrauen zu spät käme. Das Schweigen, mit dem sie meinen Vorschlag aufnahmen, erschütterte mich mehr, als wenn sie noch so furchtbar geklagt hätten.
Indessen kam mir ein anderer Gedanke. «Da unten auf der Alp ist doch ein Stall, nicht?», fragte ich.
«Ja, aber wie willst du den finden!», erwiderte Otto dumpf. «Er steht irgendwo mitten auf der Alp … Aber du würdest ihn nicht finden, auch wenn du wüsstest, wo er wäre … man sieht ja nichts.»
«Aber ich kann ihn suchen, verdammt noch mal! Und dann schleppe ich euch beide hinab.»
«Hinab wären es etwa zwei Stunden und hier hinauf drei … bis dahin …»
«Aber es wäre doch eine Möglichkeit!», warf Karl ein.
«Jawohl!» rief ich. «Und solang es eine Möglichkeit gibt, hat es keinen Sinn, den Kopf hängen zu lassen, Otto. Der Stall wird gesucht. Und einen von euch nehme ich gleich mit … oder versuche es doch wenigstens.»
Das belebte sie nun beide, aber, wie ich rasch merkte, auf eine sehr zwiespältige Art, und im nächsten Augenblick überfiel mich selber die Frage, die ihre aufkeimende Hoffnung erbarmungslos bedrohte: Wie soll einer allein es hier oben auch nur zwei, geschweige denn fünf Stunden aushalten? Wir waren tatsächlich so ermüdet und froren, ja schlotterten am ganzen Körper dermaßen, dass nicht einmal ich mit meinen gesunden Gliedern mir so etwas zugetraut hätte. Davon sagte ich aber nichts, ich klammerte mich vielmehr an meinen Einfall, da mir gar keine andere Wahl blieb.
Von diesem Augenblick an wurde unser bisher so offenes Verhältnis zueinander peinlich gespannt. Wir wussten alle drei, dass der Unglückliche, der dableiben musste, verloren war, wenn kein Wunder geschah, weil es fast unmöglich schien, die Hütte zu finden, und weil der Zurückgebliebene selbst dann, wenn ich sie nach unvermeidlichen, zeitraubenden Irrgängen gefunden hätte, bis zu meiner Rückkehr es nicht aushalten würde. Welcher von beiden aber sollte nun dableiben?
Ich konnte nicht hoffen, dass sich der eine für den andern freiwillig aufopfern würde, dazu waren sie bei aller Kameradschaft denn doch zu wenig eng befreundet; außerdem durfte von so nüchtern denkenden, mitten im Erwerbsleben stehenden Männern ein derart seltener Edelmut auch gar nicht erwartet werden. Die Entscheidung blieb mir überlassen, wie sich bald genug herausstellte, die furchtbarste Entscheidung, die ich jemals zu treffen hatte. Beide waren gefestigte, selbständige Menschen zwischen dreißig und vierzig Jahren, von der äußerlich herben, im Grunde aber recht gemütvollen Art, wie man sie unter der einheimischen Bevölkerung überall trifft. Otto betrieb eine Möbelschreinerei, Karl war Drogist. Sie befanden sich in guten Verhältnissen und besaßen im Dorfe ein beträchtliches Ansehen. Ich selber war der neue, etwas liederliche Fotograf, der lieber Tiere und Berge aufnahm als Brautpaare und Vereinsausflügler. Ohne viel mehr voneinander zu wissen als eben dies, hatten wir uns gelegentlich im Wirtshaus getroffen, unsere gemeinsame Freude an der Bergwelt entdeckt, über Touren geplaudert und dann zusammen diese Wanderung unternommen.
Im Verlaufe der letzten drei Tage nun waren wir einander etwas näher gekommen und hatten Schmollis gemacht, wie sich das in einsamen Berghütten unter Männern, die aufeinander angewiesen sind, ohne Weiteres ergibt. Sie gefielen mir beide, aber erst jetzt, da sie auf der Waagschale lagen und ich das Zünglein spielen sollte, das über Leben und Tod entscheidet, wurde mir bewusst, wie ungenau ich sie kannte und wie schwierig es war, aus mehr als persönlichen Gründen einen dem andern vorzuziehen.
Karl, von mittlerer Größe, mit einem schmalen Gesicht und wachen, rasch blickenden Augen, war vielleicht etwas intelligenter als Otto, dabei sehr bescheiden, wenigstens mir gegenüber, obwohl er offenbar viel gelesen hatte und zum Beispiel von Gebirgsbildungen, Mineralien, Pflanzen mindestens so viel wusste wie ich. Er litt jetzt innerlich wohl noch mehr als Otto und verriet deutlicher, wie unbeständig er zwischen Hoffnung und Verzweiflung schwankte. Er fror auch am ärgsten und lag, auf einen Ellbogen gestützt, die Hände in den Hosensäcken, mit gesenktem Kopf oder leicht erhobenem, gequält forschendem Gesichte zitternd da.
Otto war etwas kleiner und fester, dabei vitaler, warmherziger. Er hatte vor unserem Aufbruch eine vorzügliche Flasche gestiftet, dann im Rucksack viel gute Dinge mitgetragen und uns mit einer Freigebigkeit davon angeboten, die man nirgends mehr zu schätzen weiß als im Gebirge. Zuletzt war er trotz seiner kräftigen Natur nicht ohne große Mühe mitgekommen und nach dem Absturz mit dem gefährlicheren, schmerzlicheren Bruche liegengeblieben. Seine kummervoll brütende Miene stand zu dem sonst so heiteren Ausdruck seines selbstbewussten runden Gesichtes in einem Gegensatz, der mir ans Herz griff.
Kann man entscheiden, welcher von zwei ungefähr gleichartigen Menschen, die man nicht schon in allen möglichen Lagen genau kennengelernt hat, der bessere, wertvollere ist? Im Alltag macht man sich das leicht und tut es je nach dem Standpunkt, den man einnimmt, aber wenn Leben und Tod davon abhängen, kann es nur vom höchsten Standpunkt aus geschehen. Wie rasch sagen wir doch im täglichen Leben, der und jener sei nichts wert! Irgendeiner gefällt uns, weil er eine gewinnende Fratze hat oder uns Honig ums Maul streicht, und für diesen gäben wir drei andere hin. Und wer nimmt sich die Mühe, nach Verdiensten und verborgenen guten Eigenschaften auch nur zu fragen, wenn er einen vor sich hat, der ihm missfällt? Nichts ist schwieriger und nichts wird leichtfertiger gehandhabt als das Urteil über einen Menschen, auch wenn er unser Nächster ist. Wir sind darin grauenhaft ungerecht, bald aus Dummheit oder Hochmut, bald aus lauter Bequemlichkeit. Wohl uns, dass wir unsere leichtfertigen Urteile nur vor unserem eigenen abgestumpften Gewissen und nicht vor einer unerbittlichen höchsten Instanz verantworten müssen!
Ich ging nun mit einer Zuversicht ans Werk, die wohl nicht ganz ehrlich erscheinen mochte. «Vorerst müssen wir hier weg», entschied ich. «Wenn der Schnee da oben noch weiter wächst, kann er auf der trockenen Unterlage am Ende doch abrutschen. Ich wundere mich überhaupt, dass wir nicht mit dem ganzen Schneehang da unten angekommen sind. Vielleicht finde ich auch eine etwas geschütztere Stelle, ich will nachsehen, habt einen Augenblick Geduld!» Ich stieg eilig nach links hinunter und schlug einen weiten Halbkreis, fand aber nichts Geeigneteres als einen kleinen ebenen Absatz, wo man zwar nicht geschützt, aber doch wenigstens bequem liegen konnte. Als ich weitersuchend nach rechts wieder zum Felshang hinaufgestiegen war und ihm entlang der Unfallstelle zuging, fiel es mir in dem rasenden dichten Gestöber schon auf diese kurze Entfernung so schwer, die Kameraden zu finden, dass ich rufen musste.
Beide antworteten und sahen dann, als ich an sie herantrat, qualvoll gespannt zu mir auf. Sie hoben sich nur noch mit dem Kopf und einem Schulterstück vom Schnee ab, so stark waren sie schon zugeschneit. Ich hob ohne lange Erklärungen den Nächsten, Otto, mit beiden Armen auf, und er legte mir, stöhnend vor Schmerz, einen Arm um den Nacken. Mit meiner gequetschten Hüfte und bei meiner Müdigkeit aber kam ich nun so schwerfällig vorwärts, dass ich nicht nur meine unbestimmte heimliche Absicht aufgeben musste, beiden zugleich von hier aus weiterzuhelfen, sondern schon zweifelte, ob ich auch nur einen von ihnen retten könne.
Was nun geschah, während ich beide nacheinander etwa hundert Meter weit hinabtrug, das mag ich nicht nur flüchtig berichten, ich muss die beiden mit ihren eigenen Worten reden lassen – zu meiner Rechtfertigung. Wie sie sich benahmen und was sie sagten, das weiß ich noch so genau, als ob es gestern geschehen wäre, ich habe jedes ihrer Worte auf die Waagschale gelegt.
Otto begann eindringlich zu klagen: «Herrgott, dass das nun so enden muss! Bis dahin ist alles so gut geraten, und jetzt muss uns das passieren … Ich weiß nicht, was meine Frau tun würde, wenn ich nicht mehr zurückkäme. Es ist eine liebe Frau, das kann ich dir schon sagen … schade, dass du sie nicht kennst … hast sie nie gesehen?»
«Vielleicht schon», sagte ich, «aber ich hätte sie ja nicht als deine Frau erkannt.»
«Solltest sie kennenlernen, du!», fuhr er fort. «Hättest überhaupt schon lang einmal zu uns kommen sollen. Ich habe allerlei, was dich interessieren würde, zum Beispiel eine Sammlung von schönen alten Stichen … ich sammle sie aus Liebhaberei, weißt du … Aber was nützt das jetzt, es ist ja alles aus, fertig!»
«Ach was! So rasch gibt man sich nicht auf!», erwiderte ich.
Er schwieg einen Augenblick, dann sagte er lebhaft: «Wenn du das fertigbrächtest, wenigstens einen von uns hinabzuschleppen, das wäre doch allerhand … das hättest du nachher nicht zu bereuen!»
«Zuerst den einen, dann den andern», entgegnete ich.
«Ja ja, schon recht … du weißt genau, wie es steht.» Nach einer kurzen, bedrückenden Pause blickte er mich verzweifelt an und sagte: «Weißt du, es will mir ja nicht in den Kopf, aber einer muss dran glauben.»
Ich widersprach abermals, doch er ging nicht darauf ein und begann, zwischen seinen abgebrochenen Sätzen immer wieder keuchend oder stöhnend vor Schmerz, weiterzuklagen: «Das hab ich mir nicht träumen lassen, dass ich jemals in eine solche verfluchte Lage geraten könnte. Da hat man gearbeitet und immer ein wenig Glück gehabt, man hat ein schönes Geschäft, eine Familie, eine Frau, wie es keine zweite gibt, Kinder, den Peter und mein Anneli, ein Schatz, ist vor drei Wochen zehnjährig geworden … der Peter ist vierzehn und besucht die Handelsschule … Dann lebt noch mein alter Vater bei uns … Und nächstes Jahr wollten wir ein Wohnhaus bauen, wir haben uns alle darauf gefreut …» Er bewegte mit krampfhaft verkniffenen feuchten Augen langsam den Kopf hin und her, dann schien er, düster vor sich hinstarrend, einem Gedanken nachzuhängen. Plötzlich sah er mir wieder ins Gesicht. «Christoph, ich mache dir einen Vorschlag», begann er in einem neuen, entschlossenen, wenn auch immer noch gequälten Ton. «Du bist kein Geschäftsmann, ich weiß es, hast ein schmales Einkommen und wirst nichts Rechtes erspart haben. Aber ohne Geld kommst du auf die Dauer nicht aus. Ich helfe dir, du … und du hilfst mir, bringst mich hinab … ich lege dir auf der Bank ein Guthaben an, fünftausend …»
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.