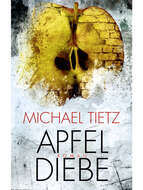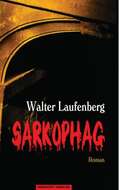Kitabı oku: «Rattentanz», sayfa 3
Er schüttelte den Kopf. »Glaub ich nicht.«
»Vielleicht kommt der Strom ja bald wieder und in den Nachrichten heute Abend wird alles erklärt?« Kiefers Satz klang wie das berühmte Rufen im Wald. »Es könnte doch irgendwie von der Sonne kommen. Sonnenwinde oder so was.«
»Da steckt irgendeine Regierung dahinter«, sagte Faust, ohne Kiefer zu beachten. »Etwas so Umfassendes – das waren die Amis.«
»Oder die Chinesen.«
»Die Russen waren das.«
5
Vierhundert Tage zuvor bei Hamburg
Die beiden besiegelten das Schicksal der Welt. Keiner war sich dessen bewusst, am wenigsten sie selbst.
Und warum? Dummheit, Schicksal, Leichtsinn, eine Laune des Augenblicks? Langeweile verbunden mit zu vielen technischen Möglichkeiten? Oder Zufall, der stille Kollege Ich-lach-mir-ins-Fäustchen, der im Hintergrund seine Fäden zieht und selbst neugierig auf das Ergebnis wartet? Wenn es darum ging, die Welt zu verändern – er war zur Stelle. Nicht die Weltanschauungen von Terroristen, nicht die hehren Ziele der Tagträumer verändern den Planeten, nein, Gevatter Zufall zieht im Hintergrund die Fäden, spannt mal diesen, mal jenen für seine Pläne ein (überlässt denen anschließend auch gern den Ruhm der Geschichtsschreiber) und amüsiert sich dabei aufs Köstlichste.
Axel suchte an diesem Tag im April des Vorjahres seit Stunden im Internet. In vierzig Tagen sollten Prüfungen sein. Geschichte und, was noch viel schlimmer war, Biologie. So gut er Zahlen und Formeln verinnerlichen und nutzen konnte, so wenig waren seinem Hirn Daten und Fakten der Vergangenheit zugänglich. Und noch weniger biologische Abläufe. Konnte jedoch etwas in einer Formel zusammengefasst und in − wenn auch noch so kompliziert anmutenden − Gleichungen dargestellt werden, war er in seinem Element. Schon als kleiner Junge waren Zahlen seine Welt. Tantchen (Tante Elli, um korrekt zu sein) erzählte heute noch bei jeder Gelegenheit, wie er als Vierjähriger alle in Staunen versetzt hatte: sie hatte ihm eine Tüte Gummibären geschenkt und statt diese, wie es Erwachsene von einem normalen Vierjährigen zu Recht erwarten dürfen, im Handumdrehen in sich hineinzustopfen, breitete er die Bären sorgsam vor sich aus. Er sortierte sie nach Farben und rechnete anschließend vor, dass dreimal soviel rote Bären da waren wie gelbe. Und dass er jetzt zwei grüne Bären essen müsse, damit das Verhältnis zu den weißen stimme. Das war zwölf Jahre her. Aber an Axels Vorliebe zu Zahlen hatte sich nichts geändert. Mit sechs bekam er seinen ersten gebrauchten Computer geschenkt, mit acht einen eigenen Internetzugang und mit zehn hatte er sich erstmals in eine fremde Webseite eingeloggt.
Zwei Häuser weiter wohnte Friedrich Berger, der »Alte Fritz«, wie das ganze Dorf den damals schon weit über achtzig Jahre alten Mann nannte. Seit dessen Frau in den Siebzigerjahren mithilfe eines dicken Seiles die Scheidung eingereicht hatte und ihn mit Haus, Hof und einer herrlichen Streuobstwiese alleingelassen hatte, war er immer mürrischer geworden. Für die Kinder des Dorfes, für die er selten mehr als einen Kieselstein oder Schneeball übrig hatte, waren der alte Fritz und vor allem seine Obstwiese magische Anziehungspunkte. Wenn im Spätsommer die ersten Birnen reif waren und die Säure kleiner Äpfel jede Pore im Mund zusammenzog, entwickelte sich der Obstklau im Garten des Alten zu einem wahren Wettbewerb. Wer würde das meiste Obst mitbringen? Wen würde er erwischen und, vor allem: was würde er mit denen, die er überführt hatte, anstellen? Das Leben war ein endloses Abenteuer.
Einmal hatte Berger einen Sechsjährigen, der glücklich zwei wurmstichige Äpfel in seinen Taschen versteckt hatte, zur Strafe in einen Apfelbaum gesetzt. Und sitzen lassen. Nach drei Stunden hatte ihn seine Mutter endlich erlöst.
Axel selbst war nie ertappt worden. Vielleicht das Glück des Tüchtigen, denn Axel war einer der fleißigsten Obstlieferanten für die Kinder des Dorfes. Das wusste auch Fritz. Und einmal musste er in einen Haufen wunderschöner Äpfel, die verdächtig sauber aufgeschichtet am Fuße eines Baumes lagen, etwas eingespritzt haben. Jedenfalls lagen am selben Abend alle Kinder, die von Axels Beute gekostet hatten, mit Bauchkrämpfen im Bett. Abwechselnd hatten sie sich über die Toiletten gebeugt oder auf die Schüsseln gesetzt und sich dabei über die Unmengen Flüssigkeit gewundert, die in ihren Körpern gespeichert war und diese nun geräuschvoll verließen. Als es Axel nach drei Tagen wie der etwas besser ging, versuchte er sich in die Homepage des Versand unternehmens, dessen Lieferwagen in regelmäßigen Abständen vor dem Haus des alten Fritz hielt, einzuloggen. Nach vier Stunden war er drin, eine weitere Stunde und er hatte die Daten seines Nachbarn und nach weiteren drei Tagen durfte sich Herr Friedrich Berger stolzer Besitzer einer nicht ganz billigen Einbauküche nennen. Nur, dass er nicht stolz war. Und in seinem niedrigen Haus ohne groß angelegten Um bau auch wirklich kein Platz für ein solches Monster war. Kein Platz für Mikrowelle, kein Platz für Gefriertruhe und Riesenkühlschrank, kein Platz für die frei im Raum aufzubauende Kochinsel.
Die Aufgabe, die Axel nun vor genau vierhundert Tagen Kopfzerbrechen bereitet hatte, erwies sich da schon deutlich schwieriger als die kleine Bestellung mit Nachbars Daten. Axel versuchte seit Stunden, sich in einen Computer seines Gymnasiums einzuhacken. Bisher ohne jeden Erfolg. Sein Plan war einfach, genial einfach, wie er selbst glaubte: Ein aus drei winzigen Komponenten bestehender Virus sollte sich im Computersystem des Gymnasiums breitmachen und, wenn nicht alles, was es so an Wahrscheinlichkeitsrechnungen gab, Makulatur war, müsste in den verbleibenden vierzig Tagen der Virus auch den Rechner mit den Prüfungsunterlagen erreicht haben. Nur drei winzige Dateien, besser: Dateifragmente, denn für sich genommen war jeder Baustein sinnlos, ja nicht einmal als Virus(komponente) zu entdecken. Alle drei Bausteine aber gemeinsam auf einer Festplatte würden bald fröhlich zueinanderfinden, Hochzeit halten, sich lustvoll vereinen und anschließend mit ihrer Arbeit beginnen: Uhrenabgleich, Einstellen des Zeitzünders und, nach geruhsamen vierzig Tagen, Löschung aller vorhandenen Dateien sowie des Betriebssystems. Nur sich selbst würden sie verschonen, was eine Neuinstallation ziemlich unmöglich machen dürfte, da jedweder Versuch, den Computer wieder dienstbar zu machen, sofort von der kleinen Virengemeinschaft sabotiert werden würde!
Axel lächelte bei dieser Vorstellung.
Zwei Stunden später, er grübelte noch immer über dem Problem des Uhrenabgleichs, kam endlich Lars, sein Schulfreund. Gemeinsam saßen die beiden seit Jahren ihre Stunden im Hamburger Geschwister-Scholl-Gymnasium ab.
»Auf keinen Fall darf irgendjemand die Fragmente finden …«
»… und sie müssen sich in alles hineinkopieren, was mit dem infizierten Rechner in Kontakt steht«, ergänzte Axel. »Mails, Datentransfers auf CD, DVD, MP3 – und immer sind unsere kleinen Freunde dabei.«
»Und SMS!«
»SMS? Wie soll das funktionieren? Arbeiten Handys nicht mit ganz anderen Systemen und Prozessoren als normale Computer?«
»Das schon. Aber unsere Bausteinchen kommen damit schon zurecht. Wirst schon sehen.« Lars lächelte, lächelte wie jemand, der mehr weiß. »Bei den SMS jedenfalls funktioniert es wie bei den anderen Systemen auch. Bei jeder SMS oder MMS werden Daten übertragen, an die sich unsere Bausteine dranhängen können. Und sobald alle drei Teile auf dem Handy oder Computer sind, dürften die Dinger bald hinüber sein.«
»Und mit ihnen dieser ganze Prüfungsscheiß!«, freuten sie sich. Sie versandten in den folgenden zwei Stunden ihre drei Bausteine in drei verschiedenen Mails an Adressen ihres Gymnasiums.
Der Hausmeister, wenn er nicht gerade vor einem kleinen Loch in der Wand zum Mädchenumkleideraum onanierte, verbrachte die meis te Zeit an seinem Netzwerk-PC auf der Suche nach neuen Pornowebs. Ungeahndet versteht sich, schließlich betreute er das Netzwerk der Schule. In die Betreffzeile schrieben sie Kostenlose XXX-Bilder auf Ihren PC und waren sich sicher, dass Hausmeister Seidel ihre Mail öffnen würde.
Das zweite Steinchen bekam das Schulsekretariat. Frau Senkwitz, altjüngferlich bewachte sie ihren Direktor seit fast einem Jahrzehnt, erhielt an diesem Nachmittag eine Mail mit dem Betreff Persönlich! Nur von Direktor Grünninger zu lesen! Axel und Lars wussten, dass die Senkwitz diesem Verbot nicht würde widerstehen können. Sie würde ohne Zögern das Schreiben öffnen, sich über den Text (War schön gestern Abend!) wundern und dabei nicht bemerken, wie ein Winzling unbemerkt auf die Festplatte des Sekretariatscomputers klettert und sich häuslich einrichtet.
Frau Senkwitz bemerkte nichts, Hausmeister Seidel war durch das Abbild einer netten Blondine abgelenkt, welches Axel und Lars ihrer Mail angehängt hatten und − welch Sieg! – ihren Informatiklehrer, der den dritten Baustein erhielt, überlisteten sie mit einem angeblichen Virenschutz-Update, hinter dem sich Teilchen Nummer drei verbarg.
»Wenn alles klappt«, Axel ließ einen Streifen Kaugummi im Mund verschwinden »gibt es in genau vierzig Tagen keine einzige funktionstüchtige Festplatte mehr im Gymnasium.«
»Voll fett!«, lobte Lars.
Vierzig Tage später schwitzten beide über ihren Prüfungen. Alle Computer des Gymnasiums funktionierten einwandfrei. Die kleine Verstimmung zwischen Direktor Grünninger und seiner Sekretärin nach dem Mail hatte sich wieder gelegt. Hausmeister Seidel durchsuchte täglich sein Postfach nach weiteren kostenlosen XXX-Bildern und der Informatiklehrer hatte das Schreiben mit dem angeblichen Virenschutz-Update längst vergessen.
»Weißt du, was wir falsch gemacht haben?« Axel zuckte missgelaunt mit den Achseln und kaute an seinem Stift. Die drei Bausteine waren ein Klacks gewesen, diese Prüfung aber war die totale Katastrophe.
Es war nur ein kleiner Schreibfehler. Nein, nicht mal das war es; es war ein Nichts, eine Null. Als sie den Zeitzünder auf vierzig Tage programmierten, hatte sich ein kleines Nichts dazugesellt und wohlerzogen hinten angestellt. Vierhundert Tage.
Ihre Mails hatten die Bausteine im Gymnasium abgeliefert und die drei Teilchen hatten sich wie befohlen eingenistet, vermehrt und ihre munteren Nachkommen an alles angehängt, was das Haus verließ. Frau Senkwitz verschickte bis zum Prüfungstag insgesamt 187 Mails an 59 verschiedene Adressaten und sie beschrieb sechzehn Daten-CDs für sich, den Direktor und drei der angestellten Lehrkörper. Sie erledigte wie gewohnt vom Sekretariat aus nicht nur die Bankgeschäfte des Gymnasiums, sondern, wenn man schon mal dabei war, auch gleich ihre eigenen bei der Konkurrenzbank. Ganz gerecht verschenkte sie somit an beide Unternehmen einen kleinen Untermieter, der allein am Folgetag 417 neue Abnehmer fand. Hausmeister Seidel hatte zwar nur vier Mails im selben Zeitraum verschickt, hinterließ die Bausteine aber in allen möglichen zweideutigen Chaträumen und im Adultbereich eindeutiger Websites, von wo aus sie reißenden Absatz fanden.
Ihr Informatiklehrer arbeitete an einer Doktorarbeit zum Thema »Verlässlichkeit offener Computersysteme« und kommunizierte aus diesem Grund mit Fachleuten in ganz Deutschland, der Schweiz und Hongkong (wo der Virus sich bald in einem automatischen Mailverteiler wiederfand, der wöchentlich Interessierte in vierundzwanzig Ländern über den neuesten Stand der Virenabwehr informierte). Außerdem glich er regelmäßig seine Daten zwischen PC und Handy ab. In der Folge klammerte sich an jede seiner Telefonnachrichten ein kleiner Winzling und wartete anschließend geduldig in der Abgeschiedenheit der fremden Festplatte auf das Eintreffen von Komponente zwei und drei.
Hätte alles nach den Plänen von Axel und Lars funktioniert und wäre der Virus am vierzigsten Tag aktiv geworden, hätte es im Gymnasium und den insgesamt fünfundachtzig Rechnern weltweit, auf denen inzwischen alle drei Komponenten eingetroffen waren, leere Festplatten gegeben. Einen Tag darauf hätte es weltweit VirenschutzUpdates gehagelt und nach einer Woche wäre ihr Dreiteiler einer von vielen in den Annalen der Virenabwehr geworden. Aber so warteten noch dreihundertsechzig Tage. Dreihundertsechzig leise Tage.
Die wenigen User, die in den Folgemonaten den einen oder anderen Baustein auf ihrem Rechner entdeckten, konnten damit nichts anfangen und keine Gefahr erkennen. Ein sinnloses Dateifragment nur, ein Schnipsel – Abfall.
Gemessen an den Maßstäben der Natur in puncto »Erfolgreiches Virus» war den beiden ein fast göttliches Projekt geglückt. Ihr Geschöpf breitete sich aus und nistete sich in jeden nur anbietenden Wirt ein. Dieser wiederum diente anschließend als Multiplikator. Ihr Virus arrangierte sich mit den diversen Systemen und Prozessoren, als sei dies die leichteste Aufgabe der Welt. Er passte sich den Gegebenheiten an, mutierte und eroberte die Welt der Bits und Bytes. Er erregte keinerlei Aufsehen, schlich sich ein, glich bei Ankunft seine innere Uhr mit der jeweiligen Rechnerzeit ab und stellte die Bombe, sobald die beiden fehlenden Freunde eintrafen, scharf. Lars kam die Idee mit der absoluten Zeit. »Jeder PC tickt etwas anders«, so sein Argument. b»Damit der ganze Laden vor den Prüfungen wirklich zum Stehen kommt, muss der Virus die Rechnerzeit mit seiner inneren Uhr vergleichen und danach den Countdown bis zum großen Knall berechnen. Somit gehen alle Computer am Prüfungsmorgen um sieben aus, egal welche Uhrzeit die auf ihren Rechnern eingestellt haben.«
»Voll fett!«
28. November des Vorjahres
Die Virenkomponenten hatten einen fruchtbaren Mutterleib vorgefunden. Die Vernetzungen einer modernen Kommunikationsgesellschaft bildeten den ertragversprechenden Boden. Die drei Bauteile schwirrten einsam über die Datenautobahnen und bezogen jede nur erreichbare Festplatte. Welchem Zweck diese diente, war dabei völlig nebensächlich und so dauerte es nicht lange und in den meisten Computern, Handys, DVD-Rekordern und MP3-Playern auf jedem Kontinent war mindestens eines der drei Teile zu finden. Einmal angekommen, reproduzierten sie sich in jeden neu erstellten Datenträger, in jede versandte Nachricht. Und sie erwarteten das Eintreffen ihrer Geschwister, um mit diesen zu verschmelzen. Und die Wartezeiten auf einer neu erreichten Festplatte wurden für den Erstling immer kürzer. Sie waren dank ihrer Unvollkommenheit von keinem Virenscanner entdeckt worden, hatten sich in fast allen Privathaushalten eingenistet und schickten ihre Brut weiter hinaus in die Welt.
Am 28. November des vergangenen Jahres gelang es dem ersten Baustein, auf der verbotenerweise mitgebrachten privaten CD von Paul-Werner Hagendorn, einem mittleren Bundesbeamten, die Tore des Bundesinnenministeriums zu passieren. Er hatte vor wenigen Wochen geheiratet. Komponente zwei und drei warteten damals bereits geraume Zeit auf seinem Computer. Von seiner Karibikkreuzfahrt, das Hochzeitsgeschenk ihrer Eltern, hatten sie neben einem ordentlichen Sonnenbrand, der Erfahrung des ersten Ehekrachs und einigen unbedeutenden Souvenirs auch den fehlenden Baustein Numero eins mitgebracht. Der Service der Kreuzfahrtgesellschaft, ihren Kunden an Bord das Überspielen von digitalen Fotos auf eine DVD zu ermöglichen, hatte dieser Anfang August einen Virus eingebracht. Den verteilten sie fortan an Besucher aus der ganzen Welt, auch an Paul-Werner Hagendorn.
Während die Kolleginnen und Kollegen nun über den gelungenen Hochzeitsbildern die Köpfe zusammensteckten, enterten die drei Teile den ersten Regierungscomputer. Ein reger Postverkehr via E-Mail und deutsche Gründlichkeit, die Kopien eines Vorganges an eine Unzahl angeblich Beteiligter verlangte, verhalfen den Komponenten zu einer raschen Verbreitung in allen Ministerien. Und von da aus ging es weiter zu befreundeten und auch weniger befreundeten Regierungsfestplatten in der ganzen Welt und natürlich nach Brüssel.
05. Mai
Die Ansteckungsgefahr der für die Versorgung der Bevölkerung als absolut lebenswichtig definierten Einrichtung war − einer UN-Studie zufolge, die viel Zeit und noch mehr Geld verschlungen hatte − als gering bis nicht existent zu erachten. Diese Studie, die sich wohlgemerkt auf Computerviren und nicht auf grippale Infekte bei der jeweiligen Belegschaft bezog, wurde von einem neunköpfigen Gremium in jeweils mehrwöchigen Aufenthalten in Sao Paulo, Islamabad und Sydney erarbeitet. Bis auf die australische Metropole entsprachen diese Orte den Herkunftsländern der drei gleichberechtigten Direktoren des Gremiums. Sydney wurde gewählt, weil der Vertreter Vanuatus in seinem Heimatland kein der Bedeutung des Projektes entsprechendes Tagungszentrum fand. Die Teilnehmer gehörten folgenden Berufen an: Politologen/Diplomaten: 5, Mediziner: 2, Metallbauingenieur: 1, Betriebswirtschaftler: 1.
Das in sieben Sprachen abgefasste und jeweils circa zweihundertvierzigseitige Hauptdokument wurde von einer die Fußnoten erklärenden Begleitbroschüre ergänzt, welche ungefähr dreihundert Seiten umfasste. Titel der Broschüre wurde nach zähen Verhandlungen: »Über Gefahren und Gefährdungen einer Destabilisierung der öffentlichen, der privaten und der staatlichen Ordnung, Sicherheit und Handlungsfähigkeit, hervorgerufen mittels mutwillig, fahrlässig oder grob fahrlässig direkt oder indirekt (d. h. über Dritte, welche als Überbringer, nicht aber als Verursacher zu betrachten, zu behandeln und eventuell zu verurteilen sind) herbeigeführter Störungen der oben angeführten Bereiche und den hieraus resultierenden Folgen für das persönliche und das allgemeine Wohl und den Zustand der bestehenden Ordnung«. Die Quintessenz der Studie war die Feststellung, dass die heute existenten Sicherheitsvorkehrungen, nach Ansicht dieser Fachgruppe, einen absichtlichen oder versehentlichen weltweiten Virenbefall aller computergesteuerten Systeme ausschließen würden.
Die Studie wurde am 5. Mai ohne große Beachtung der Weltöffentlichkeit in New York vorgestellt.
Zur selben Zeit erreichten die drei Bauteile des vor über dreihundert Tagen geschaffenen Virus’ das letzte Kraftwerk in Deutschland. Ein Servicetechniker, welcher in der vergangenen Woche das Computersystem im Kraftwerk Schwedt auf den aktuellen Stand gebracht und sich dabei den kompletten Virus eingefangen hatte, installierte zusammen mit dem aktuellen Betriebssystem auch die drei Komponenten in Frankfurt an der Oder.
6
23. Mai, 07:15 Uhr, Krankenhaus Donaueschingen, Aufzug 2
Der Aufzug war vor einer Viertelstunde zwischen Keller und Erdgeschoss des dreistöckigen Gebäudes mit einem abschließenden Zittern stehen geblieben. Zeitgleich flackerten die grellen Deckenlichter, dann gingen sie aus. Ebenso das rote Schimmern der Anzeige, die soeben im Begriff gewesen war von minus eins auf null umzuspringen. Noch ein letztes halbherziges Ruckeln des Stahlkastens, dann war Ruhe.
Thomas Bachmann stand jetzt seit fünfzehn Minuten reglos in der Mitte des vielleicht drei Quadratmeter messenden Aufzuges. Thomas war mittelgroß, dünn, hatte hängende Schultern, struppiges, schwarzes Haar und dichte Brauen. Er hatte das rasch schwächer werdende letzte Zittern um sich herum genau registriert und im selben Maß, in dem der Aufzug langsam auspendelte, wuchs der Kloß in seinem Hals und nahm das Geräusch von viel zu schnell und viel zu heftig pulsierendem Blut in seinen Ohren zu. Thomas Bachmann schob die wuls tige und weit vorstehende Unterlippe noch weiter nach vorn. Nervös knabberte er an den spröden Hautfetzchen rechts und links der kurzen Fingernägel.
Hab ich’s dir nicht gesagt? Nimm nicht den Aufzug, sagte ich, aber nein, der junge Mann weiß ja Bescheid und ist völlig normal und so wie jeder Normale muss er natürlich in diesen Stahlsarg steigen. Und jetzt? He, was ist jetzt?
»Sei still«, flüsterte Thomas. Das war Nummer zwei, die gesprochen hatte. Nummer zwei, weiblich, die immer (hinterher) alles ganz genau und natürlich besser wusste. Nummer zwei, die Stimme der Frau in seinem Kopf.
Der kleine Personenaufzug war knapp drei Meter hoch und vom braunen Boden bis zur Decke mit Aluminiumplatten ausgekleidet, ebenso die zweigeteilte Schiebetür. Wenn das Licht funktionierte, glänzte das Aluminium. Aber jetzt war es finster. Ein kinderarmdickes Stahlrohr klammerte sich an drei Seiten der Kabine in Hüfthöhe an die Wand. Wenn sich größere Menschen, vielleicht ab eins neunzig, an die Wand lehnten, gab ihnen das quer hinter ihrem Gesäß verlaufende Stahlrohr das Gefühl, Tester einer noch nicht ganz ausgereiften mittelalterlichen Donnerbalkenkonstruktion zu sein. In die Decke waren zwei quadratische Milchglasscheiben eingelassen. Sie verström ten im Normalfall grelles Kunstlicht, jetzt waren sie blind, wie auch die Etagenanzeige des Fahrstuhls, unter der die fünf kleinen Tastenquadrate der einzelnen Etagen vom Keller bis zum dritten Stock angebracht waren. Daneben hing ein Notruftelefon.
Thomas stand stocksteif in der Kabinenmitte und klammerte sich mit beiden Händen an seine glänzende schwarze Aktentasche. Er versuchte sich zu konzentrieren, auf sich, seine drei Stimmen, auf Geräusche, die vielleicht zu ihm vordrangen, auf Licht – er wusste nicht genau auf was. Aber er konzentrierte sich und das mit aller Macht. Denn sein Arzt hatte ihm bei einer ihrer letzten Sitzungen ganz klar gesagt, dass er die Kontrolle um jeden Preis behalten müsse, dass er, Thomas, in keiner Situation die Ruhe verlieren dürfe. Denn auf diesen Moment würden Nummer eins, Nummer zwei und vor allem Nummer drei nur warten, vierundzwanzig Stunden am Tag. Was die drei Stimmen in seinem Kopf aber machen würden, sollte er doch einmal die Kontrolle verlieren – auf diese Frage wusste auch sein Arzt keine Antwort, nur, dass es schlimm werden würde, die Stimmen in pausenlose Streitereien verfallen würden und er, Thomas, dann wahrscheinlich nicht mehr ambulant behandelt werden könnte, sondern wieder in eine Anstalt müsse. Und davor hatte Thomas Angst, vor der Anstalt, der Psychiatrie!
Keine Kontrolle zu besitzen war in seinen Augen nicht weiter schlimm. Man konnte sich sorglos dahintreiben lassen, was er oft genug auch ausführlich tat, und abwarten, was das Leben als Nächstes bereithielt. Und manchmal gaben ihm seine Stimmen einen Ratschlag, manchmal sogar einen brauchbaren.
Aber vor der Psychiatrie hatte er Angst.
Vor zwei Jahren, kurz nach seinem sechsundzwanzigsten Geburtstag, war er ins PZB eingewiesen worden. Gegen seinen Willen!
Das PZB, Psychiatrisches Zentrum Bodensee, wurde sein persönlicher Albtraum. Nicht etwa wegen der Medikamente, mit deren Hilfe sie die Stimmen in seinem Kopf für einige Tage fast mundtot machen konnten (welch Leere!), auch die gepolsterten Manschetten an Hand- und Fußgelenken und der dicke, mit magnetischen Schlössern gesicherte Bauchgurt waren ihm im Nachhinein egal. Was ihm aber zu schaffen machte, war das Gefühl der Ohnmacht. Mit der Einweisung und einer anschließenden recht undifferenzierten Diagnosestellung hatten sie ihn all seiner Macht beraubt, der Macht über das eigene Leben und das eigene Handeln. Er war ohne Macht. Der einzig gangbare Weg aus der Psychiatrie führte ihn damals durch einen viermonatigen Wust an Gesprächskreisen, in denen jeder Patient vor seinen Therapeuten und den unglücklichen Mitpatienten hemmungslos sein Innerstes nach außen kehren musste. Unterbrochen wurden die Sitzungen von Einzelgesprächen, therapeutischen, gemeinschaftlichen Spaziergängen am Bodenseeufer und der gelegentlichen Ankunft eines neuen Opfers, auf das sich die Pfleger, dankbar für die willkommene körperliche Betätigung, mit Enthusiasmus stürzten und fürs Erste an ein Bett fixierten.
Überhaupt war dies das Schlimmste – fixiert zu werden. Es war diese körperliche Gewalt und die damit einhergehende Ohnmacht, welche der psychischen Gewalt das i-Tüpfelchen aufsetzte.
Aber als sie die Medikamente reduzierten, sein Kopf klarer wurde und die Stimmen zaghaft zurückkehrten, hatte er diese eisern geleugnet. Nur seinem Arzt, Dr. Meier, der ihn ambulant hier im Allgemeinkrankenhaus in Donaueschingen weiterbehandelte, vertraute er sich manchmal an. Ihm erzählte er ein wenig von Nummer eins, der Stimme eines alten Mannes, die weise und überlegen alles begreift und über allem steht. Er war selten zu hören und wenn, dann meist nur, um Nummer zwei oder drei in die Schranken zu weisen, wenn diese wieder einmal völlig den Verstand verloren hatten. Nummer zwei war eine Frauenstimme. Sie überlegte sich zu jedem Schritt, den Thomas unternahm, mindestens drei Alternativen. Bei ihr konnte er, während ihr Geschwätz den letzten Rest Klarheit aus seinen Gedanken spülte, immer nur verlieren. Garantiert hielt sie ihm hinterher vor, dass es ja noch Alternativen gegeben hätte und SIE ihm diese vorgeschlagen hatte und er mit den anderen Möglichkeiten auf jeden Fall besser gefahren wäre.
Nummer drei war sein Albtraum. Nummer drei war verrückt! Er hatte eine schrille, blecherne Stimme und kicherte unentwegt. Nummer drei war auch an seiner Einweisung in die Psychiatrie schuld. Sie, Thomas und seine drei imaginären Begleiter, waren an diesem Tag vor zwei Jahren in Konstanz gewesen und warteten auf den Zug zurück nach Donaueschingen, wo Thomas seit seiner Geburt lebte. Nummer drei hatte schon die ganze Zeit gelacht und auf ihn eingeredet, wie unsagbar schlecht doch diese Welt sei und dass es für Menschen wie ihn keinen Platz gäbe. Die einzig ehrenvolle Möglichkeit, dem Ganzen ein Ende zu bereiten, sei, sich vor den nächstbesten Zug zu werfen.
Diese Bemerkung hatte die anderen auf den Plan gerufen. Nummer zwei hatte prinzipiell zugestimmt, dabei aber an durchaus brauchbare Alternativen erinnert: man könne zum Beispiel Gift nehmen oder nach Paris reisen und sich vom Eiffelturm stürzen oder eine Guillotine bauen und sich selbst im Sinne der immerwährenden Weltrevolution richten. Man könne aber auch mit einem Fremden hier auf dem Bahnsteig einen Streit vom Zaun brechen und sich von ihm vor den Zug werfen lassen. Schließlich meldete sich Nummer eins (sein Kopfschütteln konnte Thomas in diesem Moment auf dem Bahnsteig fast körperlich spüren) und verlangte, die Entscheidung zum Thema Selbstmord wenigstens so lange zu verschieben, bis man, zu viert sozusagen, noch einmal in aller Ruhe jedes Für und Wider hierzu ausdiskutiert habe und (ganz wichtig!) die Meinung Betroffener eingeholt wäre.
In diesem Augenblick fuhr der Zug ein. Die Stimmen in seinem Kopf brachen sich Bahn und schrien und tobten: Los, hihi, los, spring! Hihi, wir haben es gleich geschafft!
Also ich würde den Eiffelturm vorziehen. Ich wollte schon lange einmal Paris sehen! Oh, Paris …
Nummer eins räusperte sich immer wieder, wurde aber von den anderen beiden ignoriert und übertönt.
In diesem Moment war Thomas auf dem Bahnsteig zusammengebrochen und während der Zug mit kreischenden Bremsen zum Stehen kam, kniete er inmitten verständnislos blickender Menschen auf dem Bahnsteig. Sie strömten an ihm vorbei und Thomas hielt sich die Ohren zu und schrie. Er schrie so laut er nur konnte, um dem Lärm in seinem Kopf Herr zu werden, um die, die ihm seit Jahren so vertraut waren, zu übertönen. Dann kamen zwei Polizisten und trugen Thomas, weiter schreiend, weg. Jetzt, im Aufzug, verhielten sich die drei auffallend still.
»Und? Keine Kommentare, keine Ratschläge oder Meinungen?«, fragte Thomas leise.
Ich sagte schon, dass die Treppe sicherer gewesen wäre. Sonst nichts.
Auf Thomas’ Stirn bildeten sich erste Schweißperlen. Er verharrte weiter in der Kabinenmitte, als könne eine einzige unbedachte Bewegung seinerseits die Kabine zum Absturz bringen. Aber selbst wenn dieser ziemlich abwegige Fall eintreten sollte, konnte er nicht allzu tief stürzen, er befand sich bereits fast am tiefsten Punkt des schmalen Aufzugschachtes.
Schließlich wagte er eine erste Bewegung. Er streckte die Hand aus. Er wusste, dass er mit dem Gesicht Richtung Tür stand. So stellte er sich in jeden Aufzug, vielleicht um sehen zu können, wer beim nächs ten Halt ein- oder ausstieg oder weil man einen Eingang, noch dazu den einzigen, einfach im Auge behalten muss! Jede andere Stellung hätte etwas Verschämtes, eine Bestrafung wie in der Schulzeit, wo Thomas manche Unterrichtsstunde in der Ecke, mit dem Gesicht zur Wand und allein mit sich und seinen verirrten Gedanken, zubringen musste.
Er versuchte einen kleinen Schritt nach vorn, aber Nummer zwei hielt ihn zurück.
Das würde ich nicht tun!
Thomas hielt abrupt in der gerade begonnenen Bewegung inne –
ein Hund, der vom Hof rennen will, aber von einer klirrenden Kette mitten in der Bewegung zurückgerissen wird.
Oder bist du dir sicher, dass der Boden vor dir noch da ist? Was ist, wenn wir irgendwo im Nichts auf einer schmalen Säule stehen? He, wo hin führt uns dann dein tapferer Schritt nach vorn? Thomas wollte sich gerade ihre Worte durch den Kopf gehen lassen, als Nummer eins seine Zweifel zerstreute:
Wir sind in einem Aufzug gefangen. Und ein Aufzug hat bekanntlich vier Wände, eine Decke und einen Boden. Also los, hör nicht auf das Geschwätz.
Nummer zwei räusperte sich. Das war die ganze pikierte Antwort. Jedes weitere Wort verkniff sie sich.
Thomas erschien das Argument mit der eventuellen Säule abwegig. Aber wenn sie nun doch recht hat? Hätte er vor ein paar Minuten auf sie gehört, wäre er jetzt im Treppenhaus. Und in Sicherheit. Er rieb seine Handflächen aneinander und atmete meditativ mehrmals mit geschlossenen Augen tief durch, um seine aufsteigende Angst zu bekämpfen. Er spürte sie deutlich, seine Angst. Sie wohnte irgendwo in der Nähe seines Magens, wo sie normalerweise nicht weiter auffiel oder störte. Aber in Situationen wie dieser (und ein stecken gebliebener Aufzug war nun wirklich wie geschaffen, Angst zu verbreiten, selbst wenn das Licht noch funktionierte − was in diesem Augenblick bekanntlich nicht der Fall war) streckte sich das kleine Pflänzchen Angst. Es öffnete die tausend Augen und, einmal wach geküsst, gab es dann kaum noch ein Halten.