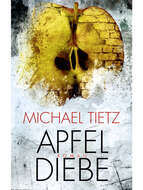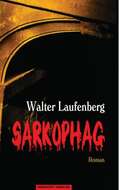Kitabı oku: «Rattentanz», sayfa 4
Aber Thomas hatte gelernt, gegen seine Ängste zu kämpfen! In ihm wohnten viele Ängste und er kannte sie alle. Die Angst vorm Alleinsein, Angst vor der Dunkelheit, Angst, ausgelacht zu werden, Angst vor der Psychiatrie, den Pflegern dort und dem Fixiertwerden. Des Weiteren war da noch die Angst vor Frauen (die einzige Frau, mit der er einigermaßen auskam, war Nummer zwei), die Angst vor Neu em und Höhenangst.
Er kramte in seinen Taschen, umständlich und darauf bedacht, die Stellung in der Kabinenmitte zu halten. Die Angst rekelte sich in seinen Därmen und er spürte ihre Bereitschaft, plötzlich in nackte Panik umzuschlagen. Thomas war allein, es war dunkel und er war eingesperrt – drei Ängste, die ihre Zähne fletschten und nur darauf warteten, ihn zu zerreißen.
Obwohl Thomas wusste, wo in seiner Hose der kleine Ball war, den er jetzt brauchte, tastete er sich zuerst doch langsam durch all seine anderen Taschen. Mit kindlicher Freude spürte er die vertrauten Gegenstände, die ihm wichtig waren. Und sie zu berühren beruhigte ihn. All diese Dinge waren ihm wichtig, so wichtig, dass er sie immer bei sich trug und für niemanden und nichts bereit gewesen wäre, auch nur einen Gegenstand herzugeben.
In seiner Gesäßtasche, dort, wo jeder andere Mann seinen Geldbeutel aufbewahrt, steckten drei Bilder. Das erste, ein aus einer Tageszeitung herausgerissenes Foto, zeigte schwarz-weiß auf dünnem Papier ein altes, von Efeu überwachsenes Haus mit weißem Gartenzaun, an dem Rosen rankten. Das Bild war an einem warmen Tag aufgenommen, denn die einfachen Holzfenster standen weit offen und auf einer ausgetretenen Steinstufe lag faul eine fette Katze. Nummer eins bestand auf diesem Bild. Es sei seine Heimat.
Nummer zwei war in eine Ansichtskarte von Paris vernarrt. Damit diese in die Tasche passte, hatte er sie falten müssen und von dem so entstandenen Falz blätterte Farbe ab. Aber noch immer konnte man den Eiffelturm als Großaufnahme und, auf kleineren und etwas schräg eingefügten Bildchen, die Seine, das Moulin Rouge, Sacré-Cœur und den Arc de Triomphe bewundern. In schwungvollen Lettern leuchtete der Name der Stadt: Paris.
Nummer drei wollte hässliche Bilder. Saddam Hussein am Galgen oder einen überfahrenen Igel, dessen Därme neben ihm lagen. Aber Thomas war nicht bereit, dem nachzugeben. Da sie sich nicht auf eine weniger anstößige Abbildung einigen konnten, suchte Thomas aus einem Abfallbehälter in einem Drogeriemarkt ein Foto heraus. Ein enttäuschter Kunde hatte mehrere seiner fehlbelichteten Urlaubsfotos weggeworfen. Das Bild, das Thomas für Nummer drei einsteckte, war ein unscharfes Kinderporträt. Undeutlich und verschwommen waren blonde Haare vor einem blauenHimmel zu erkennen, der Rest, die Details und das Leben in dem Bild, verschwamm mit den Farben zu einem undeutlichen Traum. Er fand, das Motiv passte zu Nummer drei!
In der vorderen rechten Hosentasche bewahrte Thomas Bachmann ein altesFünfmarkstück auf. Man weiß schließlich nie was kommt. Oder geht. Und an das ungültige Geldstückschmiegte sich ein kleines Stempelkissen sowie ein Stempel, wie er in jedem gut sortierten Büro zu finden ist, so einer, bei dem sich das Datum nach Tag, Monat und Jahr verstellen lässt und außerdem noch so wichtige Bemerkungen aufgestempelt werden können wie ERLEDIGT, GEMAHNT, TERMIN oder FAKTURIERT. Vorn links trug er zwei heilige Knöpfe in seiner Hose. Heilig, weil sie von den jeweiligen Hemden stammten, in denen man seinen Großvater und seine Großmutter vor Jahren beerdigte. Als sein Großvater starb, war er sechs, bei seiner Großmutter elf Jahre alt und beide Male lagen die leblosen Körper noch zwei Tage in ihrer Wohnung aufgebahrt. Wer wollte, konnte Abschied nehmen und noch eine letzte Stunde mit ihnen verbringen. Er hatte es zwar immer nur fünf Minuten allein in dem muffigen Zimmer ausgehalten, dafür aber auch als Einziger ein Andenken an ihr letztes Hemd. Thomas spielte mit den Knöpfen, bevor er endlich den kleinen hellgrünen Gummiball hervorholte. Er war nicht richtig grün. Es war ein Ball von der Sorte, die, wenn man sie einfach nur fallen lässt, fast wieder bis zur selben Höhe zurückspringen und aus diesem undefinierbaren durchsichtigen Zeug bestehen, in dem, neben winzigen Luftbläschen, verschiede ne Farbstreifen eingeschlossen sind. Seiner hatte fast nur grüne Streifen. Deshalb war es sein grüner Ball.
Thomas hielt den Ball in der ausgestreckten Rechten und, obwohl dies die Dunkelheit, in der er feststeckte, in keiner Weise veränderte, schloss er die Augen. Er zählte leise bis drei, dann öffnete er die Hand und ließ den Ball fallen.
Anders als von Nummer zwei beschworen, folgte unmittelbar ein dumpfes Plopp. Der Ball sprang zurück, dann wieder ein Plopp. Und noch eines und noch eines. Plopp. In immer kürzeren Abständen genoss er den beruhigenden Ton, der von festem Boden erzählte, bis der Ball endlich über den Boden rollte und in einer der Ecken vor ihm liegen blieb.
Es wäre aber im Bereich des Möglichen gewesen, meldete sich Nummer zwei. Das mit der Säule.
Thomas nahm nun all seinen Mut zusammen. Er streckte die Hände wieder aus und wagte schließlich einen weiten Schritt nach vorn. Ein kleiner Schritt hätte allerdings auch gereicht, denn in der Enge der Kabine stieß er so fast mit dem Gesicht gegen die Aufzugtür. Seine Hände ertasteten die kalten Aluminiumplatten und den schmalen Schlitz genau in der Mitte. Thomas presste sein Auge gegen die Stelle, an der die beiden Schiebetüren zusammenstießen, konnte aber nichts, nicht einmal ein helles Flackern, erkennen. Und das einzige Geräusch war ein fernes Rauschen, das vielleicht von einem Wasserfall, ebenso gut aber auch vom Rauschen seines Blutes in den Ohren herrühren konnte. Und wenn er es sich recht überlegte, war die zweite Möglichkeit die wahrscheinlichere von beiden.
Hihi, wir sind gefangen, gefangen, sang Nummer drei und war augenscheinlich glücklich. Wir sind gefangen und keiner wird uns vermissen, hihi. Und jetzt bleiben wir hier und verhungern und verdursten und ersticken und werden waaaaahnsinnig! Hihi.
7
07:17 Uhr, Krankenhaus Donaueschingen, Intensivstation
Reichlich zwei Stockwerke über Thomas Bachmanns Gefängniszelle zwischen Erdgeschoss und Keller befand sich die Intensivstation des Krankenhauses. Erwartungsgemäß waren die Notstromaggregate der Klinik angesprungen. Sie hatten nach dem Stromausfall Punkt 07:00 Uhr nur kurz gezögert, einmal kräftig durchgehustet und waren schließlich zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk zum Dienst angesprungen. Seitdem dröhnten im Wirtschaftshof die kraftvollen Dieselmotoren und versorgten die wichtigsten Lebensadern der Klinik mit Elektrizität. Auf den langen, kahlen Fluren brannte nur noch jede vier te Lampe und die Patientenzimmer blieben ganz unbeleuchtet. Aber von draußen drang helles Tageslicht durch große, geschlossene Fenster, welche die Gerüche von Krankheit und Tod in den engen, mit jeweils drei Betten besetzten Räumen festhielten. Auf der einen Seite der Scheibe jubelte der Frühling, auf der anderen das Schweigen des Herbstes.
Eva Seger, die hier als Krankenschwester arbeitete, konnte sich nur schwer konzentrieren. Die Intensivstation, ein langer, breiter Flur mit insgesamt sieben Patientenzimmern, war zum Brechen voll und ständig lag der aufdringliche Ton eines mehr oderweniger bedeutenden Alarms in der Luft. Maschinen meldeten das Ende einer Infusion, unregelmäßige Atemzüge eines Patienten oder ein holpriges EKG. Und mit dem stromlosen Sekundenbruchteil vor dem Anspringen des Notstroms vor wenigen Minuten war es zu allem Überfluss auch noch not wendig geworden, jede der Maschinen auf ihre Einstellungen hin zu überprüfen und die ausgelösten Alarme zu quittieren. Eva Seger hatte hier in Donaueschingen ihren Beruf gelernt. Seit mehr als fünfzehn Jahren kannte sie die Klinik, zuerst auf einer chirurgischen Station, seit acht Jahren nun hier. Anfangs hatte sie die viele Technik gestört, aber es ist wie mit allem: War man erst einmal bereit, sich auf etwas einzulassen, waren die anfänglichen Ängste bald vergessen. Lächerlich.
Seit Leas Geburt arbeitete sie nur noch Teilzeit. Erst mit Leas Einschulung und durch Susannes Hilfe war es ihr möglich, mehr als ein oder zwei Tage pro Woche zu arbeiten.
Evas Blick wanderte aus dem Fenster, während sie ihrem Patienten, Aleksandr Glück, das Gesicht wusch.
Es war an der Zeit, dass sie Hans von ihrer Schwangerschaft erzählte. Sie hatte schon viel zu lange gewartet. Immerhin ahnte sie es seit sechs Wochen und wusste es seit vierzehn Tagen mit Bestimmtheit. Komisch, dass ihm ihre morgendliche Übelkeit noch nicht aufgefallen war. Vielleicht war sie aber auch eine bessere Schauspielerin als sie selbst glaubte. Eva freute sich auf das Kind. Sie hatten nach Leas Geburt schnell ein zweites Kind gewollt, aber dass sie jetzt seit sieben Jahren ohne Verhütung miteinander schliefen ohne dass etwas passiert war, hatte Eva schon fast an ihren Fähigkeiten als Frau zweifeln lassen. War sie eine richtige Frau, wenn sie nicht einmal ein zweites Kind empfangen konnte?
Eva liebte den Gedanken an eine riesige Familie. Sofort hätte sie auf die Arbeit hier verzichtet, um einzig und allein für ihren Mann und einen Stall voller Kinder da zu sein. Sie träumte oft davon, wie es wäre, wenn an dem riesigen Küchentisch nicht nur sie, Lea und Hans, sondern noch ein halbes Dutzend weiterer Kinder säßen. Lea war schon so groß, viel zu groß, als dass sie Evas Muttertrieb allein hätte befriedigen können. Aber Hans zuliebe hatte sie sich in den letzten Jahren eingeredet, dass so, mit nur einem Kind, alles irgendwie in Ordnung wäre. Wer weiß, vielleicht wäre das nächste Kind behindert oder krank oder tot. Dann doch lieber ein gesundes Kind, wie Hans immer sagte.
Hans hatte sich mit der Situation bemerkenswert gut und schnell arrangiert. Für ihn war das Leben in Ordnung und Evas Sehnsucht nur schwer zu verstehen. Und das war der Grund, warum sie die frohe Nachricht so lange für sich behalten hatte. Aber sobald Hans morgen Abend aus Schweden zurück war, wollte sie ihm reinen Wein einschenken.
Vor zehn Jahren hatten sie sich kennengelernt, sie und Hans. Damals hieß sie noch Eva Kiefer, war Martin Kiefers Frau. Bei ihrer ersten Hochzeit war sie gerade neunzehn und heiratete den Erstbesten, wie es ihr im Nachhinein vorkam. Aber um von ihrer Mutter wegzukommen war ihr damals jedes Mittel recht. Eva hatte keine Geschwister und ihr Vater war der unglücklichste Mensch, den sie kannte. Zwischen ihm und Mutter gab es selten ein gutes Wort. Eigentlich konnte sie sich an keinen Moment ohne Spannungen erinnern. Mutter wollte mehr, wollte etwas aus ihrem Leben machen, sich verwirklichen, entwickeln und etwas darstellen. Aber dazu hatte sie, wie sie selbst vor Fremden freimütig zugab, den verkehrten Mann, einen Mann, der nicht in der Lage war, ihre Wünsche zu erfüllen und sie dann zu allem Überfluss auch noch geschwängert hatte. Evas Mutter behandelte ihre Tochter ein Leben lang wie ein unerwünschtes Fundstück, das sich uneingeladen eingenistet hatte und einfach nicht mehr ging. Als Martin Kiefer irgendwann erschien und sein Interesse an Eva bekundete, war das Schlimmste, dass sie nun ihren Vater allein zurücklassen musste.
Eva hatte seit Jahren nicht mehr bewusst an ihren ersten Mann gedacht. Seit es Hans gab, war alles Vergangene wirklich vergangen. Als Martin damals, als er noch ihr Mann war, eine unverfängliche SMS von Hans auf ihrem Handy fand, zeigte er kurz sein wahres Gesicht. Er vergewaltigte sie auf dem kalten Küchenboden und das Einzige, was sie sich dabei fragte, war, warum es in diesem Raum keinen Teppichboden gab. Weil es unpraktisch wäre, fiel ihr danach ein, als sie allein in der Küche saß und sich die Ohren zuhielt, während Martin zwei Stühle an der Wand über ihrem Kopf zertrümmerte. In den Minuten der Vergewaltigung aber wäre ein Teppichboden praktisch gewesen.
Die SMS war ein Nichts, aber allein die Tatsache, dass ein fremder Mann seiner Frau schrieb, war für Martin Kiefer damals die Hölle. Heute lächelte er meist wie ein Mann von Welt, lächelte ein wenig zu selbstsicher. Die Vergewaltigung schien es für ihn niemals gegeben zu haben. Im Gegenteil, denn plötzlich bemühte er sich um seine Frau, warb um sie, sagte, dass er allein nicht leben könne und dass er Kinder mit ihr wolle. Aber Hans war da schon zu übermächtig und, obwohl es zu diesem Zeitpunkt – Eva und Hans kannten sich vier Monate – erst zu wenigen schüchternen Berührungen gekommen war, wusste Eva, dass Hans der Mann ihres Lebens war.
Plötzlich spürte sie Übelkeit aufsteigen. Sie riss sich den Gummihandschuh herunter, presste die Hand vor den Mund und stürzte nun schon zum zweiten Mal an diesem Morgen aus dem Zimmer.
Als sie zurückkam, war sie weiß wie Schnee und der Geschmack von Erbrochenem lag auf ihrer Zunge. Sie steckte sich einen Kaugummi in den Mund.
»Ist alles in Ordnung, Schwester?« Eva versuchte ein Lächeln.
»Natürlich«, sagte sie. »Es ist alles in Ordnung.« Sie betrachtete den alten Mann. Hilflos lag der auf seinem Bett, so wie ihn Eva vor wenigen Minuten zurückgelassen hatte. Obwohl er das Schlimmste jetzt hoffentlich hinter sich hatte, war er dem Tod doch näher als dem Leben. Und trotzdem, vielleicht aber auch deswegen, spürte er, dass mit seiner Schwester heute etwas nicht stimmte.
Eva nahm ein Handtuch vom Nachtschrank und trocknete Aleksandr Glück den Rücken ab.
»Schwester?« Sie musste wieder lächeln, obwohl es in ihren Innereien noch gefährlich rumorte. Aber Aleksandr Glück sagte nicht Schwester, sondern Schwästerrr, mit einem schier endlosen Rollen am Ende. Sie liebte dieses R und wie er es, mit seiner tiefen, warmen Stimme und dem typischen Akzent der Russlanddeutschen aussprach.
»Ja?«
»Warum hat vorhin alles gepiepst, wie tausend Vögelein?«
»Der Strom ist weg.«
»Oh, ist er das? Das kenne ich aus Russland. Wir hatten oft tagelang keinen Strom und immer einen Berg Kerzen im Schrank. Aber bei uns brannten keine Lampen, wenn der Strom weg war.« Er zeigte mit dem Kinn auf eine flackernde Neonröhre über seinem Bett.
»Jetzt läuft das Notstromaggregat, glaube ich.« Sie leerte die Waschschüssel.
»Schade Schwästerrr, dass Sie nicht immer hier sein können. Sie kommen so selten.«
»Ach, jetzt übertreiben Sie aber!«, antwortete Eva mit gespielter Entrüstung. »Die anderen sind doch auch alle nett.« Eva wusste aber, was er meinte. Sie – das hatte er ihr vor wenigen Tagen selbst gesagt – sie erinnere ihn an seine Frau. Ihre Art, die Wärme und Ruhe – alles wie bei seiner Frau. Und Eva würde seiner damals zwanzigjährigen Frau zum Verwechseln ähneln, heute, nach über fünfzig Jahren Ehe. Sie wollte sich die Hände waschen, der Wasserhahn fauchte, dann war er still. Eva bewegte den Hebel der Mischbatterie hin und her, doch immer mit demselben Ergebnis – es gab kein Wasser mehr.
»Ich bringe Ihnen Ihr Frühstück.«
Auf dem Flur standen der Chefarzt, Professor Kellermann, und Stiller, ein junger Assistenzarzt, der heute auf der Intensivstation Dienst tat. Stiller wurde von allen nur Gollum genannt und wer Tolkiens »Herr der Ringe« gelesen oder gesehen hatte und Stiller kannte, wusste warum. Stiller war klein, mager, mit viel zu lang geratenen Armen, die meist hilflos an ihm herabhingen. Er hatte leicht vorquellende Augen und dünne Lippen verbargen nur halbherzig die nikotingelben Zähne.
»Ich werde alles notieren.« Dr. Stiller war in seinem Element. Mit wachen Augen schlich er durchs Leben, beäugte alles und jeden voller Misstrauen und war eigentlich erst mit einer Situation zufrieden, wenn es an dieser etwas auszusetzen gab. Und wenn er den Schuldigen hierfür gefunden hatte. Den Schuldigen. Den gab es immer.
»Ich werde alles notieren.«
8
07:28 Uhr, Bundesstraße 27 bei Donaueschingen
Auf der Bundesstraße, die Donaueschingen und das angrenzende Hüfingen in eleganter Schleife umkurvte, herrschte morgendlicher Berufsverkehr. Lkw-Kolonnen rollten aus der Schweiz kommend der Autobahn nach Norden zu und umgekehrt quälten sich auf der einspurigen Strecke die Laster Richtung Süden. Dazwischen Pendler.
Ricarda Schusters Arbeitsweg führte jeden Morgen an Donaueschingen vorbei. Sie arbeitete in der mittelalterlichen Altstadt Villingens in einem kleinen Versicherungsbüro. Sie war sich sicher, heute würde sie keinen einzigen Abschluss, dafür aber zuhauf Reklamationen, Stornos und was sonst noch alles auf den Tisch bekommen. Dieser Tag musste zur Katastrophe werden! Denn beim morgendlichen Duschen ging gegen sieben plötzlich das Licht aus. Zeitgleich versiegte mit heiserem Röcheln das Wasser. Sie stand splitternackt und nass in ihrem fensterlosen Bad und beim Versuch, die Tür zu ertasten, war sie ausgerutscht und mit dem Kinn gegen die Toilette geprallt. Aber nein, das war es noch lange nicht. Wenn ein Tag so richtig gut anfängt, geht er regelmäßig auch so weiter!
Nichts funktionierte. Kein Licht, kein Wasser, kein Radio, die Kaffeemaschine hatte ohne Strom auch keine Lust, und zu allem Überfluss streikte das Telefon ebenfalls. Aber wenigstens sprang der kleine Volkswagen an, das Radio aber nicht. Sie legte eine CD ein. Eminem war jetzt genau richtig!
In der Stadt herrschte ein mittelstarkes Chaos, keine einzige Ampel funktionierte. Sie glotzten mit schwarzen toten Augen blöde auf den zunehmenden Verkehr.
Irgendwie hatte sie es geschafft, die Stadt heil zu durchqueren und sich in den Fahrzeugstrom Richtung Villingen einzusortieren. Während der Fahrt versuchte sie eine SMS zu verschicken, Eminem schimpfte mit dröhnenden Bässen über die Welt und seine Mutter und der Lkw-Fahrer vor ihr, der auf der Suche nach einem funktionierenden CB-Funkkanal den Verkehr einen Moment unbeachtet gelassen hatte und fast in den Gegenverkehr gerast wäre, vollführte plötzlich eine Vollbremsung. Ricarda, die Augen fest auf ihr ultraflaches Handy gerichtet, raste ungebremst in den Truck. Sie sah noch aus dem Augenwinkel die fröhlich flatternde Plane mit der Aufschrift Gut versichert? und begann sich gerade die Telefonnummer darunter einzuprägen, als der ihr folgende Transporter ihren alten VW unter den Laster rammte. Dann ging für sie die Sonne viel zu früh unter. Ricarda Schuster brach sich beide Beine, vier Rippen, einen Halswirbel und den kleinen Finger. Eine Rippe hatte sich in ihre Lunge gebohrt und aus einer klaffenden Wunde am Kopf blutete sie stark. Vier Männer versuchten vergebens, sie aus dem eingekeilten Wagen zu ziehen, während andere sich erfolglos bemühten, Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zu erreichen. Wäre der Unfall eine Stunde früher passiert, hätte sich reibungslos eine eingespielte Rettungsmaschinerie in Gang gesetzt. Notärzte hätten die Blutungen gestillt und Feuerwehrmänner die Frau aus dem VW herausgeschnitten. Polizisten hätten den Verkehr um die Unfallstelle herumgeleitet und ein Rettungshubschrauber Ricarda schließlich in die nächste Klinik geflogen.
Um 7:28 Uhr aber verblutete Ricarda Schuster, ohne noch einmal die Augen zu öffnen. Der Verkehr staute sich schnell in beide Richtungen und Dutzende hilflose Männer und Frauen sahen ihr beim Sterben zu.
9
7:45 Uhr, Krankenhaus Donaueschingen, Intensivstation
Mit sichtlicher Anstrengung wuchtete Peter Tröndle die eigentlich automatisch öffnende, zweiflügelige Glastür zur Intensivstation auf. Tröndle war Verwaltungsleiter und Verzweiflung und Entsetzen standen ihm ins Gesicht geschrieben.
»Nichts«, keuchte er, »nichts funktioniert mehr.« Er ließ sich auf einen quietschenden Bürostuhl fallen.
»Stimmt«, kam es tonlos von Stiller. Der Assistenzarzt starrte seit Minuten auf seinen flachen, kaum zigarrenkistengroßen Westentaschencomputer. Der Monitor starrte mit schwarzem Auge zurück. Der Computer war völlig normal angesprungen, als aber das Betriebssystem hochgefahren war, zitterte plötzlich das kleine Bild, ein kurzer Moment, in dem sich unaufgefordert sämtliche vorhandenen Dateien öffneten und wieder schlossen. Dann war Funkstille.
Das war für Stiller zu viel. Mit offenem Mund starrte er noch immer sein Allerheiligstes an. Er hielt ein Grab in den Händen. Beerdigt waren Termine und Adressen, Telefonnummern und Nachschlagewerke, Fotos. Morgen früh hatte er doch mit seiner hochschwangeren Frau einen Termin beim Frauenarzt! Ultraschall. Baby angucken. Vielleicht könnten sie diesmal endlich sehen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Aber wann, wann zum Teufel sollten sie bei ihrem Arzt sein? Und wie war die Rufnummer der Praxis?
»Was ist mit Telefon?« Professor Kellermanns Blick wanderte von Stillers kleinem Computer zu Peter Tröndle. »Kann man wenigstens irgendjemanden erreichen?«
»Nein.« Tröndle schüttelte den Kopf. »Normale Festnetztelefone funktionieren nicht. Wir haben es mit einem uralten Apparat probiert, aber auch hier tote Hose. Und mit Handys ist gar nichts zu machen. Die meisten Handys sind völlig hinüber und die zwei funktionierenden, die wir hier im Haus gefunden haben, geben nur Knacken und Rauschen von sich.«
»Es weiß also auch keiner, was eigentlich los ist und wann wir wieder Strom haben?«
»Nein.«
»Irgendjemand muss doch Bescheid wissen!« In Stillers Stimme schwang Verzweiflung. »Es muss doch jemand wissen, wann die Telefone und der Strom wieder funktionieren. Und was mit meinem Computer los ist«, fügte er mit einem Blick auf das jetzt unnütze Ding in seiner Hand hinzu. »Wir leben schließlich nicht im Mittelalter!«
»Aber«, in Tröndles Augen flackerte Angst, »es scheint noch viel schlim mer zu sein. Die Leute berichten von mehreren Flugzeugabstürzen in der Umgebung. Richtung Blumberg steigt Rauch auf und die Straße nach Villingen ist wohl nach mehreren Unfällen unpassierbar.«
»Also dann«, Kellermann hatte einen Entschluss gefasst, »für heute werden bis auf Weiteres sämtliche Operationen abgesagt. Stiller, Sie stecken endlich das Ding da weg und schauen, welche Patienten unbedingt bei uns bleiben sollten und welche auf normale Stationenm verlegt werden können. Und stellen Sie sicher, dass es zu keinen Problemen infolge des Stromausfalles kommt.« Dann verließ er gemeinsam mit dem Verwaltungsleiter die Station. Zurück blieb ein hilfloser Stiller. Der Arzt blieb einen Moment auf dem breiten Flur stehen und betrachtete den routinierten Betrieb um sich herum. Alles lief weiter. Als sei nirgendwo der Strom ausgefallen, als könne man sofort jeden Menschen der Welt telefonisch erreichen, als würde sein kleiner Taschencomputer problemlos funktionieren. Das elektrische Licht – dem Notstromaggregat sei Dank − die routiniert arbeitenden Schwestern und Pfleger und die vertrauten Geräusche der unbeirrt tätigen medizinischen Geräte gaben ihm langsam seine Sicherheit zurück. Gollums dürrer Körper straffte sich.
Eva brachte Aleksandr Glück das bescheidene Frühstück, Brei und etwas Apfelmus. Da die Aufzüge nicht funktionierten, hatte sie es selbst aus der Küche im Erdgeschoss holen müssen. Unterwegs hatte sie mehrmals versucht, bei Susanne Faust anzurufen, aber sie bekam nicht einmal ein Freizeichen. Und auch Hans hatte sich nicht wie versprochen gegen acht gemeldet. Er rief sonst jeden Morgen an, egal ob sie zu Hause oder hier auf Intensivstation war. Heute aber klingelte kein Telefon. Für niemanden.
Die Station wurde zügig geräumt. Alle bis auf Aleksandr Glück, der noch Medikamente erhielt, die eine dauernde Kreislaufüberwachung nötig machten, wurden auf andere Stationen verlegt, denn Dr. Achim Stiller − Gollum − und sein Chef, Professor Kellermann, erwarteten als Folge der Flugzeugabstürze und Verkehrsunfälle jeden Augenblick Schwerverletzte. Kurz vor halb neun war man bereit.
Der Ansturm jedoch blieb aus.
Trotzdem wurden die fünf Operationssäle der Klinik eilig für Notfalleingriffe vorbereitet. Da jedoch sämtliche Kommunikationswege des Hauses unterbrochen waren – Telefon, E-Mail und Piepser funktionierten weiterhin nicht – hielten sich sieben Chirurgen und vier Anästhesisten im OP-Trakt in Bereitschaft, dazu acht Schwestern und Pfleger. Die Stationen wurden durch jeweils einen Assistenzarzt betreut und wer übrig blieb, erwartete in der Nähe der Krankenwageneinfahrt die kommenden Patienten. Zwei Schwestern übernahmen vorerst die Informationsübermittlung und pendelten im Haus zwischen den Chefärzten und ihren Mitarbeitern, der Verwaltungsleitung und den einzelnen Stationen.
Ein erstes Opfer, Valentin Jost, der zum ersten nicht existierenden Patienten der Klinik wurde, spazierte halb neun durch den Haupteingang. Das Chaos dieses denkwürdigen Morgens hatte, wie es aussah, die Welt zurück ins Mittelalter gezaubert. Und eben dieses Chaos hatte an einer nicht funktionierenden Ampel im Donaueschinger Stadtzentrum einen Kleinbus in Valentin Josts Beifahrerseite befördert. Sein Wagen war danach Schrott und er selbst blutete heftig aus einer Platzwunde am Kopf, mit dem er gegen das Lenkrad geschlagen war. Der Fahrer des Kleinbusses hatte ohne auszusteigen zurückgesetzt und dabei einen Laternenpfahl gerammt. Dieser stürzte auf die Fahrbahn. Der Kleinbus umkurvte Josts Wagen, seine Reifen quietschten über den Gehweg, dann war er auch schon weg. Weder Polizei noch Rettungsdienste befanden sich in der Nähe oder waren zu erreichen. Vergebens hatte Valentin Jost versucht, ein Auto anzuhalten. Um die Unfallstelle und die umgestürzte Laterne herum staute sich der Berufsverkehr schnell in beide Richtungen und sickerte nur zäh durch die Engstelle. Die meisten Fahrer wichen im Vorbeifahren entweder seinem Blick aus oder zuckten nur bedauernd mit den Achseln. Zu Fuß erreichte er das Krankenhaus, die Stirn notdürftig mit seiner Jacke verbunden.
Valentin Jost, Ehemann und Vater zweier Söhne, wohnte in Wolterdingen, nur vier Kilometer von Donaueschingen entfernt. Wie jeden Morgen war er zu seiner Arbeitsstelle unterwegs. Er arbeitete, neben zwei Dutzend Kollegen aus aller Herren Länder, als Programmierer in einer aufstrebenden EDV-Schmiede. Ende des Jahres sollte der Börsengang erfolgen und den Erlös aus dem Aktienpaket, welches jeder Mitarbeiter zum Vorzugspreis zeichnen konnte, hatte Jost bereits fest eingeplant: Er wollte mit seinen Jungs nach Florida, nach Cap Canaveral!
Am Haupteingang nahm ihn eine der vorbeieilenden Schwestern in Empfang. »Kommen Sie«, sagte sie nach einem Blick unter seinen Turban, »das muss genäht werden. Ich bringe Sie zu einem Arzt.«
Aber Valentin Jost gab es als Patienten eigentlich gar nicht, existierte nicht, weil bekanntlich alle Computersysteme streikten. Somit konnte die Versichertenkarte nicht eingelesen und kein patientenbezogenes Projekt angelegt werden. Weder sein Kopf noch die rechte Schulter, an der sich einige Prellmarken begannen abzuzeichnen, konnten geröntgt werden und auch die ärztlichen und pflegerischen Leistungen und Tätigkeiten ließen sich nicht, wie vorgeschrieben, dokumentieren.
»Holen wir später nach«, versuchte der Chirurg, der Valentin Jost versorgt hatte und nun zur Überwachung auf die Intensivstation brachte, Dr. Stiller zu beruhigen. Aber als Stiller den Schmierzettel sah, auf dem die voraussichtlichen Diagnosen und Patientendaten gekritzelt waren, war er nicht mehr zu halten.
»Können Sie mir verraten, wie wir hier ordentlich arbeiten sollen, wenn nichts funktioniert?«, herrschte er seinen verdutzten Kollegen an. »Das hier ist eine Intensivstation, nicht irgendeine Wald- und Wiesenabteilung! Ohne gescheite Diagnostik kann ich ihn nicht therapieren«, stellte er in süffisantem Ton und mit verschränkten Armen fest.
»Sie sollen auch nicht therapieren, sondern überwachen!«, klärte der Chirurg ihn auf. »Die Platzwunde ist genäht. Aber, und das sollten Sie eigentlich wissen, solange eine Hirnblutung nicht ausgeschlossen werden kann, darf ich einen Patienten nicht gehen lassen!« Damit legte er den Schmierzettel, dessen Annahme Stiller bisher verweigerte, dem in einem Rollstuhl sitzenden Valentin Jost auf den Schoß und rannte von der Station.
Eva und Stefan, ein Pfleger, brachten Jost in ein Zimmer, während Assistenzarzt Dr. Achim »Gollum« Stiller mit vor Zorn hochrotem Kopf das eben Vorgefallene detailliert notierte. Auf einem ebensolchen Schmierzettel, wie ihm bewusst wurde, was seinen Zorn und das Gefühl der Ohnmacht, welches er so abgrundtief verachtete, nur noch verstärkte.
Stiller war seinem Naturell nach stets zerrissen. Einerseits verlangte das ihm von Kindesbeinen an eingeimpfte Pflichtgefühl nach allseits vorhersagbaren und korrekt erledigten Vorgängen. Auf der anderen Seite war er der Typ Mensch, den man gemeinhin einen Wadenbeißer nennt: ein kleiner giftiger Mann, dessen Unzufriedenheit mit seiner Position und dem eigenen Erscheinungsbild ihn zu einem stets angriffsbereiten Zeitgenossen machten. Stets stand er im Schatten seines zwei Jahre älteren Bruders, der, bereits Chefarzt in Würzburg, immer das Musterkind war − während Stiller mit der offensichtlichen Vorliebe seines Vaters dem älteren Bruder gegenüber und den vielen Komplexen des eigenen Äußeren wegen zu kämpfen hatte. Und was ihm heute an Persönlichkeit mangelte, versuchte er mit übertriebenem Autoritätsgebaren wettzumachen. Anpassung nach oben und Aggressionsabbau nach unten waren seine Devisen, die ihm wenig Sympathien und seinen Spitznamen eingebracht hatte.
Eva, die aus Glücks Zimmer den Wortwechsel der beiden Ärzte mithören konnte, wusste, dass sie oder einer ihrer Kollegen demnächst als Blitzableiter dienen durften. Hüte dich vor kleinen Männern! , hatte ihr Großvater immer gewarnt.
»Was ist denn bei euch los?«, brüllte Stiller über die Station, als er aus Valentin Josts Zimmer heftigen Wortwechsel hörte. Er steckte seine Notizen ein.
»Warum sind Sie noch nicht in Ihrem Bett?«, fuhr er seinen Patienten wie ein unmündiges Kind an. Jost saß noch immer auf dem Rollstuhl und weigerte sich, sich ausziehen zu lassen.