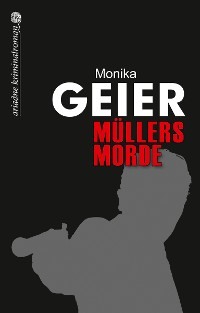Kitabı oku: «Müllers Morde», sayfa 3
2.41 Uhr
Nur noch aufräumen. Er entfernte alles Verräterische aus Steenbergens Auto, er saugte mit einem kleinen Tischstaubsauger die Polster und Fußräume und Steenbergen ab, er steckte der Leiche Handy und Autoschlüssel ins Jackett, zog das Klebeband von ihrem toten Mund ab und behandelte alle Stellen, an denen das Tape geklebt hatte, mit Hautcreme, weil er gehört hatte, dass man damit verräterische Spuren entfernen konnte. Schließlich zog er den schrecklichen Overall aus und packte den ganzen Kram, den er gebraucht hatte, in seinen Rucksack. Er suchte nach weiteren Spuren – auf dem Schotter des Parkplatzes gab es ein paar Schleifspuren, die er mit der Fußspitze verwischte, ansonsten wies nichts mehr auf ihn hin. Dann machte er sich, endlich, in den schwitzigen Gummistiefeln und mit geschultertem Rucksack auf den Weg zu seinem eigenen Auto.
Sie haben einen Menschen getötet.
Das war nötig.
Die Entschuldigung hört man öfter.
Es war kein Familienvater mit fünf unterversorgten Kleinkindern, okay? Es war ein reicher Sack, der niemandem fehlt. Für mich war er eine echte Gefahr. Und sagen Sie selbst: Der ENERGIE-Manager mit CO2 am Totenmaar – das ist doch abgefahren!
Sie spielen Cluedo?
Wie kommen Sie denn darauf?
Na, es hat sich so angehört: Der ENERGIE-Manager mit CO2 am Totenmaar. Das ist Cluedo.
Hören Sie bloß auf. Der hätte kurzen Prozess mit uns gemacht. Und zufällig weiß ich von meiner, hm –
Komplizin?
Was soll denn der Ton? Ja, meinetwegen: Komplizin, wenn sie das nur wäre! In Wahrheit wollte sie alles auffliegen lassen, aber ich hab’s ihr gezeigt. Ihr lieber Steenbergen ist tot – jetzt wird sie spuren!
Da Steenbergen tot ist, wird sie aber auch nicht mehr viel nützen.
Sie wird den Mund halten, das ist erst mal das Wichtigste. Mit Steenbergen als Chef konnte es eh nicht mehr lange gut gehen, um den hätte man sich sowieso bald kümmern müssen! Von allen Vorgesetzten, die ich bisher hatte, hat keiner, wirklich keiner wie Steenbergen nachts im Büro herumgehockt und bereits geprüfte Geschäftsvorgänge noch mal geprüft.
Sie rationalisieren.
Natürlich! Egal, wer da nachkommt – es kann nur besser werden. Außerdem will ich sowieso weg von diesen simplen Tarngeschäften. Das ist mir zu anspruchslos. Ich hab ganz andere Pläne.
Nein, ich meine, Sie rationalisieren Ihre Tat. Den Mord.
Also erstens mal ist das im Moment noch ein einfacher Todesfall, der sich, wie ich fest glaube, als ein Unglück entpuppen wird, als Naturkatastrophe, als höhere Gewalt –
Mord.
Ah! Wissen Sie was: Es gibt sowieso zu viele von uns. Wir sind sieben Milliarden Menschen auf der Erde, und bald werden wir noch mal so viele sein! Wir werden uns kloppen um jeden Tropfen Öl, um jeden einzelnen Baum, um jeden Meter Land, und zwar noch in dieser Generation! Was macht es da, wenn die gehen, die sowieso niemand braucht?
Sie haben also ein ökologisches Motiv.
Eher ökonomisch, würde ich sagen. Ich glaube einfach nicht, dass es für alle reicht. Und ich will auch noch was von meinem Leben haben.
Wieso wenden Sie Ihre Überzeugungen nicht auf sich selbst an? Oder auf Ihre – Komplizin? Sind Sie nicht ebenso überflüssig wie Steenbergen es war?
Ach, lecken Sie mich doch am Arsch.
Zwei
Er hatte sich nie richtig verändert. Wenn Richard Romanoff, 42, freiberuflicher Historiker, sich in die Mitte seiner Wohnung stellte – also in die Küche –, dann konnte er mit einem Rundumblick die gesamte Misere betrachten: Er lebte in einer Studentenbude. Einer dreckigen Studentenbude. Er war der Freak, der in der WG-Wohnung hängen geblieben war, der Letzte von vielen. Noch heute zehrte er von den vergangenen Partys, den Dramen und Krächen, den selbstgebauten Möbeln, den Kinoplakaten. Niemals hatte er eigenes Geschirr gekauft. Und neben der Fensterbank am Esstisch hing nach wie vor der verblichene Spülplan, den die nervige Yvonne damals dorthin gepinnt hatte, damit ihn auch wirklich jeder sehen konnte. Yvonne war übrigens immer noch nervig. Wenn sie vorbeikam – das tat sie! –, konnte es passieren, dass sie Tassen mitnahm. Sie nagelte ihre High Heels in den Parkettboden, der schon vor zwanzig Jahren vernachlässigt gewesen war, zog ungeniert Schubladen auf und wunderte sich, wie klein alles war. Richard seinerseits fand Yvonne klein: Sie hatte ihr Studium abgebrochen und den Prof geheiratet. Oder umgekehrt. Auf jeden Fall war sie nun Mitglied der Unigemeinde und dekoratives Anhängsel des Fachgebietes, für das auch Richard arbeitete. Er hielt als freier Mitarbeiter die Vorlesungen über Karl den Großen, leider allerdings nicht etwa, weil man seine wissenschaftliche Kompetenz besonders schätzte, sondern weil der Chef des Fachgebiets selbst sich an den Ottonen festgefressen hatte und den großen Karl nur für ein lästiges Hindernis seiner Forschung hielt. Wobei der Prof in seiner Abneigung sogar heimlich mit der Illig-These sympathisierte. Die Studierenden kamen zuweilen völlig überdreht aus seinen Seminaren und zettelten dann bei Richard heiße Diskussionen darüber an, ob es Karl den Großen und die ganze Karolingerzeit überhaupt gegeben hatte. Eventuell war das aber auch nur eine kleine Rache dafür, dass der Prof jetzt die nervige Yvonne an der Backe hatte, die hatte er nämlich seinerzeit hier in der WG kennengelernt. Wie auch immer, auf jeden Fall hatte Richard außerdem die Übersetzungen aus dem Russischen und dann, mit etwas Glück, seine Aufträge. Die waren seine eigentliche Arbeit. Er besaß nämlich einen besonderen Riecher für bedeutsame Altertümer, und wenn er Glück hatte, wurde er von anerkannten Museen und Wissenschaftlern um Hilfe gebeten. So hatte er bereits mehrere seltene Papyri wiederentdeckt, außerdem eine anderthalb Meter hohe Sandsteinstatue des persischen Königs Solsol in der Rolle des Volkshelden Rostam und noch so einiges andere, was verborgen und unerkannt in Museumskellern gelegen hatte. Man konnte sogar gut Geld damit verdienen, nur eben leider nicht regelmäßig. Manchmal war dermaßen viel zu tun, dass er einen Helfer einstellen musste, doch darauf folgten stets wieder Durststrecken. So wie jetzt gerade.
Richard seufzte tief. Er stand immer noch in der Küche und zwang sich, den Anblick des chaotischen Flurs mit fremden Augen zu sehen. Mit den Augen einer jungen, attraktiven Museumskuratorin beispielsweise, die ihn beauftragen würde, den Schatz des Priamos nach Deutschland zurückzuführen. Unmöglich, würde er sagen, da könnte ich noch so gut russisch reden, St. Petersburg rückt den nicht in hundert Jahren raus, die haben viel zu viel Angst, dass wir ihn behalten, ist ja Beutekunst gewesen. Eine Million, würde sie sagen, vorausgesetzt, dass der Flur aufgeräumt war, mein Publikum will den Schatz sehen, und Sie allein, mein lieber Herr Romanoff, sind in der Lage –
Das Telefon klingelte.
Richard durchquerte den dreckigen Flur in Richtung Arbeitszimmer.
Es war Peter Welsch-Ruinart. Richard seufzte innerlich und blickte zum Wandkalender. So dringend konnte die Wiederentdeckung von Atlantis auch wieder nicht sein, er war doch erst vor vierzehn Tagen bei dem Anwalt gewesen, Geld für das Eulengefäß war noch keins überwiesen worden, und vor einer weiteren Woche würde er für diesen Spinner nicht den kleinsten Finger rühren. »Ihr Auftrag mit dieser Vase ist ziemlich – bizarr«, sagte er abweisend. »Aber ich bin dran, und sowie ich Erfolg habe, melde ich mich bei Ihnen, versprochen.«
»Es geht um etwas anderes«, sagte Peter. »Könnten Sie bitte sofort in mein Büro kommen?« Seine Stimme hörte sich müde an, zittrig, doch auch gewohnheitsmäßig autoritär. »Ich meine natürlich nicht – entschuldigen Sie, das sollte keine – wie soll ich sagen: Bitte. Ich >muss mit Ihnen sprechen, so bald wie möglich.«
»Hm.« Wenn es nichts mit Atlantis zu tun hatte, wollte Richard erst recht nicht in Peter Welsch-Ruinarts Löwenhöhle. Nie und nimmer. »Tut mir leid«, sagte er. »Heute ist nichts zu machen.«
»Dann komme ich zu Ihnen«, verkündete Peter ohne Umschweife. »Sie telefonieren übers Festnetz, also sind Sie in Ihrem Büro, Ihre Adresse hab ich, und eine Viertelstunde werden Sie sicher erübrigen können.«
»Nein.« Richard sah sich entsetzt in seiner Wohnung um, und erst jetzt, mit der realen Bedrohung eines Besuchs, sah er die Wohnung wirklich mit fremden Augen, die Fliegenleichen auf der Fensterbank, das Fahrradskelett im Flur, das Mordillo-Poster über seinem Schreibtisch. »Aber ich habe nichts für Sie! Der Sammler, der für Ihr Projekt interessant ist, empfängt erst nächste Woche wieder Kundschaft, und bis dahin können wir gar nichts tun! Was wollen Sie überhaupt? Können wir das nicht telefonisch klären?«
»Leider nicht«, sagte Peter düster und ließ eine noch düsterere Pause folgen.
Richard schloss die Augen, schüttelte den Kopf, ballte die Linke zur Faust und sagte: »Okay, in einer halben Stunde bei Ihnen.« Weil er eben kein glatter, wohl frisierter Geschäftsmann mit straffem Terminkalender war. Sondern Richard Romanoff, der heute noch nichts Besonderes vorhatte und der es sich nicht leisten konnte, diesen Atlantis-Spinner zu verlieren.
Tagsüber sah die Kanzlei Welsch-Ruinart anders aus, sie summte vor Aktivität, Menschen in Businesskleidung kurvten mit Papieren und Handys durch die Gänge, als hätten sie Rollen unter den Füßen, sie zogen Wolken von künstlichen Düften hinter sich her, aufreizende Parfums, kantige Aftershaves, je akkurater sie angezogen waren, desto animalischer rochen sie. Unter ihnen fiel Richard auf wie ein Trapper, aber er fiel immer auf, weil er gut zwei Meter groß war und immer noch seinen Pferdeschwanz trug. »Zu Herrn Welsch-Ruinart«, sagte er zu der Elfe, die am Empfang der Chefetage saß. Sie hatte schräge Augen, weißblonde Haare und trug ihr helles Kostüm wie ein lästiges Zugeständnis an irdische Konvention. »Dr. Romanoff?«, fragte sie. In ihrem süßlichen Parfum lag eine leicht schmutzige Straßennote. Wie Kastanienblüten im Regen.
»Richard Romanoff.«
Sie lächelte. »Peter Welsch-Ruinart erwartet Sie.«
»Vulkanische Gase!«, schnaubte Peter kurz darauf, nichts war mehr mit Likörchen und der tüchtigen Valeska und dem aufreizenden Lauern hinter Mahagoni auf einem maßgeschneiderten Lederthron. Fiebrig vor Wut tigerte Peter durch sein riesiges Büro, das im Tageslicht weit gediegener wirkte, und wedelte mit einem Packen Zeitungen. »Hier: Dr. Gunter S., Manager eines bekannten Energiekonzerns, von CO2 aus Vulkangas erstickt. – Und stellen Sie sich vor: Das ist alles! Die Ermittlungen sind seit einer Woche eingestellt, beziehungsweise haben nie stattgefunden, niemand ist verantwortlich, und dann sagt mir dieser Polizist ins Gesicht, dass Gunni an diesem Maar tatsächlich von vulkanischen Gasen erstickt worden wäre! Dass es ein Unfall war! In einem spontan entstandenen Kohlendioxid-See! Ist das nicht irre?!«
Richard fand es allein schon irre, dass der unbekannte Steenbergen, dessen Existenz er massiv bezweifelt hatte, nun einfach tot und sogar schon seit einer Woche begraben sein sollte, dass Peter sich dermaßen menschlich aufregen konnte und dass er selbst, der gebildete und stets informierte Richard Romanoff, von dieser Geschichte so gar nichts mitbekommen hatte. Dabei war sie offenbar durch die Vermischtes-Spalten sämtlicher Zeitungen gegangen: »Tod am Totenmaar«, hatte es da saftig geheißen, oder schadenfroh: »ENERGIE-Manager stirbt an CO2-Vergiftung«. Peter hatte alle Artikel gesammelt, Richard kurz unter die Nase gehalten und trug sie nun herum wie die letzte schwache Verbindung zum Verstorbenen. Es sah hysterisch und gleichzeitig furchtbar traurig aus. Das Jungenhafte, das Peter umgab, machte es nur schlimmer. Er wirkte wie ein Bub, der es einfach nicht fassen konnte, dass sein bester Freund tot war.
»Es tut mir leid, dass Sie so einen Verlust hinnehmen mussten«, sagte Richard ehrlich. »Und es tut mir auch leid, dass ich es jetzt erst von Ihnen erfahren habe, ich – na ja, ich lese selten diese Klatschspalten, Sie wissen schon.« Er verstummte, weil er sich unglücklich ausgedrückt hatte, doch Peter hatte kaum zugehört.
»Vulkane!«, wiederholte er verächtlich. »Jetzt sagen Sie mal selbst, das ist doch irre!«
»Die Eifel ist aber ein Vulkangebiet«, gab Richard zu bedenken.
Peter hielt inne und starrte ihn an. »Und eines Tages hat dieses Vulkangebiet beschlossen, meinen Freund Gunni zu sich zu bestellen, um es ihm mal so richtig zu zeigen.«
»Das klingt natürlich grotesk«, erwiderte Richard vorsichtig, »aber ich habe die Dämpfe selbst schon gesehen, wir waren mal mit der Schule da, das ist lange her, klar, aber da war so ein kleiner Kratersee, und dort im Sumpf sind tatsächlich Gase aufgestiegen, oder war es im Wasser –«
»Mofetten«, unterbrach Peter unwirsch. »Aber die Mofetten sind am Laacher See. Nicht am Totenmaar. Dort ist keine einzige.«
»Hm«, machte Richard, der zum Thema Mofetten nichts weiter beitragen konnte.
»Und ganz abgesehen von diesem Vulkan-Irrsinn, fragt man sich doch, was er dort eigentlich wollte, am Totenmaar.«
Richard fragte sich vor allem, was er selbst hier sollte. Sogar einem Peter Welsch-Ruinart würde es doch schwerfallen, eine Verbindung zwischen dem Tod des Freundes und der Suche nach Atlantis herzustellen?
»Gunni hatte keine Freunde oder Projekte in der Eifel«, sprach Peter indessen. »Vielleicht war er mal mit seiner Tochter dort, in den Ferien, aber die lebt seit Jahren in Argentinien und ist nicht mal zur Beerdigung gekommen! Und es ist ja auch nicht so, dass Gunni sich abends ins Auto gesetzt hätte und zwei Stunden gefahren wäre, um auf einer Bank am Totenmaar den Kühen zuzugucken. Aber erzählen Sie das mal der dortigen Polizei. In der Eifel sitzt jedermann abends auf Bänken, die haben kein Fernsehen, von Theater und Kino ganz zu schweigen, die gucken Kühe.«
»Tja«, sagte Richard und blickte unauffällig auf seine Uhr. Offenbar musste Peter sich nur ausheulen, das durfte er noch maximal zehn Minuten lang, und dann würde Richard gehen. »Sie haben mein tiefes Mitgefühl«, versicherte er.
Peter hörte nicht hin. »Das Problem ist«, wetterte er, »dass die Eifel noch zu Rheinland-Pfalz gehört, dass also jetzt irgendwelche Provinz-Bullen für den Fall zuständig sind, während Gunni in Köln gelebt hat und die Ermittlungen eigentlich hier in NRW geführt werden müssten, verstehen Sie? Aber da sind nun leider zwei Bundesländer zuständig, und deswegen bewegt sich überhaupt nichts. Die einen sehen bloß ihre Vulkane und trauen sich nicht über die Grenze, und die anderen sind überarbeitet und schieben alles, was irgend geht, an die Nachbarn ab. Und obwohl ich Gunnis offizieller Nachlassverwalter und Testamentsvollstrecker bin, will keiner von denen offen mit mir reden.«
»Wenn es Vulkangase waren, muss doch sowieso nicht ermittelt werden«, sagte Richard und meinte es völlig ernst.
Peter starrte ihn an. »Sie sagen es! Das ist ein Skandal!«
»Wenn es aber keine Vulkangase waren«, improvisierte Richard daraufhin, »was war es dann?«
»Wer«, sagte Peter hart. »Die Frage ist: Wer war es dann?«
Sie sahen sich an, und Richard wusste plötzlich, dass er niemals hätte kommen dürfen.
»Deswegen habe ich Sie herbestellt«, erklärte Peter prompt. Er baute sich direkt vor Richard auf, packte dessen Oberarm und blickte ihm mit all seiner jungenhaften Verzweiflung ins Gesicht. »Sie sind der Einzige, dem ich zutraue, dass er das herausbekommt.«
»Nein.« Richard wand sich aus Peters Klammergriff. »Da haben Sie was verwechselt. Ich bin kein Detektiv.«
»Ach, natürlich sind Sie das! Sie recherchieren den ganzen Tag! Sie stöbern Sachen in Kellern auf, von denen kein Mensch je etwas geahnt hätte! Sie sind ein Detektiv.«
»Da gibt es bessere als mich. Echte.«
Peter schüttelte den Kopf, und man sah ihm den heftigen Impuls an, Richard abermals zu packen, um ihn zur Not körperlich zur Hilfe zu zwingen. Doch dann tätschelte er nur Richards Schulter. »Nein«, sagte er. »Ich will keinen, der sonst bloß Scheidungsermittlungen macht, das ist nicht das Richtige für Gunni. Sie müssen mir helfen. Sie sind – eben Sie.«
»Nein.«
»Bitte.«
»Das kann ich nicht.«
»Sie können es versuchen.«
»Ich habe kein Auto.«
Peter stutzte. »Sie haben kein Auto?«, wiederholte er, als hätte Richard gestanden, er habe nie lesen gelernt.
»Und ich kann auch nicht Auto fahren«, setzte Richard obendrauf.
Peter rückte näher. Sein Blick war tief und misstrauisch. »Wieso können Sie nicht Auto fahren?«
»Ist besser für meine Energiebilanz.« Richard hob die Achseln. »Denken Sie nur an den CO2-Ausstoß.« Beim CO2 zuckte Peter zurück. Oh, sorry, dachte Richard, aber du hast gefragt. Die Antwort hast du gewollt, und wenn dein Gunni hundert Mal an Kohlendioxidvergiftung gestorben ist. »Verzeihen Sie«, bat er nicht sehr reumütig.
»Zehntausend Euro plus Spesen«, erwiderte Peter kühl, und nun war es Richard, der zuckte.
»Nach allem, was ich über Detektive weiß, leben die praktisch in ihren Autos«, sagte er zögernd.
Peter beugte sich vor und brachte sein Gesicht dicht vor Richards. »Ich will Ihren Kopf, nicht Ihre Füße. Beziehungsweise Räder, na Sie wissen schon. Sonst würde ich mir aus dem Telefonbuch die nächste Detektei raussuchen lassen. Und Sie können doch sicher Rad fahren?«
»Natürlich.«
»Das muss dann eben reichen. Zur Not nehmen Sie ein Taxi.«
»Sie machen sich eine falsche Vorstellung von mir.«
»Die Zehntausend meine ich übrigens netto.«
Richard schluckte. Trotzdem, es ging nicht. Das war unmöglich. Er war Historiker, Wissenschaftler, Beschaffer, wenn man so wollte, aber doch nur, wenn es antike Artefakte betraf! Ein Lohnschnüffler war er nicht! Außerdem würde er als Allererstes Steenbergens Beziehung zu Peter aufarbeiten müssen, wenn er den Auftrag annahm, und das wäre wirklich das Letzte. Ausgeschlossen, dass er sich da in irgendeiner Weise engagierte. Richard verschränkte die Arme und schlug die Beine übereinander.
Peter lauerte ihn vom Fenster aus mit schmalen Augen an. »Außerdem verzichte ich dann darauf«, sagte er betont boshaft, »Gunnis Atlantis-Aufsatz, in dem er Sie lobend als wissenschaftlichen Berater erwähnt, postum in Esoterik leben erscheinen zu lassen. Obwohl der Chefredakteur ein ganz lieber Freund ist und mich stündlich bestürmt, das Dokument freizugeben.«
»Was?!« Mit einem einzigen Ruck hatte Richard sich entknotet und erhoben.
Peter blickte trotzig. »Ach! Gunni war ein Abenteurer im Geiste. Das wissen Sie doch! Er hat einen wunderbaren Atlantis-Aufsatz verfasst, in dem er auf Ihre Recherche, lieber Richard, wahre Lobreden singt. Im Grunde genommen ist es meine Pflicht als sein bester Freund und Nachlassverwalter, dieses Vermächtnis unverändert zu veröffentlichen, auch wenn es ein schiefes Licht auf Sie als Wissenschaftler wirft. Das müssen Sie dann eben erdulden.« Sprach es und hob sein Kinn und befand sich plötzlich direkt vor Richard. Der merkte, dass er selbst sich dem Anwalt genähert hatte. Was ein Fehler gewesen war, denn Peter schenkte ihm nun einen Blick, der ebenso durchtrieben wie traurig war und der eigentlich nur mit einer Ohrfeige beantwortet werden konnte. Oder mit –
»Sie gemeiner Erpresser!«, fauchte Richard und dachte sofort, dass es nicht wahr sein konnte, dass er so etwas tatsächlich gesagt hatte, er klang ja wie ein viktorianisches Fräulein.
Peter drehte sich zum Fenster. »Er war mein Freund. Und es macht mich rasend, dass alle Welt sich so über seinen Tod freut. Wir alle benutzen fossile Brennstoffe, nicht wahr, aber wenn ein ENERGIE-Manager an Kohlendioxidvergiftung stirbt, dann findet das plötzlich jedermann wahnsinnig lustig. Und nicht mal klammheimlich. Ich könnte Ihnen Pamphlete zeigen –« Er griff nach dem Zeitungsstapel und begann zu blättern.
Richard räusperte sich. »Klar. Doppeltes Feindbild.« Unauffällig brachte er sich außer Reichweite des Anwalts. »Manager und Energiekonzern.«
Peter ließ von den Zeitungen ab, doch sah nicht auf. »Ich weiß, dass Sie Geld brauchen«, sagte er leise. »Sie müssen sich mit zweifelhaften Privatkunden abgeben. Sie sind pleite.«
Richard schwieg. Das war leider absolut richtig.
»Und jetzt mal ganz im Ernst: Dieser Mörder ist sicher leichter zu finden als – Atlantis. Das haben Sie sich ja auch irgendwie zugetraut, nicht wahr? Also schlage ich vor, wo Sie gerade nichts zu tun haben, finden Sie den Kerl und verdienen etwas Geld damit.«
»Dr. Steenbergens Mörder ?«
»Ja.«
Richard schüttelte den Kopf. »Fünfzehntausend«, hörte er sich dann fordern.
»Im Erfolgsfall«, erwiderte Peter und reichte Richard die Rechte. Erfolgsfall, dachte der grimmig, während er die warme Hand ergriff und drückte. Da seh ich die Kohle eh nie.
Die tüchtige Valeska trat dann doch noch in Aktion: Sie hatte ihm ein Dossier zusammengestellt. Sie bot Richard sogar ein Büro an, ganz selbstverständlich: Wenn Sie keine Flatrate haben oder schnelles Internet zum Recherchieren, dann können Sie gerne hier bei uns, sehen Sie mal, das ist eins von unseren freien Arbeitszimmern, und es ist sicher auch bequemer für Sie als in Ihrer Privatwohnung. Sie standen in einem hohen Zimmer mit Schreibtisch, über dem eine Collage in kreidigem Gelb hing, das Bild eines endlosen Sommers, es war perfekt. Als wäre ein Mitarbeiter der Kanzlei heimlich bei ihm zu Hause gewesen und hätte erspäht, dass Richard eine neue Perspektive in seiner Arbeitsorganisation brauchte. Und das bedrückte ihn, denn irgendwie hing da noch viel mehr Perfektion in der Luft, Düfte nach gutem Leben, echter Lavendelpolitur, dem originalen alten Haus, nach richtigen Bäckerbrötchen und einer gerechten Welt. Hier roch es so, wie es nie gewesen war, er musste hier raus.
»Vielen Dank«, sagte er, »aber ich besitze ein Büro.«
»Natürlich«, sagte Valeska verständnisvoll und reichte ihm das Dossier, eine adrette Pappmappe mit CD-Fach, fest eingeklemmten Schlüsseln und allen möglichen Papieren drin. »Das ist selbstverständlich nur ein Vorschlag. Sie können auch später noch darauf zurückkommen.«
»Danke«, sagte Richard.
Valeska lächelte, so professionell, dass es richtig sympathisch wirkte. »Bis bald«, sagte sie.
Richard versuchte, all die Perfektion abzuschütteln, indem er die Mappe unverzüglich ins Vladi trug. Das Vladi Rockstock war eine Kneipe, die wie er aus alten Zeiten übrig geblieben war, eine abgefuckte alte Spelunke in einem abgefuckten alten Haus, das aber einst recht schmuck und bürgerlich ausgesehen hatte, mit einem geschwungenen Treppenhaus mitten in der verrußten Gaststube und einem zugewucherten Hof, in dem man neben einem Graffito von Led Zeppelin an der Mauer Frühstück aus hartgekochten Eiern und Aldi-Croissants zu sich nehmen konnte. Um diese Zeit war nicht viel los. Die Bedienung war mindestens zwanzig Jahre jünger als Richard. Er setzte sich in den Hof, auf einen Stuhl, der in einem riesigen taufeuchten Grasbüschel stand, und bestellte einen chat noir, das war grauenvoller französischer Kaffee mit einer Kanne heißer Milch dabei.
»Was?«, fragte die Bedienung.
»Chat noir«, wiederholte Richard, er dachte, die junge Frau hätte nicht verstanden.
»Wein haben wir nur roten oder weißen«, zählte die Bedienung auf.
Richard seufzte. Er war länger nicht mehr hier gewesen. Fast ein Jahr, um genau zu sein. »Kaffee, bitte.«
»Oh«, sagte sie. »Klar. Was zu Essen dazu?«
»Eine Kanne heiße Milch.«
Das Mädchen warf ihm einen seltsamen Blick zu, zuckte dann die Achseln und sagte: »Alles klar.« Und ging mit wackelndem Hintern zurück ins Haus.
Richard bekam einen perfekten Kaffee mit leichter Crema obendrauf, nicht zu bitter, nicht zu dünn, aromatisch duftend, heiß, doch nicht kochend, perfekt eben, aber nun wusste er nicht mehr, was er mit der Milch machen sollte. In den Kaffee schütten war unmöglich, nicht trinken Verschwendung, doch pur schmeckte sie ihm nicht. Also sah er ziemlich ärgerlich zu, wie sie langsam kalt wurde, und studierte an dem wackelnden Tisch (wenigstens das Wackeln hatten sie gelassen) das perfekte Leben von Gunter Steenbergen. Es war eine von diesen atemberaubenden Karrieren, für die ein Normalo mindestens neun Leben braucht: Studium in Regelstudienzeit, Doktor in anderthalb Jahren, verschiedene Stellen nur in solventen Instituten, noch ein Doktortitel nebenbei für irgendein halbkommerzielles Forschungsprojekt, und dann: Umweltmanager einer der größten CO2-Emittendinnen Europas. Richard bestellte sich einen weiteren Kaffee.
Natürlich war es eine Frechheit, von ihm zu verlangen, dem Herrn ENERGIE-Doppeldoktor zu helfen, auch wenn der jetzt bemitleidenswert tot war. Zumal er obendrein vorgehabt hatte, Richards wissenschaftlichen Ruf einer albernen Veröffentlichung in Esoterik leben zu opfern. Doch seltsamerweise brachte ausgerechnet der Atlantis-Artikel Richard dazu, Steenbergen letztlich doch irgendwie menschlich zu finden. Er schob die fünf Druckseiten auf dem Tisch herum, und da lagen sie dann mit einem Mal neben der nutzlosen Milchkanne, weit weg vom Riesenpapierstapel mit Steenbergens Erfolgen und Eroberungen. Der Schrieb war kompletter Unfug, nicht wegen der Theorie (Atlantis im Atlantik), sondern weil es müßig war, Atlantis überhaupt zu suchen, das war kein wissenschaftliches Thema. Es war ein Loser-Thema. Leute, in deren Leben etwas fehlte, suchten nach Atlantis. Richard starrte auf die Milchkanne. Deren Inhalt war nun kalt. Ein Regentropfen setzte sich rund und glänzend auf den Deckel, ein weiterer folgte. Warum vermisste er bloß den ollen chat noir, der doch wirklich kaum trinkbar gewesen war?
Was hatte in Gunter Steenbergens Leben gefehlt?
Richard erhob sich und beschloss, es herauszufinden.
Steenbergen hatte eine Tochter gezeugt, als er achtzehn war, mit neunzehn hatte er geheiratet und mit zweiundzwanzig wurde er geschieden. Im März war er siebenundvierzig geworden. Richard wälzte diese Daten in seinem Kopf, während er sein Fahrrad in die Stadtbahn schob. Steenbergens Haus, das Richard besichtigen wollte, lag im Kölner Süden, in Bayenthal, das war ein Stück, und da es regnete, nahm er die Fahrt in der überfüllten Bahn auf sich. Eine junge Mutter mit nassem Kinderwagen musterte missbilligend sein sperriges Rad, er schob es, so gut es ging, aus der Reichweite ihres Sohnes. Kevin, lass dat Rad von dem Mann. Diese Worte waren allein an Richard gerichtet und sagten eigentlich: Was willst du, Öko-Opa, mit deinem blöden Fahrrad in unserer Bahn, deine Zeit ist vorbei, kannst du nicht endlich Auto fahren wie die anderen und hier Platz machen für Leute, die ihn ehrlich brauchen. Richard seinerseits fand Kevin zu alt für den Kinderwagen, wenn Mama auf den Wagen und den unhandlichen Regenschutz verzichtete und Kevin laufen ließe, wäre es weit weniger eng hier und Kevin vielleicht auch nicht so dick, Mama gib misch de Flasch. Nä Kevin, dat heißt nit, gib misch de Flasch. Dat heißt, gib misch de Flasch BITTE.
Tja, ein supererfolgreiches Familienleben hatte Steenbergen nicht gehabt, aber immerhin: ein Kind, eine Frau. Manche der Besten und Tapfersten erreichten nicht mal das. Schließlich waren selbst Kevin und seine Mama vielleicht Schicksal und Lebensinhalt für irgendwen. Richard stellte sich vor, mit dieser blondgefärbten, kräftig geschminkten jungen Frau liiert zu sein. Es fiel ihm nicht leicht. Dann versuchte er sich vorzustellen, eine knapp dreißigjährige Tochter zu haben, das kriegte er gar nicht hin. Steenbergens Tochter war fast dreißig, und Kevins Mama schien höchstens so alt. Was würde diese Frau tun, wenn ihr Vater starb? Ein Jahr in Schwarz gehen? Auf seinem Grab tanzen, weil er sich nie um sie gekümmert hatte? Sie würde erben, dachte Richard. Er hatte Steenbergens Kontoauszüge gesehen. Sie würde in das Haus ziehen und das Bankkonto plündern und sich einen neuen Kinderwagen kaufen. Einen knallroten mit hundertzehn PS.
Als er dann etwas später in der Bernhardis-Straße stand, einer angenehm ruhigen Gegend, wo die Kinder vermutlich Alexander und Julia und Benjamin hießen, da fragte er sich, wer Steenbergen eigentlich beerben würde. Vermutlich die Tochter. Natürlich, das stand hier im Dossier, Steenbergen hatte eine Art Konzept-Testament hinterlassen, einen kleinen Schrieb, in dem er alles der Tochter vermachte, Richard hatte das Dokument zuvor im Vladi übersehen, weil es so kurz war. Nun hantierte er mit einem Stapel rutschender Papiere in Steenbergens Straße und stützte sein Fahrrad mit der Hüfte und war wieder einmal das Chaos in Person, die wandelnde Slapsticknummer: Niemandem außer ihm würde es einfallen, vor einem fremden Garten neben einem ständig wegrollenden Fahrrad im Nieselregen eine Mappe mit wichtigen losen Blättern auszupacken und durchzusehen. Schließlich schaffte er es aber, alles sorgfältig zu parken, das Fahrrad am nächsten Laternenpfahl, die Papiere in seiner Tasche. Dann versuchte er, Steenbergens Haus auszumachen. Doch hier stand weit und breit nichts Großes und Protziges. Schließlich merkte Richard, dass er an der Hausnummer siebzehn, die er suchte, glatt vorbeigegangen war. Beschämt kehrte er um und stoppte vor einer kleinen weißen Häusergruppe mit langen Fensterbändern und einer mächtigen alten Schlingpflanze, die sich über alle Eingänge zog. 17c suchte er, das war das dritte in der Reihe. Es war auch das einzige Haus der Gruppe ohne Kranz an der Tür, und aus irgendeinem Grund stimmte Richard das froh. Der gute alte Steenbergen. In seinem Vorgarten duftete, blühte, summte und zierte sich nichts, da stand nur alter Buchs, streng und knorrig, und eine Holzbank auf hellen Travertin-Platten. Am liebsten hätte Richard sich erst mal hingesetzt und die Gegend betrachtet, doch diese Gegend hatte viele Fenster und wirkte etwas lauernd im regenfeuchten Sommernachmittag. Herumtrödeln sollte er auch nicht. Also kramte er den Schlüssel aus dem Dossier hervor und steckte ihn ins Schloss. Und dann sah er sich plötzlich unwillkürlich um. Ein Auto fuhr hinter ihm vorbei, es nieselte wieder, Passanten waren nicht unterwegs. So etwas hatte er noch nie gemacht. Mit einem sehr unguten Gefühl öffnete Richard die Tür zum Privatleben des Verstorbenen, spähte ins dumpfe Zwielicht des Vorraums und trat ein.