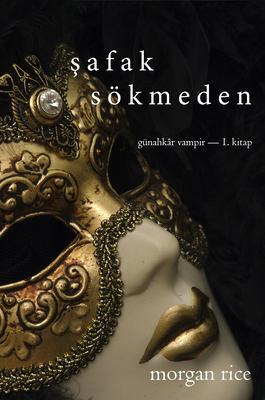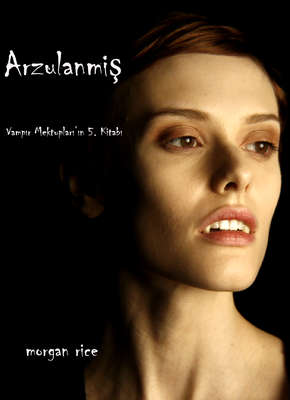Kitabı oku: «Der Aufstand Der Drachen », sayfa 6
KAPITEL SIEBEN
Kyra saß in der Kammer ihres Vaters, einem kleinen Raum im oberen Stock der Festung mit einem hohen Deckengewölbe und einem marmornen Kamin, der von jahrelanger Nutzung schwarz geworden war. Sie saßen einander gegenüber auf Stapeln von Fellen und sahen einander in der erdrückenden Stille des Raumes an, die nur vom Prasseln des Feuers unterbrochen wurde.
Kyras Gedanken kreisten um die Nachricht während sie Leo streichelte, der zu ihren Füssen zusammengerollt war, und sie konnte es immer noch kaum fassen. War der Wandel schließlich doch nach Escalon gekommen. Sie hatte das Gefühl, dass mit der Nachricht ihr Leben geendet hatte. Sie starrte in die Flammen und fragte sich, wofür sie noch leben sollte, wenn Pandesia sie ihrer Familie entriss, ihrem Fort, allem, was sie kannte und liebte und sie mit irgendeinem alten Lord Regenten verheiratete. Lieber würde sie starben.
Normalerweise fand Kyra Trost darin, hier, in diesem Raum zu sein, wo sie zahllose Stunden beim Lesen zugebracht hatte, und sich in Geschichten von Tapferkeit und alten Legenden verloren hatte. Ihr Vater hatte ihr hier oft aus seinen alten Büchern vorgelesen, manchmal bis zum nächsten Morgen – Chroniken von anderen Zeiten und fremden Orten. Am meisten liebte Kyra seine Geschichten von Kriegern und großen Schlachten. Leo lag immer zu ihren Füssen und Aidan leistete ihnen oft Gesellschaft; es kam oft vor, dass Kyra bei Sonnenuntergang mit müden Augen in ihre Kammer zurückkehrte, trunken von all den Geschichten.
Sie liebte das Lesen sogar noch mehr als ihre Waffen, und sie betrachtete die Bücherregale an den Wänden, die voller Schriftrollen und ledergebundener Bücher lagen, die über Generationen vererbt worden waren und wünschte sich, sich auch jetzt wieder in die Geschichten flüchten zu können.
Doch als sie ihren Vater ansah, sein grimmiges Gesicht, brachte es die furchtbare Realität zurück. Das war keine Nacht, in der sie gemeinsam lesen würden. Sie hatte ihren Vater nie so aufgewühlt, so hin und hergerissen gesehen. Zum ersten Mal schien er nicht zu wissen, was er tun sollte. Ihr Vater war ein stolzer Mann, genau wie seine Männer, das wusste sie, und in jenen Tagen, als Escalon noch einen König hatte, eine Hauptstadt und einen Hof, wo sich alle versammeln konnte, hätten sie alle ihr Leben für die Freiheit gegeben. Ihr Vater war nicht jemand, der kapitulierte oder handelte. Der alte König hatte sie verkauft, in ihrem Namen kapituliert, und sie in einer schrecklichen Situation zurückgelassen. Als zersplitterte, führerlose Armee konnten sie nicht gegen einen Feind kämpfen, der sich bereits unter ihnen breitgemacht hatte.
„Es wäre besser gewesen, an jenem Tag in einer Schlacht geschlagen worden zu sein“, sagte ihr Vater mit trauriger Stimme. „Wir hätten uns Pandesia stolz stellen sollen – selbst wenn wir verloren hätten. Die Kapitulation des Königs hat unsere Niederlage besiegelt – eine lange, grausame Niederlage. Tag um Tag, Jahr um Jahr wird uns eine Freiheit nach der anderen genommen, und damit unsere Männlichkeit.“
Kyra wusste, dass er Recht hatte – doch sie konnte König Tarnis Entscheidung auch verstehen: das pandesische Reich umfasste die halbe Welt. Mit ihrer riesigen Sklavenarmee hätten sie Escalon in Schutt und Asche gelegt. Sie hätten nie aufgegeben, egal wie viele Männer sie dabei verloren hätten. Zumindest war das Land unversehrt geblieben und die Menschen am Leben – wenn man das noch Leben nennen konnte.
„Für sie geht es nicht darum, unsere Mädchen zu nehmen“, fuhr ihr Vater fort. „Es geht um Macht. Um Unterwerfung. Um das, was noch von unserem Kampfgeist übrig ist, zu vernichten.“
Duncan starrte in die Flammen und sie spürte, dass sein Blick gleichzeitig in die Vergangenheit und in die Zukunft gerichtet war. Kyra betete, dass er sich ihr zuwenden würde, und ihr sagen würde, dass die Zeit zu Kämpfen gekommen war, die Zeit, in der sie alle für das, an was sie glaubten aufstehen mussten; dass er nie zulassen würde, dass sie sie holten.
Doch stattdessen, zu ihrer wachsenden Enttäuschung und Wut, saß er schweigend da, starrte in die Flammen und grübelte, ohne ihr die Zuversicht zu geben, die sie brauchte. Sie hatte keine Ahnung, was er dachte, besonders nicht nach ihrem Streit vorhin.
„Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich dem König gedient habe“, sagte er langsam, und seine tiefe, starke Stimme tröstete sie, wie sie es immer getan hatte, „als das Land eins war. Escalon war unbesiegbar. Alles, was wir tun mussten, war die Flammen zu bewachen, um die Tolle fernzuhalten, und das Südliche Tor, um Pandesia abzuwehren. Jahrhundertelang waren wir ein freies Volk, und so hatte es immer sein sollen.“
Er schwieg eine ganze Weile, und während Kyra Leos Kopf streichelte und dem Knistern des Feuers lauschte, wartete sie ungeduldig darauf, dass er fortfuhr.
„Wenn Tarnis uns befohlen hätte, das Tor zu verteidigen“, sagte er, „hätten wir es bereitwillig bis zum letzten Mann verteidigt. Wir alle wären gerne für die Freiheit gestorben. Doch eines Morgens sind wir aufgewacht, und haben unser Land voller Fremder vorgefunden“, sagte er, und in seinen Augen spiegelte sich sein Schmerz wider.
„Ich weiß dass alles“, sagte Kyra ungeduldig, müde, immer die gleiche Geschichte zu hören.
E wandte sich ihr zu und sah sie niedergeschlagen an.
„Unser eigener König hat aufgegeben“, sagte er, „der Feind ist bereits mitten unter uns. Was ist dann noch übrig, wofür es sich zu kämpfen lohnt?“
Kyra kochte vor Wut.
„Vielleicht verdienen nicht alle Könige ihren Titel“, sagte sie. Ihre Geduld war aufgebraucht. „Schließlich sind Könige auch nur Menschen. Und Menschen machen Fehler. Vielleicht ist manchmal der ehrenhafteste Weg, sich seinem König zu widersetzen.“
Ihr Vater seufzte, starrte ins Feuer. Er hatte ihr gar nicht richtig zugehört.
„Wir hier in Volis, wir haben gut gelebt, verglichen mit dem Rest von Escalon. Sie haben uns erlaubt, unsere Waffen zu behalten – echte Waffen – anders als die anderen, die unter Androhung von Todesstrafe keinen Stahl besitzen dürfen. Sie lassen uns trainieren, sie geben uns die Illusion der Freiheit – gerade genug, um uns bei Laune zu halten. Weißt du warum?“, fragte er.
„Weil du der beste Ritter des Königs warst“, antwortete sie. „Weil sie dir die Ehre zukommen lassen wollen, derer du würdig bist.“
Er schüttelte den Kopf.
„Nein“, antwortete er. „Nur, weil sie uns brauchen. Sie brauchen Volis, um die Flammen zu bewachen. Wir sind alles, was zwischen ihnen und Marda steht. Pandesia fürchtet Marda mehr als wir. Es ist nur, weil wir die Hüter sind. Sie patrouillieren die Flammen mit ihren eigenen Männern, mit ihren eigenen Wehrpflichtigen, doch sie sind lange nicht so wachsam wie wir.“
Kyra dachte darüber nach.
„Ich dachte immer, dass wir über allem stehen, außerhalb von Pandesias Reichweite sind. Doch heute Nacht“, sagte er ernst und sah sie dabei an, „habe ich begriffen, dass das nicht stimmt. Diese Nachrichten… Ich habe schon seit Jahren mit so etwas gerechnet. Und trotz all dieser Jahre, jetzt, wo sie gekommen sind… kann ich nichts dagegen tun.“
Er ließ den Kopf hängen. Sie starrte ihn entsetzt an und spürte, wie der Zorn in ihr Hochkochte.
„Soll das heißen, dass du zulassen wirst, wenn sie kommen und mich holen?“, fragte sie. „Willst du damit sagen, dass du nicht für mich kämpfen würdest?“
Seine Miene wurde finster.
„Du bist jung“, sagte er wütend. „Naiv. Du verstehst die Welt nicht. Du siehst nur diesen einen Kampf – nicht das ganze Königreich. Wenn ich für dich kämpfe, wenn meine Männer für dich kämpfen, gewinnen wir vielleicht eine Schlacht. Doch sie werden zurückkommen. Nicht mit hundert Männern, oder mit tausend Männern, oder Zehntausend – sondern einem Meer von Männern. Wenn ich für dich kämpfe, führe ich meine Leute in den sicheren Tod.“
Seine Worte trafen sie wie ein Dolchstoß, ließen sie innerlich erzittern – nicht nur seine Worte, sondern auch die Verzweiflung, die in ihnen lag. Ein Teil von ihr wollte aus der Kammer stürmen, so enttäuscht war sie von dem Mann, der einmal ihr Idol gewesen war. Sie wollte weinen über diesen Verrat.
Sie stand zitternd auf und sah böse auf ihn herab.
„Du“, zischte sie, „du, der größte Kämpfer unseres Landes – hat Angst die Ehre deiner eigenen Tochter zu schützen?“
Sie sah zu wie er vor Demütigung errötete.
„Pass auf was du sagst“, warnte er sie.
Doch Kyra hatte nicht vor, nachzugeben.
„Ich hasse dich!“, rief sie.
Jetzt stand er auf.
„Willst du etwa, dass all unsere Leute sterben?“, schrie er zurück. „Für deine Ehre?“
Kyra konnte nicht anders. Zum ersten Mal seit sie denken konnte, brach sie in Tränen aus, so verletzt war sie davon, dass ihr Vater sie hintenan stellte.
Er ging auf sie zu, um sie zu trösten, doch sie senkte den Kopf und wandte sich ab. Dann fasste sie sich wieder, wischte schnell die Tränen ab und drehte sich um und blickte mit feuchten Augen in die Flammen.
„Kyra“, sagte er sanft.
Sie blickte zu ihm auf und sah, dass auch seine Augen wässrig wurden.
„Natürlich würde ich für dich kämpfen“, sagte er. „Ich würde für dich kämpfen, bis mein Herz aufhört zu schlagen. Ich und alle meine Männer würden für dich sterben. Doch in dem Krieg, der dadurch ausbrechen würde, müsstest auch du sterben. Willst du das etwa?“
„Und dass ich die Sklavin eines Pandesiers werde?“, schoss sie zurück. „Ist das etwas das, was du willst?“
Kyra wusste, dass sie egoistisch war, dass sie sich an erste Stelle setzte, und das entsprach nicht ihrer Natur. Natürlich würde sie nie zulassen, dass irgendjemand für sie starb. Doch sie wollte es von ihrem Vater hören. Sie wollte hören, dass er sagte: Ich werde für dich kämpfen, egal was geschieht. Du stehst an erster Stelle. Du bist mir am wichtigsten.
Doch er schwieg, und die Stille schmerzte mehr als alles andere.
„Ich werde für dich kämpfen!“, hörte sie eine Stimme.
Kyra drehte sich überrascht um, und sah Aidan, der den Raum betrat. Er hielt einen kurzen Speer in seinen Händen und hatte eine tapfere Miene aufgesetzt.
„Was willst du hier?“, herrschte Duncan ihn an. „Ich spreche mit deiner Schwester.“
„Und ich habe alles gehört!“, sagte Aidan, während Leo ihn freudig begrüßte und ihm die Hände ableckte.
Kyra musste lächeln. Aidan war genauso trotzig wie sie, selbst wenn er noch zu jung war, als dass sein Können seiner Willensstärke folgen konnte.
„Ich kämpfe für meine Schwester!“, fügte er hinzu. „Selbst gegen alle Trolle von Marda!“
Sie legte ihm den Arm um die Schulter und küsste ihn auf die Stirn.
Dann wischte sie ihre Tränen ab und wandte sich mit finsterem Blick wieder ihrem Vater zu. Sie brauchte eine Antwort. Sie musste es von ihm hören.
„Bin ich dir nicht wichtiger als deine Männer?“, fragte sie.
Er starrte sie mit schmerzerfülltem Blick an.
„Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Welt“, sagte er. „Doch ich bin nicht einfach nur ein Vater – ich bin ein Anführer. Meine Männer unterliegen meiner Verantwortung. Kannst du das nicht verstehen?“
Sie verzog das Gesicht.
„Und wo ziehst du die Grenze, Vater? Wann genau sind dir deine Leute wichtiger als deine Familie? Wenn die Entführung deiner einzigen Tochter nicht diese Grenze darstellt, was dann? Ich bin sicher, wenn sie einen deiner Söhne holen würden, dann würdest du in den Krieg ziehen.“
Er sah sie böse an.
„Darum geht es nicht.“
„Nein?“, schoss sie entschlossen zurück. „Warum ist das Leben eines Jungen mehr wert als das eines Mädchens?“
Ihr Vater kochte vor Wut, atmete schwer, und öffnete seine Weste. Er war aufgebrachter, als sie ihn je gesehen hatte.
„Es gibt einen anderen Weg“, sagte er schließlich.
Sie sah ihn irritiert an.
„Morgen“, sagte er langsam, und seine Stimme klang dabei wieder autoritär, als spräche er mit seinen Beratern. „Morgen wirst du einen Jungen auswählen. Einen Jungen aus unserem Volk den du magst. Bei Sonnenuntergang werdet ihr heiraten. Und wenn die Männer des Lords kommen, bist du vermählt. Unantastbar. Du wirst sicher sein, hier bei uns.“
Kyra starrte ihn sprachlos an.
„Erwartest du wirklich von mir, dass ich irgendeinen fremden Jungen heirate?“, fragte sie. „Einfach einen auswähle? Einfach so? Jemanden, den ich nicht liebe?“
„Das wirst du tun!“, schrie ihr Vater mit hochrotem Gesicht. „Wenn deine Mutter noch am Leben wäre, hätte sie sich um diese Angelegenheit gekümmert – sie hätte es schon vor langer Zeit geregelt. Doch sie ist nicht hier. Und du bist kein Krieger. Du bist ein Mädchen. Und Mädchen heiraten. Wenn du bis zum Ende des Tages keinen Gemahl ausgewählt hast, dann werde ich es tun. Und damit ist das Thema beendet!“
Kyra sah ihn an. Sie war angewidert und wütend – doch am schwersten wog die Enttäuschung.
„So gewinnt also der große Kommandant Duncan seine Schlachten?“, fragte sie. Sie wollte ihn verletzen. „Dadurch, dass er Schlupflöcher in den Gesetzen findet, um sich vor seinen Besatzern zu verstecken?“
Kyra wartete nicht auf eine Antwort. Sie stürmte mit Leon aus dem Raum und schlug die Tür hinter sich zu.
„KYRA!“, schrie ihr Vater – doch die Tür dämpfte seine Stimme.
Kyra marschierte den Flur hinunter. Sie hatte das Gefühl, den Boden unter den Füssen zu verlieren. Mit jedem Schritt wurde ihr klarer, dass sie nicht länger hier bleiben konnte. Ihre Anwesenheit brachte alle in Gefahr, und das konnte sie nicht zulassen.
Kyra konnte die Worte ihres Vaters nicht fassen. Sie würde niemals jemanden heiraten, den sie nicht liebte. Sie würde nicht aufgeben, und ein Leben am Herd führen, wie all die anderen Frauen. Lieber würde sie sterben. Wusste er das nicht? Kannte er seine eigene Tochter nicht?
Kyra ging in ihre Kammer, schlüpfte in ihre Stiefel, zog ihre wärmsten Felle an, nahm ihren Bogen und Stab und ging.
„KYRA!“ Die wütende Stimme ihres Vaters hallte durch den Flur.
Sie würde ihm nicht die Gelegenheit geben, sie einzuholen. Sie ging weiter durch die Flure, entschlossen, Volis zu verlassen und nie wieder zurückzukehren. Was auch immer da draußen lag, sie würde sich der Welt stellen. Vielleicht würde sie sterben, das wusste sie – doch zumindest war es ihre Wahl, Zumindest würde sie nicht nach den Vorschriften anderer leben müssen.
Kyra erreichte mit Leo das Haupttor des Forts, und die Diener die unter den sterbenden Fackeln standen sahen sie erstaunt an.
„Mylady“, sagte einer. „Es ist spät und da draußen tobt noch immer der Sturm.“
Doch Kyra sah ihn entschlossen an. Die Diener tauschten unsichere Blicke aus, dann öffneten sie langsam die schwere Tür.
Im selben Augenblick schlug ihnen heulend eine eiskalte Windbö ins Gesicht, begleitet von dicken Flocken. Kyra zog ihren Umhang fester um die Schultern, als sie sah, dass der Schnee vor dem Tor ihr bis zu den Waden reichte.
Sie trat hinaus. Sie wusste, dass es draußen in der Nacht nicht sicher war: der Wald war voller gefährlicher Kreaturen, voller Verbrecher, und manchmal drangen sogar Trolle bis hierher vor; besonders heute Nacht, in der Nacht des Wintermondes, der eines Nacht des Jahres, in der man nicht hinausgehen sollte – in der die Toten zwischen den Welten wandelten und alles geschehen konnte. Kyra blickte zum Himmel auf und sah den riesigen blutroten Mond am Horizont, der sich über sie lustig zu machen schien.
Sie atmete tief durch, machte einen ersten Schritt und verschwand ohne sie noch einmal umzudrehen in die Nacht.
KAPITEL ACHT
Alec saß in der Schmiede seines Vaters. Vor ihm stand der große eiserne Amboss, der von all den Jahren, die er im Gebrauch war voller Dellen war. Er hob seinen Hammer und schlug auf den glühenden Stahl eines Schwertes ein, das er gerade aus den Flammen gezogen hatte. Er war frustriert. Schwitzend, versuchte er sich den Frust von der Seele zu hämmern. Mit gerade mal sechzehn Jahren war er kleiner als die meisten Jungen seines Alters, doch er war stärker. Er hatte breite Schultern und seine Muskeln waren bereits wohl definiert. Schwarze Locken fielen ihm über die Augen. Alec war niemand, der einfach so aufgab. Sein Leben war schwer gewesen – geschmiedet, wie dieses Eisen, und während er neben den Flammen saß und sich die Haare aus dem Gesicht wischte, dachte er über die Nachrichten nach, die ihn gerade erreicht hatte. Noch nie war er so verzweifelt gewesen. Er schlug immer wieder mit dem Hammer zu, und der Schweiß rann ihm über die Stirn und tropfte zischend auf das Schwert. Er wollte alle seine Sorgen weghämmern.
Sein ganzes Leben lang hatte Alec die Kontrolle gehabe, hatte gearbeitet so hart es nötig war, um es zu schaffen. Doch jetzt musste er zum ersten Mal in seinem Leben dasitzen und zusehen, wie die Ungerechtigkeit in sein Dorf und seine Familie Einzug hielt – und er konnte nichts dagegen tun.
Alec hämmerte immer weiter, das Singen des Metalls klang in seinen Ohren und der Schweiß brannte in seinen Augen, doch es war ihm egal. Er wollte dieses Eisen schlagen, bis nichts mehr übrig war, und mit jedem Schlag dachte er nicht an das Schwert, sondern an Pandesia. Er würde sie alle töten, wenn er könnte, diese Invasoren, die kommen würden, um seinen Bruder zu holen. Alec schlug auf das Schwert ein und stellte sich dabei vor, dass es ihre Köpfe waren. Er wünschte sich, mächtig genug zu sein, um alleine gegen Pandesia aufzustehen.
Heute, der Tag des Wintermondes, war der Tag, den er am meisten verabscheute, der Tag an dem Pandesia alle Dörfer in ganz Escalon durchsuchten und alle Jungen im Alter von 18 Jahren zum Dienst an den Flammen einzusammeln. Mit 16 war Alec noch zwei Jahre zu jung dazu und damit sicher. Doch sein Bruder Ashton war im letzten Herbst 18 geworden und war an der Reihe. Warum ausgerechnet Ashton? fragte er sich. Ashton war sein Held. Obwohl er mit einem Klumpfuß zur Welt gekommen war, hatte Ashton immer ein Lächeln auf den Lippen, war immer gut gelaunt, und hatte immer das Beste aus seinem Leben gemacht. Er war das Gegenteil von Alex, der sich alles zu Herzen nahm und immer in einem Wirbelsturm von Gefühlen gefangen war. Egal wie sehr er sich bemühte glücklich wie sein Bruder zu sein, konnte Alec seine Leidenschaft nicht kontrollieren, und ertappte sich immer wieder beim Grübeln. Alle sagten, dass er das Leben viel zu ernst nahm; doch für ihn war das Leben eine schwere, ernste Angelegenheit, und er wusste nicht, wie er es leichter nehmen sollte.
Ashton dagegen, war ruhig, ausgeglichen und glücklich, trotz seiner Situation. Er war auch ein guter Schmied, wie ihr Vater und versorgte seit ihr Vater erkrankt war allein die Familie. Wenn sie Ashton holten, würde ihre Familie verarmen. Schlimmer noch. Es würde Alec zerstören, denn er hatte Geschichten gehört, dass das Leben eines Wehrpflichtigen seinen Bruder umbringen würde.
Mit Ashtons Klumpfuß wäre es grausam und gerecht, wenn die Pandesier ihn holen würden. Doch sie war nicht gerade bekannt für ihr Mitleid, und Alec fürchtete, dass er heute seinen Bruder zum letzten Mal sehen würde.
Sie waren keine reiche Familie in einem reichen Dorf. Ihr Haus war schlicht, ein kleines Häuschen, das an die Schmiede angrenzte am Rand von Soli, einen Tagesritt von der Hauptstadt und vom Süden von Whitewood gelegen. Es war eine friedliche Ortschaft inmitten von sanften Hügeln, weit ab von allem, ein Ort, den die meisten Leute auf dem Weg nach Andros ignorierten.
Die Familie hatte gerade genug zu Essen – und mehr wollten sie auch nicht. Sie nutzten ihre Fähigkeiten um Eisen zu bearbeiten, und das war gerade genug, um sich alles leisten zu können, was sie brauchten.
Alec hatte nicht viele Wünsche – doch er sehnte sich nach Gerechtigkeit. Er schauderte bei dem Gedanken, dass sein Bruder weggeholt werden würde, um Pandesia zu dienen. Er hatte zu viele Geschichten davon gehört, wie es war, eingezogen zu werden, und Wache an den Flammen zu schieben, die Tag und Nacht brannten und ein Hüter zu werden. Die pandesischen Sklaven, die die Flammen bemannten, waren harte Männer, Sklaven aus aller Welt, Wehrpflichtige, Verbrecher und die schlimmsten pandesischen Krieger. Die meisten von ihnen waren keine edlen Krieger aus Escalon, nicht die edlen Hüter aus Volis. Die größte Gefahr der Flammen, hatte Alec gehört, waren nicht die Trolle, sondern die anderen Hüter. Ashton würde sich nicht selbst schützen können; er war ein guter Schmied, doch er war kein Kämpfer.
„ALEC!“
Die schrille Stimme seiner Mutter hallte durch die Luft und übertönte sogar sein Hämmern.
Alec legte schwer atmend den Hammer nieder. Er hatte gar nicht bemerkt, wie sehr er sich verausgabt hatte und wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. Er drehte sich um und sah, wie seine Mutter mit missbilligendem Blick den Kopf durch die Tür steckte.
„Ich habe dich nun schon seit zehn Minuten gerufen!“, sagte sie streng. „Das Abendessen steht auf dem Tisch! Uns bleibt nicht mehr viel Zeit bevor sie kommen. Wir warten nur auf dich. Komm sofort rein!“
Alec erwachte aus seinen Grübeleien, stand widerwillig auf und zwängte sich an den Gerätschaften der Schmiede vorbei. Er konnte das Unausweichliche nicht länger aufschieben.
Er ging an der missmutig dreinblickenden Mutter vorbei zurück ins Haus. Vor dem Esstisch blieb er stehen: sie hatte das beste Geschirr hervorgeholt, doch das war nicht viel. In die Mitte des einfachen Holztischs, um den vier Stühle standen, hatte sie einen silbernen Kelch gestellt, das einzige Stück von Wert, das die Familie besaß.
Um den Tisch herum saßen sein Bruder und sein Vater, die Suppe bereits in den Schalen vor ihnen.
Ashton war groß und dünn und dunkel, während der Vater, der neben ihm saß, ein großer Mann war, doppelt so breit wie Alec, mit wachsendem Bauch, breiter Stirn, dicken Augenbrauen und den schwieligen Händen eines Schmieds. Sie sahen einander ähnlich, doch keiner ähnelte Alec, dessen störrisches schwarzes Haar und die grünen Augen denen seiner Mutter glichen.
Alec sah sie an und bemerkte sofort die Angst in den Augen seines Bruders und die Sorge im Blick seines Vaters. Beide Männer sahen aus, als wären sie auf einer Totenwache. Sein Magen zog sich zusammen, als er den Raum betrat. Als Alec am Tisch Platz nahm, stellte seine Mutter auch eine Schale Suppe vor ihm hin, und setzte sich schließlich selbst.
Auch wenn es schon spät war, und er normalerweise um diese Zeit am Verhungern war, konnte Alec den Geruch des Essens kaum ertragen.
„Ich habe keinen Hunger“, murmelte er in die Stille.
Seine Mutter warf ihm einen strengen Blick zu.
„Das ist mir egal“, herrschte sie ihn an. „Du isst, was dir vorgesetzt wird. Das ist vielleicht unser letztes gemeinsames Mahl – hab gefälligst Respekt vor deinem Bruder.“
Alec wandte sich seiner Mutter zu, einer hausbackenen Frau in den Fünfzigern. Ihr Gesicht hatte tiefe Falten von einem harten Leben, und er sah die Entschlossenheit in ihren grünen Augen flackern, dieselbe Entschlossenheit, die auch in seinem Blick lag.
„Sollen wir etwa tun, als würde nichts geschehen?“, fragte er.
„Ashton ist auch unser Sohn“, knurrte sie. „Du bist nicht der einzige hier.“
Alec wandte sich verzweifelt seinem Vater zu.
„Wirst du es zulassen, Vater?“
Der Vater verzog das Gesicht, doch er schwieg.
„Du ruinierst eine schöne Mahlzeit“, sagte seine Mutter.
Der Vater hob die Hand und sie verstummte, dann warf er Alec einen Blick zu.
„Was soll ich schon tun?“, fragte er mit ernster Stimme.
„Wir haben Waffen!“, beharrte Alex, der auf diese Frage gehofft hatte. „Wir haben Stahl. Wir gehören zu den wenigen, die Zugang dazu haben! Wir können jeden Krieger töten, der sich ihm auch nur nähert! Sie werden nie damit rechnen!“
Sein Vater schüttelte ablehnend den Kopf.
„Das sind die Träumereien eines Jungen“, sagte er. „Du, der du noch nie einen Mann getötet hast. Stell dir vor du tötest den Krieger der Ashton holen kommt – was ist mit den hundert anderen, die ihn begleiten?
„Dann verstecken wir Ashton einfach!“, beharrte Alec.
Sein Vater schüttelte den Kopf.
Sie haben Aufzeichnungen von jedem Jungen hier im Dorf. Sie wissen, dass er hier ist. Wenn wir ihnen Ashton nicht geben, werden sie jeden von uns töten.“ Er seufzte. „Denkst du etwa, dass ich nicht selbst schon daran gedacht habe? Denkst du etwa, du bist der einzige, dem es etwas ausmacht? Denkst du ich will, dass sie meinen einzigen Sohn mitnehmen?“
Alec hielt inne, verdutzt von seinen Worten.
„Dein einziger Sohn? Was meinst du damit?“, fragte er.
„Ich habe nicht einziger gesagt – ich habe ältester gesagt.“
„Nein, du hast einziger gesagt“, beharrte Alec.
Das Gesicht seines Vaters wurde rot und er hob seine Stimme.
„Höre auf darauf rumzureiten!“, schrie er. „“Nicht zu einer Zeit wie dieser. Ich habe ältester gesagt und damit Schluss! Ich will genauso wenig wie du, dass sie meinen Jungen mitnehmen!“
„Entspann dich, Alec“, erklang eine teilnahmsvolle Stimme, die einzige im Raum, die ruhig zu sein schien.
Ashton lächelte ihn über den Tisch hinweg an, gefasst wie immer.
„Mir wird schon nichts geschehen, Bruder“, sagte Ashton. „Ich werde meinen Dienst tun, und danach komme ich zurück.“
„Zurück?“, wiederholte Alec. „Sie holen die Hüter für sieben Jahre!“
Ashton lächelte.
„Dann sehe ich dich in sieben Jahren wieder“, antwortete er lächelnd. „Ich nehme an, dass du mir bis dahin über den Kopf gewachsen bist.“
So war Ashton nun einmal. Immer dachte er an andere, immer versuchte er alles, damit er sich besser fühlte, selbst in einem Augenblick wie diesem.
Es brach Alec das Herz.
„Ashton“, beharrte er, „du darfst nicht gehen. Du wirst die Flammen nicht überleben.“
„Ich…“, begann Ashton.
Doch seine Worte wurden von der Unruhe draußen unterbrochen. Pferde ritten ins Dorf und Männer schrien. Alle am Tisch sahen einander voller Angst an. Sie saßen wie erstarrt da, während draußen die Leute begannen wie aufgescheuchte Hühner umher zu rennen. Alec konnte durchs Fenster sehen, wie die Familien sich mit ihren Söhnen draußen aufstellten.
„Es hilft nichts, es hinauszuzögern“, sagte der Vater, stützte seine Hände auf den Tisch und stand auf. „Wir wollen nicht die Schande erleben, dass sie in unser Haus kommen und ihn wegzerren. Wir werden uns wie die anderen stolz draußen aufstellen. Lasst uns beten dass sie Ashton verschonen, wenn sie seinen Fuß sehen.“
Zögernd stand Alec auf und folgten ihnen aus dem Haus.
Als er in die kalte Nacht hinaustrat, erschrak Alec über das, was er sah: noch nie war das Dorf in einem solchen Aufruhr gewesen. Die Straßen waren von Fackeln erleuchtet und alle Jungen über 18 standen aufgereiht, während ihre Familien nervös zusahen.
Staubwolken wirbelten in den Straßen hoch, als die Karawane von Pandesiern ins Dorf geritten kam; Dutzende von Kriegern in den scharlachroten Rüstungen Pandesias, begleitet von Kutschen, die von großen Pferden gezogen wurden. Die Kutschen waren mit eisernen Gittern versehen und holperten hart über die Straße.
Alec betrachtete sie, und sah, dass sie voller Jungen aus dem ganzen Land waren, die verängstigt das Geschehen um sie herum betrachteten. Er schluckte, als er sich vorstellte, was seinen Bruder erwartete.
Die Karawane hielt auf dem Dorfplatz an, und eine angespannte Stille legte sich über das Dorf, während die Dorfbewohner mit angehaltenem Atem warteten
Der Kommandant der pandesischen Krieger sprang von einer der Kutschen. Er war großgewachsen und in seinen schwarzen Augen lag nicht ein Funken Wärme. Er ging langsam an den Reihen der Jungen vorbei, während es im Dorf so still war, dass man seine Sporen klirren hören konnte.
Dier Krieger musterte jeden der Jungen, hob das Kinn des einen hoch, sah einem anderen in die Augen, zwickte dem nächsten in den Oberarm, und manchen versetzte er einen leichten Stoß, um ihre Balance zu testen. Er nickte und die wartenden Krieger fingen an die Jungen in die Kutschen zu treiben. Manche der Jungen folgten ihnen schweigend; andere protestierten jedoch und kassierten dafür einen Schlag mit der Keule und wurden zu den anderen in die Kutsche geworfen. Manchmal schrie eine Mutter oder ein Vater auf – doch die Pandesier ließen sich durch nichts aufhalten.
Der Kommandant ging weiter und nahm dem Dorf seinen kostbarsten Besitz, bis er schließlich vor Ashton stehen blieb, der der letzte in der Reihe war.
„Mein Sohn ist lahm“, rief die Mutter schnell und bettelte verzweifelt: „Er wäre nutzlos für euch.“
Der Krieger musterte Ashton eingehend und blieb an seinem Fuß hängen.
„Roll deine Hosen hoch“, sagte er. „Und zieh deine Stiefel aus.“
Ashton folgte seinem Befehl und stützte sich auf Alec, um die Balance zu halten. Dieser kannte seinen Bruder gut genug, um sehen zu können, wie sehr er sich schämte. Er hatte sich immer für seinen Fuß geschämt, der kleiner als der andere war, verdreht und verbogen, und ihn zwang, zu hinken.
„Er arbeitet für mich in der Schmiede“, mischte sich der Vater ein. „Er ist unsere einzige Einkommensquelle. Wenn ihr ihn mitnehmt, hat unsere Familie nichts mehr. Wir können ohne ihn nicht überleben.“
Nachdem der Kommandant seinen Fuß begutachtet hatte, bedeutete er Ashton, seinen Stiefel wieder anzuziehen. Dann drehte er sich zum Vater um und sah ihn mit seinen kalten Augen an.