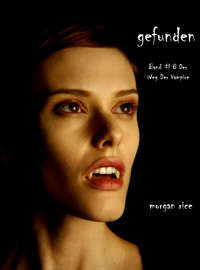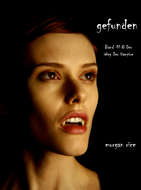Kitabı oku: «Gefunden », sayfa 2
„He du!“, kam eine fiese Stimme.
Scarlet spürte, wie sich die Haare in ihrem Nacken aufstellten, und drehte sich langsam herum.
Da saß eine Gruppe von fünf Jungs auf einem Steinvorsprung und starrte auf sie hinunter. Sie waren von Kopf bis Fuß dreckig und in Lumpen gekleidet. Sie waren Jugendliche, vielleicht 15 Jahre alt, und sie konnte die Gemeinheit in ihren Gesichtern sehen. Sie konnte spüren, dass sie auf Ärger hofften, und dass sie gerade ihr nächstes Opfer ausgemacht hatten; sie fragte sich, ob es offensichtlich war, wie alleine sie war.
Unter ihnen war ein wilder Hund, riesig, tollwütig wirkend, und doppelt so groß wie Ruth.
„Was machst du hier draußen ganz alleine?“, fragte der Anführer spöttisch, zum Gelächter der anderen vier. Er war muskulös und sah dümmlich aus, mit breiten Lippen und einer Narbe auf der Stirn.
Als sie sie ansah, fühlte Scarlet, wie ein neuer Sinn über sie kam, einer, den sie nie zuvor erfahren hatte: es war ein erhöhter Sinn der Intuition. Sie wusste nicht, was geschah, doch plötzlich konnte sie klar und deutlich ihre Gedanken lesen, spürte ihre Gefühle, kannte ihre Absichten. Sie fühlte sofort, glasklar, dass sie nichts Gutes im Schilde führten. Sie wusste, dass sie ihr schaden wollten.
Ruth knurrte neben ihr. Scarlet konnte eine gröbere Konfrontation kommen spüren—und genau das wollte sie vermeiden.
Sie bückte sich und fing an, Ruth davonzuführen.
„Komm mit, Ruth“, sagte Scarlet, während sie sich herumdrehte und anfing, davonzugehen.
„He Mädel, ich rede mit dir!“, schrie der Junge.
Im Davongehen blickte Scarlet über die Schulter zurück und sah, wie die Fünf vom Stein sprangen und begannen, ihr nachzugehen.
Scarlet fing zu laufen an, zurück in die Gassen, und wollte so viel Abstand wie möglich zwischen sich und diese Jungen bringen. Sie dachte an die Auseinandersetzung mit dem römischen Soldaten zurück und fragte sich einen Moment lang, ob sie stehenbleiben und versuchen sollte, sich zu verteidigen.
Doch sie wollte nicht kämpfen. Sie wollte niemandem wehtun. Oder irgendein Risiko eingehen. Sie wollte einfach nur Mama und Papa finden.
Scarlet bog in eine menschenleere Gasse ein. Sie blickte hinter sich, und in wenigen Momenten konnte sie die Gruppe Jungen ihr nachjagen sehen. Sie waren nicht weit hinter ihr, und sie holten schnell auf. Zu schnell. Ihr Hund rannte mit ihnen, und Scarlet konnte sehen, dass sie sie in wenigen Augenblicken eingeholt haben würden. Sie würde einen guten Haken schlagen müssen, um sie abzuhängen.
Scarlet bog um eine weitere Ecke und hoffte, einen Ausweg zu finden. Doch da blieb ihr das Herz stehen.
Es war eine Sackgasse.
Scarlet drehte sich langsam herum, Ruth an ihrer Seite, und stellte sich den Jungen. Sie waren nun vielleicht drei Meter entfernt. Sie wurden langsamer, als sie näherkamen, nahmen sich Zeit, genossen den Moment. Sie standen lachend da, mit grausamen Grinsern auf dem Gesicht.
„Sieht aus, als hättest du Pech gehabt, kleines Mädchen“, sagte der Anführer.
Scarlet dachte genau das Gleiche.
KAPITEL DREI
Sam erwachte unter rasenden Kopfschmerzen. Er hielt sich mit beiden Händen den Kopf und versuchte, den Schmerz so loszuwerden. Doch es gelang ihm nicht. Es fühlte sich an, als würde die ganze Welt auf seinen Schädel eindonnern.
Sam versuchte, die Augen zu öffnen, um herauszufinden, wo er war, und dabei wurde der Schmerz unerträglich. Blendendes Sonnenlicht spiegelte von Felsen in der Wüste wider und zwang ihn, seine Augen abzuschirmen und den Kopf zu senken. Er spürte, dass er auf felsigem Wüstenboden lag, spürte die trockene Hitze, spürte den Staub, der ihm ins Gesicht stieg. Er krümmte sich wie ein Fötus zusammen und hielt seinen Kopf fester, versuchte, den Schmerz zu vertreiben.
Erinnerungen kamen zurück.
Zuerst an Polly.
Er erinnerte sich an Caitlins Hochzeitsnacht. Die Nacht, in der er Polly einen Antrag gemacht hatte. Wie sie Ja gesagt hatte. Die Freude auf ihrem Gesicht.
Er erinnerte sich an den folgenden Tag. Wie er zur Jagd gegangen war. Wie er sich auf ihren gemeinsamen Abend gefreut hatte.
Er erinnerte sich daran, wie er sie gefunden hatte. Am Ufer. Im Sterben. Wie sie ihm von ihrem Baby erzählt hatte.
Wellen von Trauer schlugen über ihm zusammen. Es war mehr, als er bewältigen konnte. Es war wie ein schrecklicher Alptraum, der sich wiederholt in seinem Kopf abspielte, einer, den er nicht abschalten konnte. Er fühlte sich, als wäre alles, wofür es sich für ihn noch zu leben gelohnt hatte, von ihm genommen worden in einem einzigen großen Moment. Polly. Das Baby. Das Leben, wie er es kannte.
Er wünschte sich, er wäre in jenem Moment gestorben.
Dann erinnerte er sich an seine Vergeltung. Seine Rage. Wie er Kyle getötet hatte.
Und an den Moment, der alles verändert hatte. Er erinnerte sich daran, wie Kyles Geist in ihn gefahren war. Er erinnerte sich an das unbeschreibliche Gefühl der Rage, das Gefühl, dass der Geist und die Seele einer anderen Person ihm aufgedrängt wurden, ihn ganz und gar besessen hatten. Es war der Moment, in dem Sam aufhörte, zu sein, wer er war. Es war der Moment, in dem er zu jemand anderem wurde.
Sam öffnete seine Augen zur Gänze und er spürte, er wusste, dass sie glühend rot waren. Er wusste, dass sie nicht länger ihm gehörten. Er wusste, dass es nun Kyles Augen waren.
Er spürte Kyles Hass, spürte Kyles Macht, die durch ihn strömten, durch jede Faser seines Körpers, von seinen Zehen durch die Beine hoch in seine Arme, bis hin zu seinem Kopf. Er spürte Kyles Zerstörungsdrang durch seinen Körper pulsieren, wie etwas Lebendiges, wie etwas, das in seinem Körper feststeckte und das er nicht herausbekommen konnte. Er fühlte sich, als hätte er nicht länger die Kontrolle über sich selbst. Ein Teil von ihm vermisste den alten Sam, vermisste, wer er gewesen war. Doch ein anderer Teil von ihm wusste, er würde nie wieder diese Person sein.
Sam hörte ein fauchendes, klapperndes Geräusch und öffnete die Augen. Er lag mit dem Gesicht voran am Wüstenboden, und als er hochblickte, sah er eine Klapperschlange ihn nur wenige Zentimeter entfernt anzischen. Die Augen der Klapperschlange blickten direkt in Sams, wie im Gespräch mit einem Freund, eine ähnliche Energie verspürend. Er konnte spüren, dass die Rage der Schlange seiner eigenen ähnlich war—und dass sie kurz davor stand, anzugreifen.
Doch Sam fürchtete sich nicht. Im Gegenteil—er fühlte sich von einer Rage erfüllt, die derer der Schlange nicht nur gleich war, sondern größer. Und dazu passende Reflexe.
In dem Sekundenbruchteil, in dem die Schlange sich bereitmachte, zuzuschnappen, kam Sam ihr zuvor: er streckte seine Hand aus, packte die Schlange in der Luft am Hals und hielt sie nur zwei Zentimeter von seinem Gesicht entfernt so fest, dass sie ihn nicht beißen konnte. Sam hielt die Augen der Schlange auf seiner Augenhöhe, starrte sie so nahe an, dass er ihren Atem riechen konnte, ihre langen Giftzähne nur zwei Zentimeter entfernt, danach lechzend, in Sams Hals zu fahren.
Doch Sam überwältigte sie. Er drückte fester und fester zu und quetschte ihr langsam das Leben aus. Sie erschlaffte in seiner Hand, zu Tode erdrückt.
Er holte aus und schleuderte sie über den Wüstenboden.
Sam sprang auf die Füße und nahm seine Umgebung in sich auf. Um ihn herum war Staub und Steine—ein endloses Stück Wüste. Er drehte sich herum und bemerkte zwei Dinge: das erste war eine Gruppe kleiner Kinder, in Lumpen gekleidet, die neugierig zu ihm hochblickten. Als er zu ihnen herumwirbelte, stoben sie auseinander, eilten davon, als hätten sie ein wilden Tier dabei beobachtet, wie es aus dem Grab stieg. Sam spürte Kyles Wut durch ihn strömen, und ihm war danach, sie alle zu töten.
Doch das Zweite, was ihm auffiel, zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Eine Stadtmauer. Eine enorme Steinmauer, die sich über hundert Meter in die Lüfte erhob und sich in die Ewigkeit erstreckte. In dem Moment erkannte Sam: er war in den Vororten einer uralten Stadt aufgewacht. Vor ihm stand ein riesiges gewölbtes Tor, unter dem dutzende Menschen hinein und heraus strömten, in primitive Kleidung gehüllt. Sie wirkten, als befänden sie sich im römischen Zeitalter, in schlichte Roben oder Tuniken gekleidet. Auch Vieh strömte hinein und hinaus, und Sam konnte schon von hier die Hitze und den Lärm der Menge hinter den Mauern spüren.
Sam machte ein paar Schritte auf das Tor zu, und dabei stoben die Kinder auseinander, als würden sie vor einem Monster davonlaufen. Er fragte sich, wie furchteinflößend er aussah. Doch es war ihm eigentlich egal. Er verspürte den Drang, diese Stadt zu betreten und herauszufinden, warum er hier gelandet war. Doch anders als der alte Sam verspürte er keinen Drang, sie zu erforschen: vielmehr verspürte er den Drang, sie zu zerstören. Diese Stadt in Stücke zu hauen.
Ein Teil von ihm versuchte, es abzuschütteln, den alten Sam zurückzubringen. Er zwang sich dazu, an etwas zu denken, das ihn zurückbringen könnte. Er zwang sich dazu, an seine Schwester Caitlin zu denken. Doch es war vernebelt; er konnte ihr Gesicht nicht mehr wirklich hervorrufen, so sehr er es auch versuchte. Er versuchte, seine Gefühle für sie hervorzurufen, ihre gemeinsame Mission, ihren Vater. Er wusste tief drin, dass sie ihm immer noch wichtig war, dass er ihr immer noch helfen wollte.
Doch dieser kleine Teil von ihm war schon bald überwältigt von dem neuen, bösartigen Teil. Er erkannte sich selbst kaum wieder. Und der neue Sam zwang ihn, seine Gedanken aufzugeben und weiterzugehen, direkt in die Stadt hinein.
Sam marschierte durch das Stadttor und rempelte dabei die Leute aus dem Weg. Eine alte Frau, die einen Korb auf ihrem Kopf balancierte, kam ihm zu nahe, und er stieß ihr so kräftig gegen die Schulter, dass sie hinfiel, ihr der Korb vom Kopf gestoßen wurde und Obst sich überall verteilte.
„He“, schrie ein Mann. „Sieh nur, was du angerichtet hast! Entschuldige dich bei ihr!“
Der Mann marschierte auf Sam zu und machte den dummen Fehler, die Hand auszustrecken und ihn am Mantel zu packen. Der Mann hätte erkennen sollen, dass es ein Mantel war, den er nicht kannte, schwarz und aus Leder, und hauteng. Der Mann hätte erkennen sollen, dass Sams Kleidung aus einem anderen Jahrhundert stammte—und dass Sam der letzte Mann war, dem er in die Quere geraten wollte.
Sam blickte auf die Hand des Mannes hinunter, als wäre sie ein Insekt, dann packte er ihn am Handgelenk und verdrehte es mit der Kraft von hundert Männern. Die Augen des Mannes weiteten sich vor Angst und Schmerz, während Sam immer weiter drehte. Schließlich drehte sich der Mann zur Seite und ging in die Knie. Sam drehte jedoch weiter, bis er ein grässliches Krachen hörte und der Mann mit gebrochenem Arm aufschrie.
Sam holte aus und schaltete den Mann aus, indem er ihm kräftig ins Gesicht trat, womit er bewusstlos zu Boden fiel.
Eine kleine Gruppe Passanten hatte das beobachtet, und sie machten Sam weitläufig Platz, als er weiterging. Niemand schien sehr erpicht darauf, auch nur in seine Nähe zu geraten.
Sam ging weiter, direkt in das Gedränge hinein, und war schon bald von einer neuen Menge umringt. Er fügte sich in den endlosen Strom von Menschen, die die Stadt erfüllten. Er war nicht sicher, wohin er gehen sollte, doch er verspürte diese neuen Gelüste, die ihn übermannten. Er spürte die Lust zu trinken durch ihn strömen. Er wollte Blut. Er wollte ein frisches Todesopfer.
Sam ließ sich von seinen Sinnen leiten und spürte, wie er in eine bestimmte Gasse geführt wurde. Als er in sie einbog, wurde die Gasse schmaler, dunkler, höher, abgeschottet vom Rest der Stadt. Es war sichtlich ein schäbiger Stadtteil, und während er weiterzog, wurden die Leute immer fragwürdiger.
Bettler, Säufer und Prostituierte füllten die Straßen, und Sam rempelte mehrere schurkische, fette Männer, unrasiert, mit fehlenden Zähnen, die an ihm vorüberstolperten. Er achtete darauf, dass er sie besonders kräftig anrempelte, um sie in alle Richtungen umzuwerfen. Sie alle waren weise genug, ihn nicht weiter herauszufordern als empört „He!“ zu rufen.
Sam ging weiter und fand sich schon bald auf einem kleinen Platz wieder. Da in der Mitte, mit den Rücken zu ihm, standen etwa ein Dutzend Männer im Kreis und jubelten. Sam kam heran und drängte sich durch, um zu sehen, weswegen sie jubelten.
In der Mitte des Kreises waren zwei Hähne, die einander in Stücke rissen, blutüberströmt. Sam sah, dass die Männer Wetten abgaben, altertümliche Münzen tauschten. Hahnenkämpfe. Der älteste Sport der Welt. So viele Jahrhunderte waren vergangen, und doch hatte sich nichts wirklich geändert.
Sam hatte genug. Er wurde unruhig, und er verspürte den Drang, etwas Chaos anzurichten. Er marschierte in die Mitte des Rings, direkt auf die beiden Vögel zu. Dabei schrie die Menge empört auf.
Sam ignorierte sie. Stattdessen packte er einen der Hähne an der Gurgel, hob ihn hoch und wirbelte ihn über seinem Kopf. Es krachte, und er spürte ihn in seiner Hand erschlaffen, sein Genick gebrochen.
Sam spürte seine Eckzähne ausfahren und grub die Zähne in den Körper des Hahnes. Er saugte das Blut gierig auf, und es rann ihm übers Gesicht, die Wangen hinunter. Endlich warf er den Vogel unbefriedigt davon. Der andere Hahn machte sich davon, so schnell er konnte.
Die Menge starrte Sam sichtlich schockiert an. Doch dies waren raue, grobe Typen, nicht von der Sorte, die einfach davonlaufen würde. Sie verzogen die Gesichter und bereiteten sich auf einen Kampf vor.
„Du hast unseren Wettkampf ruiniert!“, schnappte einer von ihnen.
„Dafür wirst du bezahlen!“, schrie ein anderer.
Mehrere bullige Männer zogen kurze Dolche hervor und stürzten sich auf Sam, direkt auf ihn einstechend.
Sam zuckte kaum. Er sah alles wie in Zeitlupe passieren. Mit Reflexen, die eine Million Mal schneller waren, streckte er einfach die Hand aus, fing das Handgelenk des Mannes in der Luft ab und drehte es ihm im gleichen Schwung herum, bis er ihm den Arm gebrochen hatte. Dann holte er aus und trat dem Mann in die Brust, sodass er in den Kreis zurückflog.
Einem weiteren Mann, der auf ihn zukam, stürzte sich Sam entgegen und kam ihm zuvor. Er kam nahe an ihn heran, und bevor der Mann reagieren konnte, hatte er seine Zähne bereits in der Kehle des Mannes versenkt. Sam trank mit tiefen Schlucken, Blut spritzte überall umher und der Mann schrie vor Schmerzen. In wenigen Momenten hatte er ihm das Leben ausgesaugt, und der Mann brach am Boden zusammen.
Die anderen starrten, völlig entsetzt. Endlich schien ihnen klar zu sein, dass ein Monster unter ihnen war.
Sam trat einen Schritt auf sie zu, und sie alle drehten sich herum und rannten davon. Sie verschwanden wie Fliegen, und nur einen Moment später war Sam der Einzige am Platz.
Er hatte sie alle besiegt. Doch das war Sam nicht genug. Es gab kein Ende für das Blut und den Tod und die Zerstörung, die er begehrte. Er wollte jeden Mann in dieser Stadt töten. Selbst dann würde es nicht ausreichen. Sein Mangel an Befriedigung frustrierte ihn ohne Ende.
Er lehnte sich zurück, reckte das Gesicht zum Himmel und brüllte. Es war das Brüllen eines Tieres, das endlich freigelassen worden war. Sein Schmerzensschrei erhob sich in die Luft, hallte von den Steinmauern Jerusalems wider, lauter als die Glocken, lauter als die klagenden Gebete. Einen kurzen Moment lang brachte es die Mauern zum Beben, beherrschte die gesamte Stadt—und von einem Ende zum anderen hielten ihre Einwohner inne und horchten hin und lernten das Fürchten.
In dem Augenblick wussten sie: ein Monster war unter ihnen.
KAPITEL VIER
Caitlin und Caleb kletterten den steilen Berghang hinunter auf das Dorf Nazareth zu. Es war felsig, und sie rutschten mehr als wanderten den steilen Hang hinunter, Staub dabei aufwirbelnd. Auf dem Weg änderte sich das Gelände, der nackte Fels wich kleinen Flecken von Gräsern, hier und da einer Palme, dann richtigen Wiesen. Schließlich fanden sie sich in einem Olivenhain wieder und spazierten durch Reihen von Olivenbäumen, weiter hinab auf die Ortschaft zu.
Caitlin sah sich die Äste genauer an und sah tausende kleiner Oliven in der Sonne schimmern, und bewunderte, wie schön sie waren. Je näher sie dem Ort kamen, umso fruchtbarer waren die Bäume. Caitlin blickte hinunter und hatte von diesem Aussichtspunkt einen Blick auf das Tal und das Dorf aus der Vogelperspektive.
Ein kleines Dorf, eingebettet in gewaltige Täler, konnte man Nazareth kaum eine Stadt nennen. Es schien nur ein paar hundert Einwohner zu haben, nur ein paar Dutzend kleiner Gebäude, ebenerdig und aus Stein erbaut. Einige von ihnen schienen aus einem weißen Kalkstein gebaut, und in der Ferne konnte Caitlin enorme Kalksteinbrüche um die Stadt herum sehen, in denen Dorfbewohner vor sich hin hämmerten. Sie konnte das sanfte Klingen ihrer Hämmer selbst aus dieser Entfernung schallen hören, und konnte den hellen Kalkstein-Staub in der Luft hängen sehen.
Nazareth war von einer niedrigen, verwinkelten Steinmauer umgeben, die vielleicht drei Meter hoch war und selbst in dieser Zeit bereits uralt aussah. In ihrer Mitte war ein breiter, offener Torbogen. Am Tor standen keine Wachen, und Caitlin nahm an, dass es keinen Grund dazu gab; immerhin war dies eine kleine Stadt mitten im Nirgendwo.
Caitlin musste sich fragen, warum sie wohl in dieser Zeit und an diesem Ort erwacht waren. Warum Nazareth? Sie dachte darüber nach, was sie über Nazareth wusste. Sie erinnerte sich vage daran, einmal etwas darüber gelernt zu haben, doch sie konnte sich einfach nicht erinnern. Und warum im ersten Jahrhundert? Es war so ein dramatischer Sprung vom mittelalterlichen Schottland, und sie stellte fest, dass sie Europa vermisste. Diese neue Landschaft mit ihren Palmen und der Wüstenhitze war ihr so fremd. Mehr als alles andere fragte sich Caitlin, ob Scarlet hinter diesen Mauern war. Sie hoffte—sie betete—dass es so war. Sie musste sie finden. Eher würde sie nicht zur Ruhe kommen.
Caitlin trat mit Caleb durch das Stadttor und betrat die Stadt mit einem erwartungsvollen Gefühl. Sie konnte ihr Herz beim Gedanken daran, Scarlet zu finden, pochen spüren—und beim Gedanken daran, herauszufinden, warum sie überhaupt an diesen Ort geschickt worden waren. Konnte ihr Vater darin auf sie warten?
Als sie die Stadt betraten, verschlug ihr ihre Lebendigkeit den Atem. Die Straßen waren erfüllt von herumrennenden Kindern, kreischend und spielend. Hunde liefen wild umher, und auch Hühner. Schafe und Ochsen teilten sich die Straßen, schlenderten umher, und außerhalb jedes Heims stand ein Esel oder Kamel an einen Pfahl gebunden. Dorfbewohner spazierten gemütlich umher, in primitive Tuniken und Roben gekleidet, mit Körben voll Waren über ihren Schultern. Caitlin fühlte sich, als hätte sie eine Zeitmaschine betreten.
Während sie die engen Straßen entlang wanderten, vorbei an kleinen Häusern, an alten Frauen, die von Hand Wäsche wuschen, hielten die Leute an und starrten. Caitlin erkannte, dass sie so fehl am Platz aussehen mussten, wie sie diese Straßen entlanggingen. Sie blickte auf ihre moderne Kleidung hinunter—ihren engen, ledernen Kampfanzug—und fragte sich, was diese Leute wohl von ihr dachten. Sie mussten denken, dass sie eine Außerirdische war, die vom Himmel heruntergefallen war. Sie konnte es ihnen nicht verübeln.
Vor jedem Haus stand jemand, der Essen zubereitete, Waren verkaufte oder sein Handwerk ausübte. Sie passierten mehrere Zimmermanns-Familien, der Mann vor dem Heim sitzend, sägend, hämmernd, Dinge bauend von Betten über Kästchen bis hin zu hölzernen Achsen für Pflüge. Vor einem der Häuser baute ein Mann ein riesiges Kreuz, über einen Meter dick und drei Meter lang. Caitlin erkannte, dass es ein Kreuz war, das für eine Kreuzigung gedacht war. Sie schauderte und blickte weg.
Als sie in eine weitere Straße einbogen, war der gesamte Block gefüllt mit Schmieden. Überall flogen Hämmer auf Ambosse, und das Klirren von Metall hallte durch die Straße, jeder Schmied das Echo des nächsten. Es gab auch Lehmgruben mit hohen Flammen, über denen Platten von rotglühendem Metall schwelten, auf denen Hufeisen, Schwerter und alle Arten von Metallarbeiten gefertigt wurden. Caitlin bemerkte die Gesichter von Kindern, schwarz vom Ruß, die an der Seite ihrer Väter saßen und ihnen bei der Arbeit zusahen. Ihr taten die Kinder leid, die in so jungem Alter schon arbeiten mussten.
Caitlin suchte überall nach einem Anzeichen von Scarlet, von ihrem Vater, irgendeinem Hinweis darauf, warum sie hier waren—doch sie fand nichts.
Sie bogen in eine weitere Straße ein, und diese war von Steinmetzen erfüllt. Hier meißelten Männer an großen Kalkstein-Brocken herum, schufen Statuen, Keramik und riesige flache Pressen. Zuerst erkannte Caitlin nicht, wofür diese gut waren.
Caleb deutete auf sie.
„Das sind Weinpressen“, sagte er, wie immer ihre Gedanken lesend. „Und Olivenpressen. Sie werden eingesetzt, um die Trauben und Oliven zu zerdrücken und so den Wein und das Öl zu gewinnen. Siehst du diese Kurbeln?“
Caitlin sah genauer hin und bewunderte die Handwerkskunst, die langen Kalksteinplatten, die feine Metallkunst der Zahnräder. Sie war davon überrascht, wie fortgeschritten ihre Maschinen waren, selbst für diese Zeit. Sie war auch überrascht davon, wie alt das Weinbau-Handwerk war. Hier war sie, tausende Jahre in der Vergangenheit, und die Leute stellten immer noch flaschenweise Wein her, Olivenöl, genau wie sie es im 21. Jahrhundert taten. Und während sie zusah, wie die Glasflaschen langsam mit Wein und Öl befüllt wurden, erkannte sie, dass sie genau wie die Weinflaschen und Olivenöl-Flaschen aussahen, die sie selbst verwendet hatte.
Eine Gruppe Kinder rannte an ihr vorbei, spielte Fangen, lachte, und dabei wirbelten Staubwolken hoch und bedeckten Caitlins Füße. Sie blickte hinunter und stellte fest, dass die Straßen in diesem Dorf nicht befestigt waren—es war wahrscheinlich, überlegte sie, zu klein, um sich gepflasterte Straßen leisten zu können. Und doch wusste sie, dass Nazareth für irgendetwas berühmt war, und es störte sie, dass sie sich nicht daran erinnern konnte, wofür. Wieder einmal hätte sie sich selbst dafür treten können, dass sie im Geschichtsunterricht nicht besser aufgepasst hatte.
„Es ist die Stadt, in der Jesus lebte“, sagte Caleb, ihre Gedanken lesend.
Caitlin spürte, wie sie wieder einmal rot wurde, als er ihre Gedanken mit solcher Leichtigkeit aus ihrem Kopf pflückte. Sie hielt nichts vor Caleb zurück, und doch wollte sie nicht, dass er ihre Gedanken las, wenn es darum ging, wie sehr sie ihn liebte. Das könnte ihr peinlich werden.
„Er lebt hier?“, fragte sie.
Caleb nickte.
„Falls wir zu seiner Zeit angekommen sind“, sagte Caleb. „Wir sind eindeutig im ersten Jahrhundert. Das sehe ich an ihrer Kleidung, an der Architektur. Ich war schon einmal hier. Diesen Ort und diese Zeit vergisst man nicht so schnell.“
Caitlins Augen weiteten sich bei dem Gedanken.
„Meinst du wirklich, er könnte jetzt gerade hier sein? Jesus? Herumspazieren? In dieser Zeit, an diesem Ort? In dieser Stadt?“
Caitlin konnte es kaum erfassen. Sie versuchte, sich vorzustellen, wie sie um die Ecke biegen und beiläufig Jesus auf der Straße begegnen könnte. Der Gedanken daran schien unvorstellbar.
Caleb runzelte die Stirn.
„Ich weiß nicht“, sagte er. „Ich spüre nicht, dass er jetzt hier wäre. Vielleicht haben wir ihn verpasst.“
Caitlin war bei dem Gedanken ganz aus der Fassung. Sie blickte mit einem neuen Gefühl der Ehrfurcht um sich.
Kann es sein, dass er hier ist?, fragte sie sich.
Sie war sprachlos, und ihre Mission fühlte sich mit einem Mal umso wichtiger an.
„Es kann sein, dass er hier ist, in diesem Zeitraum“, sagte Caleb. „Aber nicht unbedingt in Nazareth. Er reiste viel. Bethlehem. Nazareth. Kapernaum—und natürlich Jerusalem. Ich weiß nicht einmal mit Sicherheit, ob wir in seiner genauen Zeit sind oder nicht. Aber wenn wir das sind, könnte er überall sein. Israel ist groß. Wenn er hier wäre, in dieser Stadt, würden wir das spüren.“
„Was meinst du damit?“, fragte Cailtin neugierig. „Wie würde es sich anfühlen?“
„Ich kann es nicht erklären. Aber du würdest es wissen. Es ist seine Energie. Sie ist anders als alles, was du je zuvor erlebt hast.“
Plötzlich kam Caitlin ein Gedanke.
„Bist du ihm je tatsächlich begegnet?“, fragte sie.
Caleb schüttelte langsam den Kopf.
„Nein, nicht aus der Nähe. Einmal war ich zur gleichen Zeit in der gleichen Stadt. Und die Energie war überwältigend. Anders als alles, was ich zuvor je gefühlt habe.“
Wieder einmal staunte Caitlin darüber, was Caleb bereits alles gesehen hatte, all die Zeiten und Orte, die er erlebt hatte.
„Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden“, sagte Caleb. „Wir müssen herausfinden, welches Jahr es ist. Aber das Problem damit ist natürlich, dass bis lange nach Jesus' Tod niemand die Jahre gezählt hat, wie wir es tun. Immerhin basiert unser Kalenderjahr auf dem Jahr seiner Geburt. Und zu seinen Lebzeiten zählte niemand die Jahre basierend auf seinem Geburtsjahr—die meisten Leute wussten nicht einmal, wer er war! Also wenn wir die Leute fragen, welches Jahr es ist, werden sie uns für verrückt halten.“
Caleb blickte sich sorgfältig um, als würde er nach Hinweisen suchen, und Caitlin tat es ihm gleich.
„Ich habe schon das Gefühl, dass er in dieser Zeit lebt“, sagte Caleb langsam. „Nur nicht an diesem Ort.“
Caitlin betrachtete das Dorf mit neuem Respekt.
„Aber dieses Dorf“, sagte sie, „es scheint so klein, so bescheiden. Es ist nicht wie eine große, biblische Stadt, wie ich sie mir vorgestellt hätte. Es sieht nicht anders aus als jede beliebige Wüstenstadt.“
„Du hast recht“, antwortete Caleb, „aber so ist der Ort, an dem er lebte. Es war nicht irgendein großartiger Ort. Es war hier, unter diesen Leuten.“
Sie gingen weiter und bogen schließlich um eine Ecke, die sie auf einen kleinen Platz in der Dorfmitte führte. Es war ein schlichter kleiner Platz, um den herum kleine Gebäude standen und in dessen Mitte sich ein Brunnen befand. Caitlin blickte sich um und entdeckte ein paar ältere Herren im Schatten sitzen, Spazierstöcke haltend, auf den leeren, staubigen Dorfplatz starrend.
Sie gingen auf den Brunnen zu. Caleb drehte an der rostigen Kurbel, und langsam zog das verwitterte Seil einen Eimer Wasser hoch.
Caitlin fasste hinein, nahm das kalte Wasser mit hohlen Händen auf und spritzte es sich ins Gesicht. Es fühlte sich in der Hitze so erfrischend an. Sie bespritzte ihr Gesicht erneut, dann ihr langes Haar, und kämmte es mit den Fingern. Es war staubig und fettig, und das kalte Wasser fühlte sich himmlisch an. Sie würde alles für eine Dusche geben. Dann beugte sie sich vor, nahm noch mehr Wasser mit den Händen auf und trank es. Ihre Kehle war ausgetrocknet, und es war genau, was sie brauchte. Caleb tat es ihr nach.
Schließlich lehnten sich beide an den Brunnen und betrachteten den Platz. Es schien keine besonderen Gebäude zu geben, keine besonderen Kennzeichnungen oder Hinweise darauf, wohin sie gehen sollten.
„Also wohin jetzt?“, fragte sie schließlich.
Caleb blickte herum, blinzelte ins Sonnenlicht und hielt sich die Hand vor die Augen. Er wirkte genauso ratlos wie sie.
„Ich weiß es nicht“, sagte er trocken. „Ich bin überfragt.“
„An anderen Zeiten und Orten“, fuhr er fort, „schien es, als wären unsere Hinweise stets in Klostern oder Kirchen zu finden gewesen. Aber in dieser Zeitperiode gibt es keine Kirche. Es gibt kein Christentum. Es gibt keine Christen. Erst nach Jesus' Tod gründeten die Leute eine Religion nach ihm. In dieser Zeitperiode gibt es nur einen Glauben. Jesus' Glauben: Das Judentum. Immerhin war Jesus jüdisch.“
Caitlin versuchte, das alles zu verarbeiten. Es war alles so komplex. Wenn Jesus Jude war, überlegte sie, hieß das, er würde zum Beten in eine Synagoge gehen. Plötzlich hatte sie einen Einfall.
„Dann ist vielleicht der beste Ort für die Suche der Ort, an dem Jesus betete. Vielleicht sollten wir nach einer Synagoge suchen.“
„Ich glaube, du hast recht“, sagte Caleb. „Immerhin war die einzige andere ausgeübte Religion zu jener Zeit, wenn man es überhaupt so nennen kann, das Heidentum—die Anbetung von Götzenbildern. Und ich bin sicher, dass Jesus nicht in einem heidnischen Tempel beten würde.“
Caitlin blickte sich erneut in der Stadt um, kniff die Augen zusammen und suchte nach einem Gebäude, das einer Synagoge ähneln könnte. Doch sie fand keines. Es waren alles schlichte Wohnstätten.
„Ich sehe nichts“, sagte sie. „Alle Gebäude sehen für mich gleich aus. Es sind nichts als kleine Häuser.“
„Ich auch nicht“, sagte Caleb.
Es folgte eine lange Stille, während Caitlin versuchte, alles zu verarbeiten. In ihrem Kopf rasten die Möglichkeiten.
„Meinst du, dass mein Vater und das Schild irgendwie mit all dem hier in Verbindung stehen?“, fragte Caitlin. „Meinst du, dass es mich zu meinem Vater führen wird, wenn wir dahin gehen, wo Jesus war?“
Caleb kniff die Augen zusammen und schien lange Zeit nachzudenken.
„Ich weiß nicht“, sagte er schließlich. „Aber es ist eindeutig, dass dein Vater ein äußerst großes Geheimnis hütet. Ein Geheimnis nicht nur für die Art der Vampire, sondern für die gesamte Menschheit. Ein Schild, oder eine Waffe, die die Natur der gesamten Menschheit ändern wird, für alle Zeit. Es muss äußerst mächtig sein. Und es scheint mir, wenn irgendjemand dazu gedacht war, uns zu helfen, zu deinem Vater zu finden, dann würde dies jemand äußerst Mächtiger sein. Wie Jesus. Für mich würde das Sinn ergeben. Vielleicht müssen wir, um den einen zu finden, den anderen finden. Immerhin ist es dein Kreuz, das uns so viele der Schlüssel offenbart hat, die uns hierher gebracht haben. Und beinahe alle unsere Hinweise haben wir in Kirchen und Klöstern gefunden.“
Caitlin versuchte, alles zu erfassen. War es möglich, dass ihr Vater Jesus kannte? War er einer seiner Jünger? Der Gedanke daran war atemberaubend, und die geheimnisvolle Aura um ihn wurde immer tiefer.
Sie saß am Brunnen und blickte sich ratlos in dem schläfrigen Dörfchen um. Sie hatte keine Ahnung, wo sie überhaupt zu suchen anfangen sollte. Überhaupt nichts stach besonders hervor. Und noch dazu wollte sie immer dringender Scarlet finden. Ja, sie wollte ihren Vater mehr als je zuvor finden; sie spürte die vier Schlüssel praktisch in ihrer Tasche brennen. Doch sie konnte keine offensichtliche Stelle erkennen, um sie einzusetzen—und es war schwer, sich auf ihn zu konzentrieren, solange sich ihre Gedanken um Scarlet drehten. Der Gedanke daran, dass sie ganz alleine da draußen war, zerriss sie in Stücke. Wer wusste schon, ob sie überhaupt in Sicherheit war?