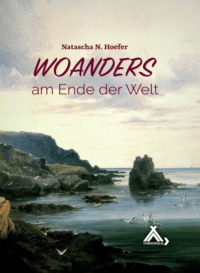Kitabı oku: «Woanders am Ende der Welt», sayfa 2
»Boris – das funktioniert nie!«
»Aber klar doch! Bei Katharina deine einzige Chance. Wenn du sie anflehst, also Schwäche zeigst, trampelt sie nur auf dir rum. Sie muss von allein darauf kommen, was sie verloren hat.«
»Und du meinst nicht, dass sie wegfahren als wegrennen interpretieren würde und damit als die größte Schwäche überhaupt?«
»Naja, das Risiko würde ich eingehen. Wie gesagt, anflehen bringt bei ihr nichts.«
Unglücklich musste Florian sich eingestehen, dass etwas an Boris’ Einschätzung wahr sein konnte. »Aber wohin sollte ich denn gehen? Ich habe gar keine Lust auf Urlaub! Ich wollte Urlaub mit ihr!«
»Da hätte ich schon eine Idee …«
»Ach Boris, vergiss es …«
»Pass auf: Ich habe vor ein paar Jahren einem Bekannten ein Ferienhaus abgekauft, in der Bretagne. Der meinte, ein Architekt könnte aus der Bude ’was Feines machen; stimmt auch; nur hatte ich noch keine Zeit dazu. Das Problem ist, es ist echt weit weg, nämlich am Ende der Welt, und das wörtlich: im Finistère, finis terra, kapiert? Aber für deine Zwecke ist das Haus dadurch ideal. Da wird Katharina dich nie finden; und es ist eine reizvolle Gegend da zum Ablenken und Urlaub machen. Es gibt Strände, mit netten Mädels …«
»Boris, jetzt mach mal halblang. Ich fahre bestimmt nicht von Gießen bis ans Ende der Welt, um aus Rache an Katharina fremde Strandgängerinnen aufzureißen.«
»Die Schlüssel und so weiter muss ich allerdings von zuhause holen, aber das kann ich gleich tun; dauert nicht lange«, fuhr Boris unbeirrt fort und sprang auf.
»Moment! Ich habe nicht ja gesagt!«, protestierte Florian nachdrücklich.
»Nicht nachdenken. Mach’ es oder lass’ es. Nachdenken ist
Frauensache.«
Florian hob abwehrend die Hände und schüttelte den Kopf. »Sogar wenn ich wegfahren wollen würde, es würde nicht gehen: Ich habe kein Auto! Der Karmann ist in der Werkstatt, und Katharinas Mini kann ich schlecht nehmen.«
Boris blähte die Backen auf. »Für wie lange ist dein Auto noch weg?«
»Bis Mittwoch nächster Woche.«
»Du musst aber gleich abhauen, sonst funktioniert die Strategie nicht. Dann nimm eben meinen Wagen, verdammt, ich hole dann den Karmann von der Werkstatt ab.«
»Tauschen?«, fragte Florian ungläubig.
»Ich behandle deinen Oldie wie ein rohes Ei, versprochen. Dasselbe erwarte ich von dir mit dem Cayenne – du weißt, dass das ein echter Freundschaftsdienst ist, oder?«
Florian nickte. Boris liebte seinen neuen SUV abgöttisch.
»Gut, abgemacht«, wollte Boris die Diskussion schon schließen, aber Florian schüttelte abermals den Kopf. »Boris, deine Idee ist aberwitzig! Ich werde nicht darum herum kommen, mit Katharina zu reden, sogar wenn es nichts bringen sollte. Versuchen muss ich es. Aber mal abgesehen davon, meine Eltern sind im Urlaub. Wenn ich auch weg bin, besucht niemand meine Oma.«
»Besuch’ sie gleich und erklär’ ihr alles. Das versteht die schon. Deine Eltern kommen doch bald zurück, und so lange kümmern sich die Leute aus dem Altenheim um deine Oma. Dafür ist sie schließlich im Altenheim, oder?«
»Und was wäre mit dem Bau am Breidenstein-Haus?«, gab Florian zuletzt zu bedenken.
»Oh, um die Breidenstein kümmere ich mich. Attraktive Frau, die Frau Breidenstein. Nervend, aber attraktiv. Wünsch mir Glück!« Boris grinste anzüglich.
Manchmal fragte Florian sich schon, wie er die Gesellschaft seines Kompagnons an fünf Tagen pro Woche ertragen konnte.

Marlene Braun saß an der offenen Balkontür ihres Zimmers und las Zeitung. Richtige Balkons gab es nicht in dem Seniorenheim in der Moltkestraße, nur sogenannte französische: Statt eines normalen Fensters war eine Balkontür eingebaut, vor der ein Gitter einbetoniert war. Florian hatte diese Lösung schon immer missraten gefunden. Nach wie vor tat es ihm weh, seine Oma hier zu sehen, anstatt in ihrem Nest, ihrem eigenen Häuschen. Das Reihenhaus der Brauns war klein gewesen, aber vollgestopft mit persönlichen Dingen – Dingen, die die kleinen Räume anheimelnd gemacht hatten; Dingen, die Florians Großeltern ein Ehe- und Familienleben lang angesammelt hatten. Wie wenig davon hatte seine Oma in das Heim mitnehmen können! Wenn Florian allein an die vielen Bücher dachte, die zum Teil noch von seinem Opa stammten …
Seine Oma hatte aufgeblickt und ein Strahlen ging durch ihre blauen Augen. »Florian! Guten Tag!« Sie legte rasch die Zeitung beiseite, um sich von ihrem Enkel, ihrem ganzen Stolz, einen Kuss geben zu lassen.
Der ließ sich auf die Bettkante fallen. Es gab nur den Sessel seiner Oma und das Bett als Sitzmöglichkeiten in dem engen Zimmer.
»Geht es dir gut?«, fragte Marlene erschrocken, jetzt wo sie ihren Enkel auf Augenhöhe genauer ansah.
»Nicht so wirklich. Ich glaube, ich sollte mal Urlaub machen. Boris will mich jedenfalls dazu überreden, in sein Ferienhaus zu fahren.«
»Ach, Boris hat ein Ferienhaus? Wo denn? Wann wollt ihr denn hinfahren?«
Florian schluckte, seine Kehle brannte. »Nicht wir, nur ich. Katharina würde nicht mitkommen. Sie …« Er konnte nicht weiterreden. Schon wieder war er nahe am Weinen, das ging nicht!
»Was ist los, Florian?«, fragte seine Oma weich und streckte eine Hand nach ihm aus. Er nahm die alte kleine Hand, die sehr zarten Finger mit den noch immer sorgsam gepflegten Fingernägeln in seine jungen Hände und versuchte zu lächeln. Dann räusperte er sich und sagte schlicht: »Katharina liebt einen anderen. Sie will mich verlassen.«
Bestürzt sah Marlene ihren Enkel an, bestürzt und ungläubig. Wie, ihren Florian? Diesen wunderbaren Jungen? Das konnte nicht sein! Aber ihr Junge begann nun, erst abgehackt, dann immer schneller sprechend von den Geschehnissen am vergangenen Abend zu erzählen.
»Ja, so ist das, Oma«, endete er schließlich. »Ich kann es selbst nicht fassen. Ich hatte keine Ahnung… Das heißt, ich hatte schon in letzter Zeit den Eindruck, wir würden etwas auseinanderdriften, im Alltagsstress – aber dass sie – einen anderen – das ist so ein Schock!«
»Das glaube ich. Nur, Florian, das wirst du doch nicht so stehenlassen? Du liebst doch deine Katharina? Dann musst du um sie kämpfen! Wegfahren ist die ganz falsche Idee!«
»Boris meint, erst der Abstand würde Katharina klarmachen, was sie an mir hätte. Und sie anflehen würde ohnehin nichts nützen. Die Wahrheit ist, ich fühle mich dieser Sache einfach nicht gewachsen!«
Marlene kannte ihren Florian, und sie kannte seine Katharina. Möglich, dass er sich seiner Frau nicht ganz gewachsen fühlte, in dieser Situation. Aber dann musste er sich eben ermannen! »Jetzt hör’ mal zu«, hob sie an, »wenn man im Leben seine große Liebe gefunden hat, dann darf man nicht wegrennen, sobald sie gefährdet ist! Gefährdet heißt noch nicht verloren. Nichts ist schlimmer, als seine große Liebe zu verlieren – und dann auch noch kampflos! Katharina braucht einen neuen Liebesbeweis von dir. Ach, wenn ihr nur Kinder hättet …«
Florian hob abwehrend die Hand. »Ich bin nur froh, dass wir keine haben; das würde jetzt alles noch schlimmer machen! Nein. Ich weiß im Augenblick nicht, was ich tun soll. Der Gedanke, dass Katharina einen anderen liebt, macht mich rasend, und wie soll unser Zusammenleben in der Wohnung aussehen? Wird sie ihren Kerl etwa mitbringen? Ich will Katharina nicht verlieren, aber im Augenblick fühle ich mich so – so ohnmächtig vor lauter Schock; ich muss den erstmal verdauen. Vielleicht ist Boris’ Idee wirklich nicht übel. Abstand, um den Kopf freizukriegen, die Balance wiederzufinden, verstehst du? Und ich werde ihr nicht sagen, wo ich hingehe; soll sie sich ruhig Sorgen machen! Die Bretagne ist so weit weg …«
»Die Bretagne?«, echote seine Oma.
»Ja, da ist Boris’ Ferienhaus.«
»Wo – ist das Haus genau?« Marlene sah ihren Enkel unverwandt an.
»In einem Dorf, ich habe den Namen vergessen. Egal, es liegt auf der Halbinsel Crozon, ganz im Westen.«
Marlene schloss die Augen, atmete tief durch. »Ich weiß, wo Crozon ist. Ich war auch einmal in der Bretagne«, sagte sie dann langsam. »Im Krieg. Da war ich als Funkhelferin auf Crozon stationiert.«
»Nein!« stieß Florian aus. »Du? Du warst im Krieg? Als Funkhelferin?«
Wortlos rappelte seine Oma sich von ihrem Sessel auf und ging an den Kleiderschrank.
»Was tust du? Soll ich dir helfen?«, fragte Florian schnell, als er sah, wie seine Oma – seine liebe, sanfte Oma, die im Krieg gewesen war?! – sich vor dem geöffneten Schrank auf die Zehenspitzen stellte, um mit den Händen im obersten Fach herumzutasten. Sie wusste genau, irgendwo hinter ihren Hüten musste es liegen … Endlich spürten ihre Finger den Karton des Einbandes. Sie bekam das Buch zu fassen und zog es heraus.
Die Buchdeckel waren einst tiefschwarz gewesen, mittlerweile aber zu einem Dunkelgrau-Lila verblasst. Gedankenverloren sah Marlene ihr teures Buch an und schlug behutsam die erste Seite auf. Sie biss sich auf die Lippen. Wie lange das her war! Am anderen Ende ihres Lebens.
»Was ist das?«, fragte Florian vom Bett aus.
Ruckartig klappte Marlene die Kladde zu und zögerte. Sollte sie wirklich? Sie sah in das arglose Gesicht ihres Enkelsohns. »Ausgerechnet Crozon«, sagte sie halblaut und mehr zu sich selbst. Ein Wink des Schicksals, setzte sie in Gedanken hinzu. Dann ging sie zu Florian und hielt ihm das Buch hin. »Ich möchte, dass du das mitnimmst, in die Bretagne. Würdest du es lesen?«
Florian schlug seinerseits die Kladde auf. »Ist das ein Tagebuch? Etwa aus dem Krieg?«, fragte er schwach, mit Blick auf die Jahreszahl 1942. Das einzige, das er ohne weiteres entziffern konnte.
»Genau«, Marlene nickte.
»Das ist in Sütterlin geschrieben«, murmelte Florian, intuitiv voller Abwehr gegen die ungeahnte Vergangenheit seiner Großmutter, ihre aktive Teilnahme an diesem unsäglichen Krieg.
»Das ist gar keine Sütterlinschrift, das ist die Offenbacher Schrift!«, korrigierte Marlene ihren Enkel.
»So.« Florian zog eine Augenbraue hoch.
»Ja. Kannst du die nicht mehr lesen? Das lässt sich schnell lernen.« Florian sah seine Oma bittend an. Konnte sie nicht verstehen, dass
es ihm ohnehin schlecht ging und dass es nicht der richtige Zeitpunkt war, ihm ihre Kriegserinnerungen zum Lesen zu geben? Kriegserinnerungen! Von der Westfront, so sagte man wohl?
»Schon gut, wenn du nicht willst«, sagte Marlene bekümmert und hastig und wollte das Tagebuch wieder an sich nehmen.
Florian hielt die Kladde fest und zwang sich zu einem Lächeln.
»Natürlich werde ich dein Tagebuch lesen, Oma, wenn du das möchtest. Bestimmt gibt es im Internet Schrifttabellen der Sütterlinschrift.«
»Offenbacher Schrift, Sütterlin war davor. Schön. Schön schön«, murmelte Marlene, halb erleichtert, halb alarmiert.
»Oma – erwarten mich da sehr schreckliche Enthüllungen in deinem schwarzen Buch? Hast du deshalb nie jemandem von uns verraten, dass du mal an der Westfront warst? Oder weiß Mama davon?«
Marlene befeuchtete ihre Lippen, ehe sie antwortete: »Deine Mutter weiß nichts. Aber – ich habe auf Crozon etwas ganz Wunderbares erlebt, etwas Unvergessliches. Zugleich war es auch schrecklich, ja; daher, wer wollte nach dem Krieg schon über solche Dinge reden? Und dennoch: Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde es nie, niemals ungeschehen machen! Und wenn du am Ende alles gelesen haben wirst, wirst du verstehen, warum.« Sie sah ihren Enkel an; treuherzig, bittend, ängstlich.
»Ich lese dein Tagebuch Oma«, wiederholte Florian sein Versprechen und nahm die alte Frau in die Arme.

Nachdem ihr Enkelsohn gegangen war, konnte Marlene sich nicht einfach wieder in den Sessel setzen und Zeitung lesen. Crozon! Dass ihr Tagebuch nach Crozon reisen sollte, ohne sie, aber mit Florian, das bewegte sie zutiefst. Was würde er von ihr halten? Und war es richtig gewesen, ihn abreisen zu lassen? Hätte sie darauf beharren sollen, dass er bleiben möge, um mit seiner Katharina zu reden? Für seine Ehe war die Reise in die Bretagne nicht gut, bestimmt nicht! Und doch hatte sie, seine Oma, nichts getan, um ihren Enkelsohn aufzuhalten. Nein. Sie hatte ihm die Kladde gegeben und ihn aufgefordert, sie dorthin mitzunehmen – ja, sie hatte sich sofort in die Vorstellung vernarrt, wie Florian die Orte sehen würde, an denen es damals geschah – diese Orte, die mittlerweile in ihrem Gedächtnis verschwommen waren, doch manchmal, in Träumen, erschütternd real wiederauftauchten … Ach, was würde er von ihr und alledem halten? Fortan würde sie keine ruhige Minute mehr haben. Sie würde mit dieser Frage leben müssen: Wie viel weiß er schon?

Zu Florians Erleichterung war Katharina nicht da, als er nachhause kam. Er packte eine kleine Reisetasche mit Kleidung, schob das Tagebuch seiner Oma dazu, suchte und fand im Internet eine Buchstabentafel mit der Offenbacher Schrift und druckte sie aus. Dann suchte er per Routenplaner eine Reiseroute nach Mengleuff auf der Halbinsel Crozon, fand zwei Varianten und druckte die kostengünstigere Nordroute über die Normandie ebenfalls aus. Boris’ Protzauto hatte zwar ein Navigationssystem, aber Florian hatte keine Lust, sich damit vertraut zu machen.
Fast hätte er das Wichtigste vergessen, den Haustürschlüssel, die Bretagnekarte und das Blatt mit Tipps und Regeln, das Boris ihm noch gegeben hatte. Er steckte alles zu den anderen Dingen in die Reisetasche. Dann ging er an das Telefon, griff nach einem Zettel und einem Stift. »Bin für ein paar Tage weg, Florian«, schrieb er, drehte den Stift zwischen den Fingern, setzte aber nichts weiter hinzu. Er legte die Mini-Nachricht auf den Küchentisch, dann fiel ihm ein, den Wasserkocher mitzunehmen. Und ein Glas Schnellkaffee. Nur für alle Fälle, um an seinem ersten Morgen in der Bretagne zumindest damit versorgt zu sein. Boris hatte aufreizend wenig zur Ausstattung seines Ferienhauses gesagt.
Vor dem Haus erwartete ihn der Porsche Cayenne. Florian stieg ein und runzelte die Stirn. Zu viel Hightech-Schnick-Schnack, für seinen Geschmack. Sowieso, er mochte keine SUVs. Er startete. Vor ihm lag eine Reise von tausendzweihundert Kilometern. Genug Distanz zwischen ihm und Katharina.

Ein Lichtblitz riss Florian aus seinen Gedanken. Wie hatte er das Vergessen können? In Belgien waren nur hundertzwanzig Stundenkilometer auf der Autobahn erlaubt! Zermürbt rieb er sich die müden Augen. Er brauchte eine Pause.
In einem Rasthof bei Lüttich aß Florian ein lappiges Sandwich und trank dazu Kaffee. Währenddessen holte er das Handy aus der Tasche und schaltete es ein. Sofort piepte es los, er hatte mehrere neue Nachrichten. Hastig schaute Florian die Absender durch. Da! Vier von Katharina! Und eine von Boris. Er zwang sich dazu, die von Boris zuerst zu lesen: »Habe Verwalter informiert«, stand auf dem Display. Soso, es gab sogar einen Verwalter. War echt freundschaftlich von Boris, ihm so beizustehen. Nein, er würde ihm jetzt nicht den Tag versauen durch die Ankündigung eines Strafmandates. Das würden sie später regeln, wenn es soweit war. Und – Katharina? Nein. Nein, es war ausgeschlossen, dass ihre Nachrichten Zärtlichkeiten enthielten. Eher das Gegenteil. Er schaltete das Handy aus und verließ die Raststätte.

War es die hohe Temperatur, war es seine Müdigkeit bei gleichzeitiger innerer Unruhe? Von dem Moment an, in dem er in Nordostfrankreich von der Autobahn abfuhr, um Mautgebühren zu sparen, geriet Florian in einen merkwürdigen Zustand. Wie in Trance sah er eine Landschaft an sich vorüberziehen, die er trostlos fand wie seine Stimmung. Weite, ebene Flächen; riesige Felder, auf denen Heuwürfel sich stapelten. Weiler, die nur aus einer Durchfahrtsstraße bestanden mit Häusern aus dunkelrotem Backstein. Dann wieder Menschenleere, nur die Spitzen entfernter Kirchtürme zeigten hier und da verstreute Ortschaften an. Friedhöfe lagen an der Landstraße, lauter Soldatenfriedhöfe aus dem ersten Weltkrieg.
In Amiens rüttelte Florian sich wach, stärkte sich mit Pizza und weiterem Kaffee, entdeckte auch ein sympathisch aussehendes Hotel nahe der Kathedrale, war aber zu aufgewühlt, um an Schlafen zu denken. Also weiter. Immer weiter, Richtung Westen, vorbei an riesigen Feldern von Windrädern. Im Gegenlicht der untergehenden Sonne sahen sie schön aus, mit ihren regelmäßigen, majestätischen Flügelbewegungen, aber auch bedrohlich, wie Wesen mit einem Eigenleben aus einem Science-FictionFilm. An Aumale vorbei, in die Normandie. Die Landschaft nun hügelig, mit Dörfern aus alten Fachwerkhäusern. Forges-les-Eaux, ein Miniatur-Kurort mit Kasino und einem See, über den weiße Schwäne ihre Kreise zogen. Und dann – zack! Florian blinzelte. Der zweite Blitzer des Tages! »Sorry, Boris«, sagte Florian laut und bretterte trotzig weiter.
Doch nach Caen und dem zweiten Sekundenschlaf sah er ein, dass er bald ein Hotel suchen musste. Bayeux, der Name sagte ihm etwas; war da nicht dieser uralte Teppich mit den Bildern der NormannenSchlacht? Florian gähnte – und fuhr zusammen, als er dem dritten Wegelager des Tages in die Falle ging! War ganz Frankreich gespickt von solchen Dingern?! – Prompt verließ Florian Bayeux wieder, um über die nächstbeste Landstraße nach Porte-en-Bessin-Huppain zu gelangen, aber kein Hotel in dem Kaff zu sehen. Also weiter, in den nächsten Ort. Florian ließ die Fensterscheibe herunter, der salzige Geruch des nahen Meeres weckte ein wenig seine Lebensgeister. Und dann, nachdem er das Ortsschild von Colleville-sur-Mer passiert hatte, sah er es, an einem älteren Gebäude: das Wort »Hôtel«. Er bremste scharf und parkte am Straßenrand.
»Après douze heures, sonnez s. v. p.«, stand auf einem Schild am Eingang. Darunter auf Englisch: »After midnight, ring the bell please«.
Es war gegen ein Uhr morgens. Florian drückte den Klingelknopf. Eine Weile tat sich gar nichts. Sollte er etwa im Cayenne übernachten? Er klingelte noch einmal.
»J’arrive!«, rief eine tiefe Stimme aus dem Inneren des Hauses.
Jemand schloss die Tür auf und dann stand Florian vor einer alten gebeugten Frau in Morgenmantel und Pantoffeln, die ihn misstrauisch von unten anschaute.
»Can I have a room for one night, please?«, fragte Florian. Er war zu kaputt, um zu versuchen, Französisch zu reden. Er hatte zwar von der siebten bis zur elften Klasse Französisch in der Schule gehabt, aber das war lange her, und er war damals zu faul gewesen, um regelmäßig Vokabeln und Grammatik zu lernen.
Die alte Frau nickte und trat einen Schritt zurück, um ihn hineinzulassen. Florian folgte ihr an den Tresen, auf dem nichts stand als eine Vase mit drei kleinen Flaggen. Der französischen, der britischen und der amerikanischen. Wo bin ich denn hier hingeraten, fragte Florian sich, während die Alte in einem Buch blätterte und ihm dann einen Schlüssel reichte. »7«, stand auf dem Plastikschild daran.
»American?«, fragte sie.
»No, German«, antwortete Florian vorsichtig und sein Blick schweifte zurück zu der Vase mit den drei kleinen Flaggen. Er begriff: Der Sturm auf die Normandie, der Einfall der Alliierten – das musste sich irgendwo hier abgespielt haben, an dieser Küste.
»Ah«, knurrte die Alte, und Florian meinte, einen scheelen Blick von ihr einzufangen.
»C’est en haut«, sagte sie und wies mit der Hand Richtung Treppe.
»Merci«, erwiderte Florian doch auf Französisch, was ein winziges Lächeln in die zuvor nach unten gezogenen Mundwinkel seines Gegenübers zauberte.
Zimmer Nummer 7, das Florian rechts am Ende eines engen, dunklen Korridors fand, war mit einem Doppelbett, einem Schrank, einem Tisch und einem Stuhl möbliert. Auf dem Tisch stand ein kleiner dickbauchiger Fernseher. Florian legte sich auf das Bett. Nur kurz ausruhen, dachte er, und dann die Tasche aus dem Auto holen.
3. Unterwegs
Es führte zu nichts, länger im Bett zu bleiben und zur Decke zu starren. Überhaupt, dieses schreckliche Bett! Nach ihrer ersten Nacht im Garten war Marie doch in Elodies Schlafzimmer eingezogen. Nur, bei jedem Herumwälzen, und Marie schlief unruhig, quietschten die Federn der alten Matratze wie eine Katze, der man auf den Schwanz tritt, und das ganze Bett geriet ins Wanken wie eine Boje auf hoher See.
Wie eine Greisin schob Marie in Zeitlupe erst das linke, dann das rechte Bein von der Matratze. Sie griff sich an den Kopf. Schon wieder Kopfschmerzen, nach einer weitgehend durchwachten Nacht. Aber sie hatte sich vorgenommen, keine Schlaftabletten mehr einzuwerfen. Und jede zweite oder dritte Nacht gelang es ihr doch, vor Übermüdung zu schlafen.
Sie tappte hinunter ins Erdgeschoss und öffnete die Fensterläden. Aus dem linken Fenster beugte sie sich weit hinaus, um ihre Hortensien zu bewundern. Seitdem sie in Mengleuff war, hatte sie sie Tag für Tag und Woche für Woche mit viel Wasser und Liebe und gutem Zureden vor dem Vertrocknen gerettet. Sie liebte die zwischen rosa und hellblau changierende Farbe der prächtigen Blüten, den Duft, den sie verströmten. Sie liebte die den Pflanzen innewohnende Kraft, die eine solche Wiederauferstehung ermöglicht hatte. Die Hortensien sahen wieder prächtig aus, keine Fragen. Und wie ihre Hortensien, so würde auch sie selbst, Marie Cadiou, aus ihrem Tief wieder herauskommen, schwor sie sich – wie jeden Morgen, beim Öffnen der Läden. Aber leicht war das nicht.

Licht drang durch Florians geschlossene Augenlider. Dann die Erinnerung, der Schlag in die Magengrube. Langsam öffnete er die Augen.
Eine Weile starrte er nur an die Decke, versuchte zu verdauen, dass das alles kein bloßer Alptraum war, sondern die Realität. Katharina. Wie konnte sie ihm das antun?
Endlich rappelte er sich auf und kam am Bettrand zum Sitzen. Wie hässlich das primitive Hotelzimmer bei Tageslicht war. Die großgeblümten Tapeten wiesen in den Ecken des Raumes Risse auf und ihr weißer Grund war vergilbt. Eine leichte Übelkeit überkam Florian, er musste aufstehen und zum Fenster gehen, er brauchte Luft. Doch als er die alte Gardine beiseite zog, schreckte er zusammen. Sein Blick fiel auf schier endlose Reihen von weißen Kreuzen.
Er rieb sich die Augen. Das war doch ein Alptraum. Er musste weg hier. Duschen, frühstücken, weg hier. Halt, seine Tasche. Ans Auto musste er zuerst.
Draußen roch es nach Seeluft. Das tat gut, Florian sog begierig die salzige Luft ein. Auch den Cayenne vor dem Hotel vorzufinden, hatte etwas Beruhigendes. Er holte sein bescheidenes Gepäckstück aus dem Kofferraum und ging zurück in das Hotel, das bei Tageslicht auch von außen noch trostloser aussah.
Er fand die Dusche am anderen Ende des Korridors auf der Etage seines Zimmers; und keine halbe Stunde später saß er mit feuchten Haaren in dem kleinen Frühstücksraum. Es war gerade neun Uhr. Wortlos stellte die alte Frau, deren Bekanntschaft er in der Nacht
gemacht hatte, einen Korb mit Baguettestücken vor ihn. Dazu stellte sie einen Teller mit verpackten Butterstücken und kleinen Plastiktöpfchen mit Marmelade. Schade, keine Nutella. »Du café ou du thé?«, fragte die Alte dann, und nachdem Florian Kaffee bestellt hatte, schlurfte sie aus dem Raum.
Während Florian auf den Kaffee wartete, sah er durch das Fenster auf die unbelebte Straße. Vielleicht lag es daran, dass der Himmel bedeckt war, aber die verwitterten Fassaden der Häuser und das halb verrottete Schild »A vendre« im Ladenhaus gegenüber wirkten auf ihn bedrückend. Dieser Ort sah aus, als wäre er vom Aussterben bedroht. Aber vielleicht sah er das nur so, weil es ihm selbst so schlecht ging.
Die alte Frau kam mit dem Kaffee. Eine große Tasse voll, er roch gut, eine dünne Schicht Milchschaum lag auf der Oberfläche. Neben die Tasse stellte die Frau eine Dose Zucker.
Der Kaffee schmeckte ausgezeichnet, stark, aber nicht bitter, und die Baguette war frisch und eben so, wie französische Baguette sein sollte. Erst beim Essen merkte Florian, dass er Hunger gehabt hatte. Während er auf einen zweiten Kaffee wartete, sah er schon munterer durch den Frühstücksraum. Erst jetzt fiel ihm das Tischchen in der Ecke neben der Eingangstür auf, auf dem verschiedene Prospekte lagen. Er schlenderte hin und überflog den Flyer eines »D-Day-Museums«. Jaja, so war das. Der Zufall hatte es so gewollt, dass er hier gelandet war, an diesem Ort, der direkten Bezug zum zweiten Weltkrieg hatte und zur Westfront – einen Bezug zu seiner eigenen Oma … Florian seufzte und legte den Flyer zurück. Das D-Day-Museum im benachbarten Arromanches würde er nicht besichtigen; aber vor der Abreise würde er noch einen Blick auf den Friedhof werfen, dessen Anblick ihn nach dem Aufstehen so erschreckt hatte.
Sechzehntausend amerikanische Soldaten seien hier beerdigt, las Florian auf einem Informationsschild, ehe er nach dem Auschecken den Friedhof durch ein breites Tor betrat. Er sah um sich. Parallele Reihen von weißen Kreuzen, ein riesiges Feld davon. Er begann, aufs Geratewohl eine Reihe abzuschreiten, las beiläufig Namen und Geburtsdaten, begann, im Kopf zu rechnen. Hier waren nur junge Männer beerdigt. Richard Brown, knappe zwanzig geworden; Euston McCullom, einundzwanzig; Jeffrey Pendleton, zwanzig … Ich lebe schon fünfzehn Jahre länger als Jeffrey Pendleton; in fünf Jahren habe ich doppelt so lange gelebt wie dieser junge Mann, der 1944 in das Abwehrfeuer der Deutschen gelaufen ist.
»Hey, guys, come here!«
Florian fuhr herum. Zwei Kreuzreihen weiter sah er sie, die drei Männer. Sie waren mittleren Alters, trugen Armeehosen, Baseballkappen und große Fotoapparate in den Händen. Jetzt lichteten sie sich gegenseitig vor einem Grab ab. Lachend, laut und aufgeregt durcheinander redend.
Irritiert wandte Florian sich ab. Was waren das für merkwürdige Typen? Touristen, die die »D-Day-Küste« life erleben wollten? So etwas gefiel ihm gar nicht. Er verließ den Friedhof und stieg in den Cayenne.

Jeden Tag machte Marie sich ein straffes Programm; es gab immer genug zu tun, in Mengleuff, und sich abrackern war der beste Weg, um die Trauer abzuarbeiten; oder fortzuschieben, zumindest. Die Trauer um den Mann, an den sie nicht mehr denken durfte und nicht mehr denken wollte; denn er hatte nicht vor – nach fast drei Wochen ohne Lebenszeichen von ihm hatte er wirklich nicht vor, um sie zu kämpfen. (Aber die Hoffnung stirbt leider immer zuletzt; und dieses allmähliche Absterben tat weh, so weh …) Wenn Marie aber einmal Pause machen und mit einem Menschen reden wollte, der ihr ein kleines Gefühl der Geborgenheit gab, dann ging sie zu Yvonne Le Roux.
Yvonne war mittlerweile die Dorfälteste und gehörte für Marie untrennbar zu Mengleuff. Sie war »schon immer« da gewesen; nämlich soweit Maries Erinnerung an Mengleuff reichte. Yvonne strahlte eine unglaubliche Ruhe und gewitzte Weisheit aus; und sie hatte den schönsten Garten des Dorfes. Die alte Dame liebte Blumen. Sie hatte ein Meer verschiedenster Sorten davon, dazu aber auch nutzbare Pflanzen: Gemüse, Himbeer- und Stachelbeerbüsche und alte Apfelbäume. Dazwischen gackerten freilaufende Hühner. Deshalb hatte das Haus mit dem idyllischen Garten ein Gartentor, das niemals offenstehen durfte.
Marie lehnte sich über dieses Tor und rief: »Bonjour! Darf ich reinkommen?«
Yvonne saß auf dem Bänkchen neben der Haustür und schälte Kartoffeln. Die Schalen ließ sie in ihre karierte Schürze fallen, die geschälten Kartoffeln plumpsten in einen zerbeulten Eimer aus Blech. »Komm nur, Marie Cadiou, aber schließe das Törchen, wegen der Hühner!«
Marie tat es und setzte sich auf eine Geste der alten Dame hin neben diese auf die Bank.
»Na, hast du dich inzwischen gut eingelebt?«, erkundigte sich
Yvonne. Sie konnte schälen, fast ohne hinzusehen.
»Ich komme gut voran mit dem Renovieren«, antwortete Marie ausweichend. »Den Dielenboden musste ich gar nicht abschleifen, ölen genügte. Meinen Teppich aus der alten Wohnung habe ich in das Schlafzimmer gelegt, ein Berber in warmen Farben, sieht gleich ganz anders aus. Die Tapeten im Schlafzimmer sind cremeweiß, unten habe ich weiß mit einem Hauch von gelb gestrichen. Ist wirklich schön. Aber die Plackerei mit dem Entleeren und Verschieben aller Möbel! Und dann gibt es noch ein Zimmer komplett zu renovieren, in dem hat früher mein Großvater geschlafen, als Kind …« Marie musste gähnen.
»Du arbeitest zu viel. Warum hilft dir niemand? Hast du keinen Freund?«, fragte Yvonne geradeheraus.
Marie wollte aufspringen. Die Vernunft hielt sie davon ab. »Ich habe einen besten Freund, er heißt Pierre, der wird mir bei den noch ausstehenden Möbeltransporten helfen«, brachte sie hervor.
»Und deine Eltern?«
»Bloß nicht!«
Verblüfft hielt Yvonne mit dem Schälen inne, und Marie erklärte müde: »Sie wissen vielleicht, dass mein Vater Elodies Patensohn war. Da dachte er … oder besser, meine Eltern dachten beide, sie würden ihr Haus erben. Wie ich mittlerweile erfahren habe, sind sie die letzten zehn Jahre lang, als Elodie nicht mehr kam, regelmäßig hierher gefahren, um das Haus instand zu halten. Ich wusste davon nichts; und überhaupt, ich kann nichts dafür, dass Elodie mir das Haus vermacht hat – warum auch immer!«
Yvonne Le Roux legte den Kopf schief. »Hauptsache ist, dass das alte Haus der Cadious wieder bewohnt ist. Es stehen so viele Häuser leer. Auch das neben deinem. Wie schade. Früher lebte die Familie Lévénès darin. Fünf Kinder. Was aus denen allen geworden ist? Der Vater war Dachdecker.«
»Dann ist es aber lange her, dass die Familie Lévénès nicht mehr in dem Haus wohnt! Ein Dachdecker hat sich dem Dach ewig nicht mehr genähert. Die losen Schieferplatten fallen herunter wie Regen.«
»Siehst du, schade. To pa ri ti, Pa ri ti to1, sagt das Sprichwort. Dein Haus braucht ein Dach, und solange das Dach hält, kannst du dein Haus retten. Ist das Dach futsch, hast du bald eine Ruine.«
»Wem gehört das Haus denn inzwischen?«
»Einem deutschen Monsieur. Aber den habe ich nur einmal vor Jahren gesehen. Ab und zu kommt ein Mann, der ein bisschen Rasen mäht und Efeu zurückschneidet. Aber das genügt nicht. Das Haus verfällt, wenn nicht bald etwas geschieht. Der deutsche Monsieur müsste kommen. Schade, schade.« Yvonne zuckte die Achseln.