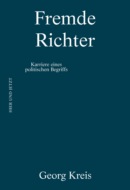Kitabı oku: «Völkerrecht», sayfa 3
Kolonisierung
Das europäische Völkerrecht war, wie euphemistisch oft formuliert wird, von Anbeginn an «kolonisierungsfreundlich». Deutlicher: Es war bereits seit seinen Anfängen und für lange Zeit ein wichtiges Rechtfertigungsinstrument für koloniale Unterdrückung. Das spätmittelalterlich-christliche Recht hatte diese Rolle vorgespurt. Die «bellum iustum»-Lehre hielt Kriege gegen Ungläubige grundsätzlich für gerechtfertigt. Legitimiert wurde die Gewaltanwendung oft mit der Missionierungspflicht der Christen, dem funktionalen Äquivalent zur muslimischen Pflicht des Dschihads. Das Recht spielte in der Folge auch bei der Rechtfertigung der Grossunternehmung «Kolonisierung» eine strategische Rolle. Eroberungen von fremden Kontinenten wurden nicht situativ, sondern grundsätzlich gerechtfertigt – und vor allem wurden sie rechtlich gerechtfertigt. Eine entscheidende Weichenstellung war, wie der Historiker Jörg Fisch zu Recht herausgehoben hat, in Kategorien von Rechten und Ansprüchen über das Thema zu verhandeln.22 In den meisten Gebieten der Erde kam es zu einer kürzeren oder längeren Kolonialherrschaft. Man bediente sich einer verharmlosenden Sprache, indem Eroberungen in Entdeckungen umgedeutet wurden, und Völkerrechtler diskutierten dann die Frage, wann ein Gebiet als «entdeckt» gelten konnte.
Drei Grundmuster der rechtlichen Rechtfertigung kolonialer Eroberungen lassen sich unterscheiden.23 Das erste war «Expansion als Auftragserfüllung». Es ist im 16. Jahrhundert etwa beim spanischen Theologen Francisco Suarez (1548–1617) zu finden. Suarez behauptete, dass Gott den spanischen Kolonisatoren Vollmacht zur Verkündung des Evangeliums erteilt habe und dass dies die Zulässigkeit von Eroberungen voraussetze. Die Auftragsidee sollte später, insbesondere im 19. und frühen 20. Jahrhundert, in Gestalt der Idee der «civilizing mission», noch einmal eine zentrale Rolle spielen.24 Sie blieb bis in die Völkerbundzeit lebendig, als man bei den auf die Unabhängigkeit vorzubereitenden Völkern verschiedene Entwicklungsgrade unterschied, A-, B- und C-Mandate; die Mandatsmacht – der Beauftragte – sollte das Kolonialvolk an den für die Völkerrechtsfähigkeit erforderlichen Entwicklungsstand heranführen.
Das zweite Rechtfertigungsschema war «Expansion als Verteidigung der natürlichen Ordnung». Es ist im 16. Jahrhundert beim bereits erwähnten Francisco de Vitoria (1483–1546) zu finden. Wer die Verkündung des Evangeliums verhindere, argumentierte er, schaffe einen legitimen Kriegsgrund, genauso wie der, der das Recht auf Handel und Niederlassung verweigere. Das dritte Muster schliesslich war das «Nichtwahrnehmen» von Nichtchristen. Es ist das arroganteste und wirksamste der drei. Viele Anhänger des päpstlichen Universalismus argumentierten, Ungläubige seien prinzipiell nicht rechts- und schon gar nicht eigentumsfähig. Sie begingen wegen ihres falschen Glaubens eine Todsünde gegen Gott und würden dadurch Rechts- und Eigentumsfähigkeit verwirken. Später spielte das Schema bei der rechtlichen Einordnung von Indianerstämmen eine Rolle. Man schloss mit ihnen zwar zivilrechtliche Verträge, kaufte ihnen Handelsgüter und Boden ab, betrachtete ihre Gebiete völkerrechtlich aber als unbewohnte Territorien. Dafür verwendete man teilweise die aus dem römischen Recht geliehene Formel «terra nullius»: das Gebiet, das niemandem gehört.25 Die Eroberung eines von Indianern bewohnten Gebiets war deshalb keine Annexion, sondern blosse Okkupation. Bei der rechtlichen Begründung der gut 500 Jahre dauernden Kolonialisierung der Welt durch die Europäer gab es eine bemerkenswerte Kontinuität der Argumente.
Seitenblick: Alte Eidgenossenschaft
Das Herauswachsen der Alten Eidgenossenschaft aus mittelalterlichen Strukturen war Teil der Entstehung des modernen Staatensystems. Sie blieb bis zum Dreissigjährigen Krieg ein Bündnissystem innerhalb des Heiligen Römischen Reichs, ab dem 15. und insbesondere 16. Jahrhundert mit verstärkter relativer Autonomie der reichsunmittelbaren, das heisst direkt dem Kaiser unterstellten alteidgenössischen Orte. Die Konfessionsspaltung hatte auch hier bedeutende Folgen. Zum einen ergaben sich bis ins 18. und 19. Jahrhundert heftige Konflikte zwischen den Konfessionen, die teilweise mittels Kriegen ausgetragen wurden. Erwähnt sei etwa der Erste Villmergerkrieg von 1656, in dem die protestantischen Orte vergeblich versuchten, die starke Stellung der Katholiken zu schwächen. Zum anderen büsste die Alte Eidgenossenschaft ihre aussenpolitische Handlungsfähigkeit unter dem Vorzeichen der Bikonfessionalität zu einem grossen Teil ein. Sie war wegen ihrer eigenen Gespaltenheit gezwungen, sich aus Streitigkeiten anderer tendenziell herauszuhalten. Als souverän anerkannt wurden die Alten Orte am Ende des Dreissigjährigen Kriegs. Sie schieden damals aus dem Reich aus.26 Wer aber war nun souverän – die dreizehn Alten Orte für sich oder das Bündnissystem? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Der Friede von Osnabrück von 1648 nannte zwar die «Kantone der Schweiz» als Parteien, aussenpolitisch handelten die Kantone aber nicht jeder für sich. Seit dem Eintritt Basels in das eidgenössische Bündnissystem 1501 galt vielmehr die Regel, dass äussere Kriege nicht ohne Zustimmung der Tagsatzungsmehrheit geführt werden durften. Zudem verlangten die Mächtigen verschiedentlich, etwa Ludwig XIV. und später Napoleon, dass die Eidgenossen mit einer Stimme sprechen sollten. Die Frage der Souveränität blieb in der Schwebe.
Folgenreich war für die Eidgenossenschaft auf lange Sicht, dass Säkularisierung und Gleichgewichtsdenken in Europa ihre Möglichkeiten verbesserte, sich aus den Konflikten herauszuhalten. Anders als bei einem Denken in den religiösen Kategorien «gut» und «böse», konnte Unparteilichkeit unter den Vorzeichen säkularen Denkens bei Interessengegensätzen eine Pufferfunktion für das Gesamtsystem übernehmen. Stiess eine unparteiliche Haltung während des Dreissigjährigen Kriegs noch auf grosse Skepsis, wurde es nach dem Ende des Dreissigjährigen Kriegs für Nichtkriegführende einfacher, ihre Stellung durch Abmachungen mit den Konfliktparteien abzusichern. 1674 erklärte sich die Tagsatzung erstmals offiziell für neutral, wobei Neutralität noch kein rechtliches und auf Dauer angelegtes Konzept war. Viele Staaten erklärten sich in der frühen Neuzeit punktuell für neutral. Es handelte sich keineswegs nur um kleinere Staaten, sondern durchaus auch um Grossmächte wie etwa Preussen. Zu einem dauerhaften Element der Positionierung im Staatensystem wurde Neutralität allerdings nur bei ganz wenigen, und ein eigentliches Neutralitätsrecht aus einem Bündel von Rechten und Pflichten entwickelte sich erst ab Mitte des 18. Jahrhunderts.27 Der aus Neuenburg stammende Emer de Vattel (1714–1767), zeitweise in kursächsischen Diensten, hatte an der Verrechtlichung grossen Anteil. Neutralität war in seiner naturrechtlichen Völkerrechtslehre bereits ein Rechtsstatus, der auf einseitige Erklärung des Betroffenen hin zustande kommt. Ab etwa 1780 kann man von einem rechtlich grundierten Neutralitätsstatus sprechen. In diesem Jahr hatten verschiedene bedeutende Staaten – darunter Russland, Preussen und Frankreich – erklärt, im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg neutral zu bleiben und diese Neutralität gegebenenfalls bewaffnet zu verteidigen.
19. Jahrhundert und Erster Weltkrieg

Vielfältige Formen imperialer Beherrschung: Wettstreit der Grossmächte um Einfluss in China.
Stabilisierung durch Völkerrecht
Die Französische Revolution und die Machtergreifung durch Napoleon führten zu einer mehr als zwanzig Jahre dauernden Periode von Kriegen in Europa. In den Auseinandersetzungen, die als «Koalitionskriege» bezeichnet werden, kämpften verschiedene Allianzen gegen das revolutionäre und später napoleonische Frankreich.28 Nach Frankreichs Niederlage kam es in Wien, wie nach dem Dreissigjährigen Krieg in Westfalen, zu einer Staatenkonferenz. Sie legte die Grundparameter der internationalen Ordnung neu fest. Der Wiener Kongress schuf eine Ordnung, die – nach überwiegender Meinung – in den Grundzügen bis zum Ersten Weltkrieg Bestand hatte und angesichts der gewaltigen ökonomischen und sozialen Veränderungen während dieses Jahrhunderts von bemerkenswerter Dauer war.29
Die neue Ordnung beruhte im Wesentlichen auf drei Elementen: der Rückkehr zum dynastischen Prinzip, bald in Anlehnung an eine Formulierung des Schweizer Staatsrechtlers Karl Ludwig von Haller als «Restauration» bezeichnet; moderner Diplomatie auf der Grundlage des Gleichgewichts der Mächte; schliesslich einer bedeutenderen Rolle des Völkerrechts. Dem Völkerrecht war in der post-napoleonischen Friedensordnung eine wichtigere Rolle zugedacht als in der Ära nach dem Westfälischen Frieden. Man setzte darauf, die internationalen Beziehungen durch Verträge zu stabilisieren. Beispiel ist etwa der Londoner Vertrag von 1839. Die Grossmächte garantierten – im Interesse europäischer Stabilität – die Neutralität Belgiens. Jener Neutralität bemerkenswerterweise, deren Bruch 75 Jahre später durch den Angriff Deutschlands auf Belgien den Beginn des Ersten Weltkriegs markieren sollte.
Merkmal der Ordnung nach 1815 war auch eine stärker hervorgehobene Stellung der Führungsmächte. Grossbritannien, Russland, Österreich, Preussen und bald auch wieder Frankreich übernahmen gemeinsam eine Rolle, die später manchmal als die eines «Sicherheitsrats des 19. Jahrhunderts» bezeichnet wurde. Hervorgehoben waren die Grossmächte allerdings nur politisch, nicht völkerrechtlich. Sie hatten, anders als heute die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, keinen rechtlichen Sonderstatus. Die als sogenanntes Konzert der Grossmächte oder Pentarchie bezeichneten Führungsmächte unternahmen aber einen ersten Versuch, in Europa ein gemeinsames internationales Konfliktmanagement durch sie selbst zu betreiben. Das System funktionierte in den ersten Jahren nach dem Wiener Kongress einigermassen und spielte mindestens bis zum Krimkrieg (1853–1856) eine Rolle.30 In der Orientkrise von 1839 bis 1841 etwa verhinderten die Grossmächte, die sich als Hüter des Gleichgewichts verstanden, eine Herauslösung Ägyptens aus dem Osmanischen Reich.
Geistige Grundlagen des Völkerrechts
Geistige Grundlage des Völkerrechts in seiner frühen neuzeitlichen Phase war ein verbleibendes Gefühl der Zusammengehörigkeit innerhalb der Westchristenheit gewesen. Trotz aller Differenzen und Gegensätze gab es eine gemeinsame kulturelle Prägung durch den römisch-christlichen Glauben, von dem der Protestantismus mehr Variante als Gegensatz war. Über Jahrhunderte hatten Kaiser und Papst die Idee der Einheit der Welt verkörpert. Diese Idee lebte symbolisch über den Dreissigjährigen Krieg hinaus im weiterhin bestehenden, nun aber entsakralisierten Kaiseramt weiter. Eine verbindende Klammer war auch die lateinische Sprache als Lingua franca der Gelehrten gewesen. Noch die Westfälischen Friedensverträge wurden lateinisch abgefasst. Latein war politisch neutral, da es nicht die Sprache einer Grossmacht war. Wer es benutzte, bewegte sich im geistigen Horizont einer gemeinsamen abendländischen Kultur, als deren Wurzeln, verstärkt durch Renaissance und Humanismus, die griechisch-lateinische Antike verstanden wurde. Auch das Nachwirken der europäisch mittelalterlichen Ritterkultur trug zu einer gewissen Restsolidarität bei, die die Grundlage der westlichen Völkerrechtsgemeinschaft bildete. Ritterlichkeit bedeutete Expertentum für das Kriegshandwerk, auch die Idee vorbildlichen Verhaltens klang an. Einflüsse auf das humanitäre Völkerrecht sind offensichtlich.31 Dem Verbot der Heimtücke etwa, wie wir es heute kennen, statuiert unter anderem in der I. Genfer Konvention von 1949, liegt die ritterliche Idee des fairen Kampfs zugrunde.
Ab dem 18. Jahrhundert wurde die Vorstellung einer westchristlich-römischen Grundlage des Völkerrechts allmählich durch eine neue verdrängt oder überlagert. Die Vorstellung wurde in Europa zusehends stärker, dass das Völkerrecht das Recht einer Zivilisationsgemeinschaft sei. Es sei das Recht einer Gemeinschaft zivilisierter Staaten, wobei man mit «Zivilisation» vor allem die englische und französische Kultur meinte. Stark vereinfachend kann man sagen: Das Völkerrecht wurde der Idee nach vom Recht der Westchristenheit zum Recht einer Zivilisationsgemeinschaft, die mit der Zeit offener wurde für nichtwestchristliche Staaten, denen man Zivilisiertheit zubilligte. Diese Idee spielte bis ins 20. Jahrhundert, im Grunde bis zum Zweiten Weltkrieg, eine zentrale Rolle.32 Im Statut des 1920 geschaffenen Ständigen Internationalen Gerichtshofs heisst es in Artikel 38 Absatz 1 Ziffer 3 nicht zufällig, dass das Gericht die «von den zivilisierten Völkern anerkannten allgemeinen Rechtsprinzipien» als Völkerrecht anwenden wird. Diese Bestimmung ist weitgehend unverändert in das Statut des Internationalen Gerichtshofs, des IGH, übernommen worden. Dem Begriff «zivilisiert» kam in diesem Zusammenhang nie praktische Bedeutung zu. Eine gewisse Symbolik der Formel aber, in der sich ein wichtiger Teil der Geschichte des Völkerrechts spiegelt, blieb.
Teilnehmer: Erweiterung auf nichtchristliche Staaten
Das 19. Jahrhundert brachte Veränderungen im Kreis der Teilnehmer des Völkerrechts. In den 1810er- und 1820er-Jahren wurden zunächst die südamerikanischen Staaten unabhängig und Völkerrechtssubjekte. Gelegentlich ist in diesem Zusammenhang von einer ersten Entkolonisierungswelle die Rede, der in der Zwischenkriegszeit eine bescheidene zweite und dann zwischen 1955 und 1975 die sehr starke dritte folgte. Die Loslösung Brasiliens vom portugiesischen Mutterland 1822 erfolgte friedlich, während die spanischen Kolonien ihre Unabhängigkeit gewaltsam erstreiten mussten. Die Bedeutung Europas wurde durch diese Entwicklung relativiert. Eine Zäsur markierte auch die Erklärung der Vereinigten Staaten 1823, Interventionen europäischer Mächte auf dem amerikanischen Doppelkontinent künftig nicht mehr hinnehmen zu wollen.33 Die als Monroe-Doktrin bekannte Deklaration bildete den Anfang und den Rahmen für eine partiell selbstständige Völkerrechtsentwicklung auf dem amerikanischen Doppelkontinent.
Der entscheidende Schritt der Ausdehnung des Völkerrechts auf nichtchristliche Staaten erfolgte mit der Anerkennung des Osmanischen Reichs. Dieses erhielt im Friedensvertrag von Paris 1856, der den Krimkrieg beendete, den Status einer vollwertigen Vertragspartei. Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts wurden verschiedene asiatische Staaten Mitglieder der im Kern aber weiterhin europäischen Völkerrechtsgemeinschaft: Japan, Siam, China und Persien. Japan stieg zur regionalen Grossmacht auf.34 Es errichtete nach europäischem Vorbild Kolonien und Kolonialprotektorate, etwa in Korea. China, das sich den europäischen Mächten zunächst überlegen gefühlt und die Bedrohung verkannt hatte, musste im Opiumkrieg gegen die Briten eine bittere Niederlage einstecken und ab 1842 in sogenannten ungleichen Verträgen Beschränkungen seiner Souveränität hinnehmen. In Europa entstanden in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg neue Staaten, die sich aus dem Osmanischen Reich herauszulösen vermochten. Die Fürstentümer Rumänien und Serbien wurden 1881 beziehungsweise 1882 und Montenegro 1910 unabhängig. Nomadenvölker und indianische Stämme wurden generell nicht für völkerrechtsfähig erklärt. Ein berüchtigtes Urteil des US Supreme Court von 1831 – Cherokee Nation v. Georgia – spricht von den Indianerstämmen als «domestic dependent nations».35 Die Kolonisierung ihrer Gebiete erfolgte nach dem oben beschriebenen Muster der «Kolonisierung durch Nichtwahrnehmung».
Europäische Kolonisierung der Welt: Phasen
Das 19. Jahrhundert brachte eine neue Hochphase der Kolonisierung. Für ihre völkerrechtliche Einordnung ist es hilfreich, grundsätzlich drei Hauptphasen europäischer Ausgriffe auf die Welt zu unterscheiden. Differenzen bestanden vor allem bei den Rechtsformen, in denen kolonisiert wurde, sowie mit Blick auf die Modalitäten und die beteiligten Mächte. Die erste Phase war die Zeit der Eroberung überseeischer Gebiete vor allem durch Spanien und Portugal im 15. und 16. Jahrhundert. Diese dehnten ihre Staatsgewalt auf überseeische Gebiete aus. Der Staat wurde grösser. Als zweite Phase kann die Zeit zwischen 17. und 18. Jahrhundert gelten. In dieser Periode spielten englische und niederländische Handelskompanien die Schlüsselrolle bei der Kolonisierung. Sie waren teilweise mit staatsähnlichen Befugnissen ausgestattet, konnten etwa Verträge schliessen und vereinzelt gar Krieg führen.36 Sie sollten jedoch nicht oder nicht primär neue Territorien in Übersee besetzen, sondern Handelsmonopole errichten und absichern helfen. Diese «privatisierte» Form der Kolonisierung, die auf Handelsüberschüsse abzielte und deren Grundlage die Handelstheorie des Merkantilismus war, ermöglichte das Verfolgen wirtschaftlicher Ziele, ohne gleichzeitig das gesamte europäische Konzept der Staatlichkeit mit Gewaltmonopol und festen Grenzen in die Kolonien exportieren zu müssen. Der Export staatlicher Strukturen war teuer.
Die letzte Phase ab dem späten 18. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg glich in vielen Hinsichten der ersten mehr als der zweiten. Kolonien wurden nun im Regelfall wieder Teil des Mutterlands und damit von dessen Staatsgebiet. Staatliche Behörden lösten die Administrationen der Handelsgesellschaften immer mehr ab. Natürlich ist dies hier nur ein grobes Modell. Die Wirklichkeit war vielfältiger und widersprüchlicher. Wichtig ist vor allem, dass bei der Form der Kolonisierung Vielfalt und Spielräume für eine Anpassung an die jeweiligen politischen Ziele bestanden. Die intensivierte Kolonisierung ab 1870 wird oft als Periode des Imperialismus bezeichnet. Im Mittelpunkt stand – aus europäischer Sicht – der «Wettlauf um Afrika», in dem vor allem Grossbritannien und Frankreich ihre Kolonialreiche stark erweiterten.37 Im Fall Grossbritanniens kamen im 19. Jahrhundert als neue Besitzungen zudem Kanada, Neuseeland und Australien hinzu. Zwischen 1862 und 1912 verdoppelte sich das Territorium der von Grossbritannien beherrschten kolonialen Besitzungen auf bis zu ein Viertel der gesamten Landmasse der Welt. Auf See war Grossbritannien ohnehin dominierend. Neue französische Besitzungen wurden im 19. Jahrhundert etwa Französisch-Indochina, Madagaskar sowie Französisch-Nordafrika und Westafrika. Weltanschaulich gestützt wurde die europäische Kolonisierung im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert durch biologistische und rassistische Weltanschauungen. Charles Darwins Forschungen über Selektionsprozesse in der Natur – 1859 in «On the Origin of Species» veröffentlicht – veränderten den Blick auf das Soziale. Das Prinzip der «natural selection», vulgarisiert und auf internationale Beziehungen übertragen, lieferte das ideologische Fundament, um Krieg als legitime Form von Wettbewerb und gar Fortschrittstreiber darzustellen. Darwin selbst hatte 1871 in «The Descent of Man» angesichts der Überlegenheit der amerikanischen Kolonisatoren über Indianer geschrieben: «[…] the wonderful progress of the United States, as well as the character of the people, are the results of natural selection […]». Das Völkerrecht war wesentlicher Teil eines kulturell-rechtlichen Amalgams, das die Unterwerfung der Welt unter europäische Herrschaft rechtfertigte.
Weitere Formen kolonialer Beherrschung
Koloniale Beherrschung bedeutete in dieser Periode nicht automatisch Kolonialstatus des beherrschten Gebiets. Das Völkerrecht kannte verschiedene Formen kolonialer Beherrschung, wobei die Wahl vor allem von der Interessenlage aufseiten der Kolonialmacht abhing.38 Eine wichtige Rolle spielte im 19. und frühen 20. Jahrhundert etwa das Kolonialprotektorat. Als Protektorat war in der Vergangenheit ein schwacher Staat bezeichnet worden, der einen Teil seiner Souveränitätsrechte aus Sicherheitsgründen auf einen anderen Staat überträgt, ohne dadurch aber seine Existenz als unabhängiger Staat zu verlieren. Reversibilität gehörte zur Konstruktion, der Protegierte hatte es in Händen, wieder vollständig souveräner Staat zu werden. Der Protektorstaat war typischerweise für die Aussenbeziehungen zuständig, da er dafür die notwendige Infrastruktur besass. Die Ionischen Inseln etwa waren von 1815 bis 1864 ein Protektorat Grossbritanniens gewesen. Im kolonialen Kontext wurde das Institut – der Idee nach fremdnützig – denaturiert. «Protegiert» wurden hier nicht schwache Staaten in deren primärem Interesse, sondern Gebiete, die Kolonialmächte als Kolonien ins Auge gefasst hatten. Ein Kolonialprotektorat war eine Kolonie auf Probe, seine Errichtung eine Vorstufe der Annexion. Madagaskar etwa wurde 1885 französisches Protektorat und 1896 Kolonie, Korea 1905 japanisches Protektorat und 1910 Kolonie. Seit 1999 hat der Begriff des Protektorats im Zusammenhang mit den UNO-Übergangsadministrationen auf Osttimor, der UNTAET (1999–2002), und im Kosovo, der 1999 geschaffenen UNMIK, eine gewisse Reaktivierung erfahren. Die Gebiete wurden teilweise als UNO-Protektorate bezeichnet. Mit der ursprünglichen hat diese Begriffsverwendung gemein, dass der Protektor der Idee nach, anders als beim Kolonialprotektorat, fremdnützig handelt.39 Der Unterschied besteht darin, dass er über seinen Status nicht selbst entscheidet.
Weitere Formen kolonialer Beherrschung verdienen kurze Erwähnung. Als Interessensphären galten Gebiete, die an bereits bestehende Kolonien angrenzten und auf die eine Kolonialmacht Ansprüche anmeldete. Der deutsche Ausdruck «Hinterland» wurde in diesem Zusammenhang als Lehnwort auch im Englischen verwendet. Beispiel ist der englisch-deutsche Vertrag über die Kolonien und Helgoland von 1890. Verträge über sogenannte Einflusssphären betrafen staatsähnliche Territorien mit schwacher Staatlichkeit. Die Vertragsparteien verpflichteten sich untereinander, in der Sphäre der anderen keine politischen oder wirtschaftlichen Konzessionen zu erwerben und die anderen Parteien beim Erwerb solcher Rechte in der eigenen Einflusssphäre nicht zu behindern. Einflusssphären wurden etwa mit Blick auf China und Persien vereinbart. So schlossen 1907 Russland und Grossbritannien einen Vertrag, der ihre Einflusssphären in Persien abgrenzte. Die wohl am weitesten reichende Form imperialer Durchdringung überseeischer Gebiete aber waren Abmachungen über Open-door-Regime. Kern solcher Regime waren Vereinbarungen, dass die Bürger aller Länder in diesen Gebieten gleiche ökonomische Möglichkeiten haben sollten. Sie wurden gegen den Willen der betroffenen Gebiete oder Staaten abgeschlossen, ihnen in der Regel aufgezwungen, etwa China 1842. Das Aufkommen von Open-door-Regimen hing mit dem Aufstieg der Freihandelstheorie zusammen, die im Wesentlichen besagte, dass freier Handel letztlich allen Beteiligten zugutekommt.