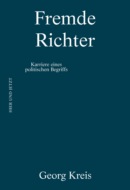Kitabı oku: «Völkerrecht», sayfa 4
Wachstum und internationale Organisationen
Freihandel und erste Kodifikationen
Im Lauf des 19. Jahrhunderts wurde das Bedürfnis nach gemeinsamen völkerrechtlichen Lösungen immer stärker. Der Gesamtbestand an Völkerrecht wuchs zum einen an, weil der technische Fortschritt gemeinsame Lösungen bei Kommunikations- und Verkehrsinfrastruktur forderte.40 Man musste etwa das Problem lösen, dass an der Auslieferung eines Briefs im Ausland zwei Leistungserbringer beteiligt sind, die für ihre Leistung entschädigt werden wollen.
Man vereinbarte eine Regelung von bestechender Schlichtheit: Die Staaten behalten das volle Entgelt für die auf ihrem Territorium aufgegebenen Briefe und liefern dafür die im anderen Staat aufgegebenen unentgeltlich ab. Es entstanden erste internationale Organisationen, die sich mit Kommunikations- und Verkehrsfragen befassten. 1865 wurde der Allgemeine Telegrafenverein und 1874 der Weltpostverein gegründet.41 Bereits im frühen 19. Jahrhundert waren allerdings als Vorformen internationaler Organisationen einige zwischenstaatliche Kommissionen entstanden, die die Navigation grosser Flüsse administrierten, etwa 1815 die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt. Die ab den 1860er-Jahren entstehenden Organisationen waren relativ «unpolitisch», weil sie sich im Unterschied zu späteren wie dem Völkerbund nur mit technischen Fragen befassten.
Der Bedarf an gemeinsamen Regeln stieg auch an, weil die sich industrialisierenden Wettbewerbswirtschaften Erweiterungen der Wirtschaftsräume verlangten. Der britische Wirtschaftswissenschafter David Ricardo – kaum zufällig ein Autor aus einem früh industrialisierten Staat – hatte 1817 in einer epochalen Schrift mit dem Titel «Principles of Political Economy and Taxation» die These aufgestellt, der Abbau von Handelsschranken sei für alle beteiligten Länder vorteilhaft, weil jede Ökonomie sich so auf das konzentriere, was sie relativ am besten könne, das heisst im Vergleich zu den anderen. Dies gelte auch, wenn man nicht zu den von vornherein Starken gehöre, weil Konzentration auf das, was man relativ am besten kann, immer noch vergleichsweise effizient und daher profitabel sei, so Ricardos «Theorie der komparativen Vorteile».
Das heutige WTO-Recht beruht auf dieser Grundidee. Auch das Völkerrecht des 19. Jahrhunderts erhielt ab der Jahrhundertmitte durch die Freihandelslehre einen Schub. Sie forderte den Abbau von Zöllen und eine stärkere Integration der Wirtschaftsräume. 1860 wurde zwischen Frankreich und Grossbritannien ein damals als bedeutend empfundener Vertrag geschlossen, der beide Staaten auf das «Prinzip der Meistbegünstigung» verpflichtete.42 Jede Zollsenkung für ein bestimmtes Gut, das irgendeinem Staat gewährt wurde, musste nun auch dem Vertragspartner zugestanden werden – mit dem Ziel, das Zollniveau generell zu senken. Die Schweiz hatte bereits 1850 einen solchen Vertrag mit den USA und 1855 einen mit Grossbritannien vereinbart.
Es kam zu ersten Kodifikationen völkerrechtlicher Teilgebiete. Den Anfang machte das humanitäre Völkerrecht mit der Schaffung der ersten Genfer Konvention «betreffend die Linderung des Loses der im Felddienst verwundeten Militärpersonen» von 1864. Sie regelte den Schutz der Verwundeten und die Neutralität des Sanitätspersonals und war im Wesentlichen eine Folge davon, dass in den Kriegen der 1850er-Jahre viele Verwundete «unnötig» starben, weil es am erforderlichen Schutz und an der Wundversorgung fehlte. Die Haager Friedenskonferenzen von 1899 und 1907, vom russischen Zaren Nikolaus II. initiiert, brachten überdies vertragliche Fixierungen verschiedener Aspekte der Kriegführung.43 Hier stand nicht der Schutz des Einzelnen, sondern die Einhegung des Kriegs an sich, beispielsweise durch bestimmte Verbote von Waffen und Kriegführungsmethoden, im Vordergrund. Man einigte sich etwa auf ein Verbot des Einsatzes von Gift. Im Gebiet des humanitären Völkerrechts begann früh, was später in vielen anderen Gebieten des Völkerrechts zu beobachten sein würde: eine starke Verschiebung vom Gewohnheits- zum Vertragsrecht, das nun zur dominierenden Rechtsquelle wurde. Das Völkerrecht wurde durch diese Verschiebung insofern gestärkt, als es einfacher ist, Gewohnheitsrecht entweder zu bestreiten oder als blosse Völkermoral abzutun. Obschon sich die internationale Situation im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und vor allem gegen dessen Ende zusehends zuspitzte, gab es in dieser Zeit bei vielen einen grossen Glauben an den Fortschritt durch Völkerrecht. In den Begriffen «Völkerrecht» und «ius gentium» klang die Idee einer Art «Weltvernunft» an. Eine moderne Völkerrechtswissenschaft entstand, die dieses Projekt voranzutreiben versuchte. Der Finne Martti Koskenniemi (geb. 1953) hat den Aufstieg dieser neuen Wissenschaft mit ihrer Mission in seinem 2001 erschienenen Buch «The Gentle Civilizer of Nations» beschrieben.
Aufkommen der Schiedsgerichtsbarkeit
Das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts war auch die Zeit des Aufstiegs der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit.44 Eine eigentliche internationale Justiz mit festen Gerichten gab es damals noch nicht, die Unterwerfung unter «fremde» Institutionen erschien im Licht eines radikalisierten Souveränitätsverständnisses generell als Problem. Dennoch kam es zwischen 1872 und dem Ersten Weltkrieg zu mehreren Hundert Schiedsurteilen, bei denen die Abgrenzung zwischen politischer Vermittlung und Schiedsgerichtsbarkeit im juristisch-technischen Sinne noch nicht immer klar war. Teilweise amteten Staatspräsidenten oder ganze Regierungen als Schiedsrichter. Der Anteil der Juristen in den Schiedsgerichten stieg erst mit der Zeit allmählich an. Auffallend viele Schiedsfälle betrafen Grenzstreitigkeiten. So wurde etwa die Grenze Brasiliens vollständig von Schiedsgerichten festgelegt, was ihren zuweilen geometrischen Verlauf miterklärt. Auch politisch brisante Streitigkeiten wurden teilweise von Schiedsgerichten entschieden, was als grösster Fortschritt galt.
Hervorhebung verdient der Alabama-Schiedsfall von 1872. Er markiert im Wesentlichen den Beginn der modernen Schiedsgerichtsbarkeit. Es standen sich mit den Vereinigten Staaten und Grossbritannien zwei der damals mächtigsten Staaten gegenüber.45 Es ging um Neutralitätsfragen. Grossbritannien hatte sich im amerikanischen Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 zunächst neutral erklärt und es dann aber doch zugelassen, dass auf seinem Territorium unter anderem ein Kreuzer der konföderierten Südstaaten gebaut wurde, die CSS Alabama. Das Schiff kam im Bürgerkrieg zum Einsatz und fügte den Unionstruppen starke Verluste zu. Das in Genf tagende Schiedsgericht kam zum Schluss, Grossbritannien habe seine Sorgfaltspflichten als Neutraler verletzt. Es verlieh mit seinem Entscheid dem nur dem Grundsatz nach feststehenden Neutralitätsrecht klarere Konturen. In der Sache hatte dies Elemente von Rechtsetzung durch Spruchtätigkeit. Der relative Erfolg der Schiedsgerichtsbarkeit in der Folge beflügelte den Glauben an die rechtsförmige Streitbeilegung. An den Haager Friedenskonferenzen war ihre Stärkung deshalb ein zentrales Thema. 1900 wurde auf Grundlage des 1899 angenommenen ersten Haager Abkommens zur friedlichen Beilegung internationaler Streitfälle der «Ständige Schiedshof» mit Sitz in Den Haag eingerichtet. Der Name verspricht mehr, als er hält, dennoch war der Schritt von einiger symbolischer Bedeutung. Er bestand und besteht bis heute im Wesentlichen aus einer Verwaltungsstelle, die bei der Einsetzung von Schiedsgerichten Hilfestellung leistet. Er hat in den letzten Jahren nach langem Schattendasein gar wieder an Bedeutung gewonnen.
Weg in den Ersten Weltkrieg
Die Frage, weshalb die internationale Ordnung mit dem Ersten Weltkrieg zusammenbrach, ist ein eigener Wissenschaftszweig. Man muss mit pauschalen Aussagen vorsichtig sein, zumal der Erste Weltkrieg sich bei näherer Betrachtung als Krieg mit drei Teilkriegen im Westen und Osten sowie auf dem Balkan darstellt. Trotz aller Zusammenhänge hatten diese zum grossen Teil eigene Hintergründe und Anlässe. Was man sicher sagen kann, ist, dass beim Zusammenbruch der Wiener Ordnung 1914 politische, militärische und kulturelle Faktoren auf komplexe Weise zusammenspielten. Seit der Jahrhundertwende gab es keine nichtkolonisierten Gebiete mehr. Koloniale Ambitionen – etwa jene des spät in den «Wettlauf» um die Kolonien eingetretenen Deutschen Reiches – mussten unweigerlich zu Spannungen mit anderen europäischen Grossmächten führen. In der Logik des Gleichgewichtsdenkens war das Zusammenrücken der späteren Alliierten gegen Deutschland das Naheliegende: gemeinsamer Selbstschutz gegen einen Staat, der mit der Deutschen Einigung 1871 die Gewichte zu seinen Gunsten verschoben und spät aggressiv koloniale Ambitionen entwickelt hatte. In deutschen Augen war das Zusammenrücken eine Bedrohung, ein Umzingeln, das in der deutschen Öffentlichkeit eine Art Paranoia erzeugte.
Das Völkerrecht war Teil des Ursachenbündels, das zum Ersten Weltkrieg führte.46 Völkerrechtler tun sich schwer damit, dies zu schreiben. Die Existenz eines «ius ad bellum» schien zu implizieren, dass Kriegführung etwas Normales oder gar Natürliches darstellt. Durch eine darwinistische Brille betrachtet – Darwins Denken wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts bekanntlich in vulgarisierter Form Gemeingut – war es Ausdruck einer Art Naturgesetzlichkeit. Damit trug das Völkerrecht mit zur Gewalt bei, es wurde in gewisser Weise selbst ein Opfer seiner eigenen Ambitionslosigkeit im Bereich zwischenstaatlicher Gewaltanwendung. Das «ius ad bellum» war im 17. Jahrhundert in einem sehr spezifischen Kontext entstanden, von dem es sich vollständig abgelöst hatte. Hinzu kam, dass das Völkerrecht keinerlei persönliche Verantwortlichkeit politischer oder militärischer Entscheidungsträger kannte. Es war ein Recht zwischen Staaten. Die Entscheidungsträger mussten somit nicht damit rechnen, für Kriege persönlich zur Rechenschaft gezogen zu werden. Dieses «alte» Verständnis des Völkerrechts sollte mit dem Ersten Weltkrieg teilweise und mit dem Zweiten endgültig an sein Ende kommen.47 Man darf allerdings nicht vergessen, dass der Erste Weltkrieg in seinen Dimensionen ein Ereignis jenseits jeden Erwartungshorizonts war. Deutschland hatte ihn in der festen Überzeugung begonnen, es handle sich um einen kurzen Feldzug. Am Ende wurde er zu einem vierjährigen Krieg mit 17 Millionen Toten, der das Bild militärischer Gewalt für immer und auch das Völkerrecht fundamental veränderte. Man musste die Prämissen internationaler Politik neu denken.
Seitenblick: Schweiz im 19. Jahrhundert
Aus schweizerischer Sicht verdient mit Blick auf die Zeit nach der Französischen Revolution zunächst Erwähnung, dass die Eidgenossenschaft in den Koalitionskriegen gegen Napoleon überwiegend mit den gegenrevolutionären Kräften sympathisierte. Sie stellte ihre Neutralität teilweise auch grundsätzlich infrage, Unparteilichkeit war damals kein unumstössliches Dogma. Man sah das ständische System durch die Revolution gefährdet, und es war eine Weile lang fraglich, ob man überhaupt an der Neutralität festhalten würde. Weder Napoleon noch die Alliierten respektierten sie durchgehend, was die Frage aufwarf, ob ein Bündnis nicht besser wäre. Die Eidgenossenschaft wurde teilweise selbst zum Kriegsschauplatz. Sie war eine Weile ein besetztes Land, dessen Zukunft offen und dessen Fortexistenz gefährdet war.
Am Wiener Kongress waren sich die Grossmächte Österreich und Frankreich einig, dass ein Pufferstaat zwischen ihnen Sinn ergeben würde. Der Eidgenossenschaft wurde in der Pariser Friedenscharta von 1815 dauerhafte, «immerwährende» Neutralität zugestanden.48 Völkerrechtlich war sie im Kern nun wieder ein Zusammenschluss souveräner Republiken, die einen Teil der Aussenpolitik vergemeinschaftet hatten. Diese Sichtweise ist allerdings nicht unbestritten, da es Grossmächte auch am Wiener Kongress abgelehnt hatten, mit den einzelnen Kantonen zu verhandeln. Am Wiener Kongress wollte man das «Corpus Helveticum» als Verhandlungspartner. Als erwiesen darf gelten, dass die Grossmächte grossen Anteil daran hatten, dass die stark zerstrittene Eidgenossenschaft 1815 zusammengeschweisst wurde. Es war damals wesentlich der Wille der Grossmächte, der sie, die «Willensnation», zusammenhielt.
Mit der Bundesstaatsgründung 1848 wurde die moderne Schweiz zu einem progressiven Fremdkörper in einem überwiegend monarchisch-konservativen Europa. Es waren vereinzelt auch durchaus Interventionen von Mächtigen zu befürchten, unter anderem, weil die Schweiz grosszügig politische Flüchtlinge aufnahm. Sie war vor allem ein beliebtes Zielland liberaler Deutscher wie Richard Wagner, Gottfried Semper, Carl Schurz und Theodor Mommsen. Die Monarchen standen der relativ eigenständig agierenden modernen souveränen Schweiz oft skeptisch gegenüber.
Ab den 1860er-Jahren übernahm die Schweiz eine aktive Rolle beim Aufbau «technischer» internationaler Organisationen. Bern wurde 1865 Sitz des Allgemeinen Telegraphenvereins und 1874 des Weltpostvereins sowie einiger weiterer internationaler Organisationen, die später nach Genf umzogen. In Bern fanden viele internationale Konferenzen statt, oft im alten Nationalratssaal als renommiertem Konferenzort. Erwähnt sei etwa, dass 1913 in Bern eine Weltnaturschutzkonferenz stattfand, eine Pionierleistung des Schweizer Naturforschers Paul Sarasin und des Bundesrates.49 Die Rechtsfakultät der Universität Bern schenkte dem Völkerrecht im späten 19. Jahrhundert früh besondere Aufmerksamkeit.50
Die Schweiz entwickelte sich generell zum beliebten Sitz internationaler Institutionen.51 Für den Aufstieg von Genf zum internationalen Forum spielte der Alabama-Fall von 1872 eine wichtige Rolle, da das Schiedsgericht in diesem als spektakulär geltenden Fall in Genf getagt hatte. Alt Bundesrat Jakob Stämpfli war Mitglied des Spruchkörpers gewesen, und der in Heidelberg lehrende Schweizer Johann Caspar Bluntschli (1808–1881), dessen 1868 erschienenes Hauptwerk «Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staaten als Rechtsbuch dargestellt» das führende Lehrbuch seiner Zeit war, hatte zum Urteil durch eine Stellungnahme beigetragen, von der sich die Schiedsrichter stark leiten liessen. Der Gesamtbundesrat amtete vor dem Ersten Weltkrieg mehrfach als Schiedsrichter. Er entschied etwa 1897 einen Grenzstreit zwischen Brasilien und Französisch-Guayana. Der Erste Weltkrieg wurde für den Zusammenhalt der Schweiz zur Belastungsprobe. Während die Deutschschweiz zu Deutschland neigte, stand die französische Schweiz Frankreich näher. Es gelang jedoch, die Idee der Unparteilichkeit zur national verbindenden Klammer zu machen und nicht unmittelbar in den Weltkrieg involviert zu werden. Eine wichtige Rolle spielte nicht zuletzt eine Rede des Dichters Carl Spitteler (1845–1924), «Unser Schweizer Standpunkt», die einen mässigenden Einfluss ausübte. Die Schweiz musste jedoch Souveränitätsbeschränkungen durch die Kriegsparteien hinnehmen, die den schweizerischen Aussenhandel mit dem Kriegsgegner mittels Kontrollorganen überwachten.
Völkerbundära und Zweiter Weltkrieg

Konfliktverhinderung wird schrittweise zur Gemeinschaftsaufgabe: Versammlung des Völkerbunds 1926.
Kollektivierung der Friedensfrage
Das Völkerrecht brach im Ersten Weltkrieg nicht sofort in sich zusammen. Zumindest in den frühen Jahren wurde das Kriegsführungsrecht noch einigermassen beachtet, etwa die Regeln betreffend Kriegsgefangene.52 Das Hauptproblem war eher, was das Völkerrecht nicht verbot. Es stand nicht nur dem Angriffskrieg, sondern auch dem maschinellen Töten mittels Artilleriegranaten und Maschinengewehren indifferent gegenüber. Der Einsatz dieser beiden neuen Mittel der Kriegführung war völkerrechtlich zulässig – und ist es bis heute. Etwa die Hälfte der getöteten Soldaten kam alleine durch Artilleriegranaten ums Leben. Die verbreitete Rede vom Zusammenbruch des Völkerrechts im Ersten Weltkrieg meint im Kern daher mehr die Ohnmacht gegenüber der neuen Realität maschinell-industriellen Tötens von Feinden, die die Soldaten nur im Ausnahmefall zu Gesicht bekamen. Der Erste Weltkrieg gilt als erster «totaler Krieg», der auch die Zivilbevölkerung viel stärker in die Kriegshandlungen miteinbezog als die Kriege des 19. Jahrhunderts. In besetzten Gebieten wurden teilweise systematisch Zwangsarbeiter rekrutiert und auch deportiert.53 Städtebombardierungen, die mit der Entwicklung von Luftschiffen und Flugzeugen möglich geworden waren, unterschieden nicht zwischen Kombattanten und Zivilbevölkerung. Diese Entwicklung bedeutete eine Abkehr von einem Verständnis des Kriegs, wonach dieser als Konflikt zwischen Armeen als Staatsorganen, aber nicht zwischen ganzen Völkern ausgetragen wird.
Folge der Gewaltexzesse war ein nahezu universeller Konsens, dass Kriege nicht länger als blosse Angelegenheit der beteiligten Staaten gelten durften. Das internationale System musste verändert werden, wobei insbesondere der amerikanische Präsident Woodrow Wilson dezidiert für die Schaffung einer dauerhaften, universellen und rechtlich verfassten Staatenkonferenz eintrat. Man errichtete den Völkerbund als erste Organisation für kollektive Sicherheit, deren Satzung dem umstrittenen Versailler Friedensvertrag angehängt war.54
Eine Organisation für kollektive Sicherheit ist mehr als ein Zusammenschluss gegen einen gemeinsamen Feind.55 Die Grundidee ist, dass ein Angriff gegen ein Mitglied zugleich als Angriff gegen alle Mitglieder betrachtet wird und dass Friedenswahrung und -sicherung als Gemeinschaftsangelegenheiten gelten. Wörtlich heisst es in Artikel 11 der Völkerbundsatzung: «Any war or threat of war, whether immediately affecting any of the Members of the League or not, is hereby declared a matter of concern to the whole League, and the League shall take any action that may be deemed wise and effectual to safeguard the peace of nations» [Hervorh. OD]. Sicherheit wurde der Idee nach zu einer Gemeinschaftsaufgabe. Die Praxis sah meist anders aus, auf der prinzipiellen Ebene aber war dies dennoch ein grosser Schritt. Die Vereinigten Staaten, die in den Weltkrieg bis 1917 nicht involviert gewesen und neutral geblieben waren, gingen gestärkt aus dem Krieg hervor, traten dem Völkerbund aber nicht bei. Sie rückten zur zweiten Führungsmacht neben Grossbritannien auf, das seine Stellung als unangefochtene Führungsmacht verlor.
Universalisierung und Entkolonisierung
Die neue Ordnung musste, wenn sie global akzeptanzfähig sein sollte, kulturneutral sein. Der Weltkrieg hatte die Idee des Völkerrechts als eine im Kern europäische Zivilisationsordnung, in die Staaten aus anderen Kulturkreisen «aufgenommen» werden, für immer diskreditiert. Artikel 1 Absatz 2 der Völkerbundsatzung sah deshalb vor, dass neben Staaten auch Dominions und Kolonien mit voller Selbstverwaltung Mitglied werden könnten.56 Voraussetzung war, dass sie imstande waren, die Mitgliederpflichten zu erfüllen. So wurden etwa auch Indien und Kanada – beide noch nicht selbstständige Staaten – Gründungsmitglieder des Völkerbunds. Spezifische Kriterien für die Aufnahme wurden nicht formuliert, man liess sich Spielräume offen, und die europäischen Staaten gaben den Anspruch auch noch nicht auf, die Staatengemeinschaft oder «Familie der Nationen» selbst zu definieren.57 Im Grundsatz wollte man nun aber darauf abstellen, ob ein Staat oder ein Selbstverwaltungsgebiet stabil war und effektiv Herrschaft ausübte. Die Schaffung des Völkerbunds markierte den Übergang vom «Club»-Denken des europäischen Völkerrechts zur Idee der Völkerrechtsgemeinschaft als einer Gemeinschaft effektiver Staaten und einiger Fast-Staaten. Kolonien und Kolonialprotektorate des Kriegsverlierers Deutschland wurden nicht annektiert, wie nach früheren Kriegen üblich. Die Kolonien wurden in Treuhandgebiete der siegreichen Kolonialmächte umgewandelt, man sprach von Völkerbund-Mandatsgebieten.58 Die Ausübung der Verwaltungsmandate stand unter der Aufsicht des Völkerbunds. Die Briten übernahmen beispielsweise das Mandat betreffend Tanganjika, die Franzosen eines den grössten Teil Kameruns betreffend. Die Treuhandgebiete sollten auf den für die Unabhängigkeit erforderlichen zivilisatorischen Stand gebracht werden, so die Grundidee, wobei verschiedene Zivilisiertheitsgrade der verwalteten Gebiete unterschieden wurden, eingestuft als A-, B- oder C-Mandate. Die alte Vorstellung der Völkerrechtsgemeinschaft als Zivilisationsgemeinschaft wirkte hier noch fort.
Die Kolonialmächte Grossbritannien und Frankreich hofften zwar, ihre Kolonien noch lange behalten zu können, doch die über Jahrhunderte aufgebauten Kolonialreiche der Europäer waren in die Phase ihrer schrittweisen Auflösung getreten.59 1932 wurde der Irak, zuvor britisches Mandatsgebiet, unabhängig. Er war das erste arabische Mitglied des Völkerbunds. 1944 endete das französische Mandat über Syrien und den Libanon. Der Zweite Weltkrieg beschleunigte die Auflösung der Kolonialreiche, da er regional zu zeitweilig grösserer Autonomie der Kolonien geführt hatte, die ihre Emanzipationsforderungen nun deutlich formulierten. Japan etwa hatte von 1942 bis 1945 Burma, Malaysia, Indochina und Indonesien besetzt und dort einheimische Regierungen eingesetzt, die die Rückkehr der europäischen Kolonialmächte nach dem Krieg nicht ohne Weiteres hinzunehmen bereit waren.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.