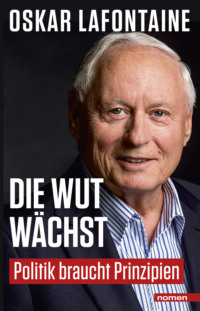Kitabı oku: «Die Wut wächst», sayfa 2
Viele in Deutschland scheuen vor einer schonungslosen Analyse der Vormachtstellung Amerikas und ihrer Folgen für die Welt zurück. Wer sucht nicht gerne Schutz bei dem Stärkeren? Aber es gibt noch eine andere Veranlagung in uns Menschen, die Gott sei Dank noch nicht abgestorben ist. Wir wollen den Schwächeren helfen.Und in der Welt gibt es mehr Schwache als Starke.Die Amerikanische Verfassung von 1776 gilt für die ganze Menschheit:»Wir halten es für selbstverständliche Wahrheiten, dass alle Menschen gleich geschaffen wurden, dass sie alle von ihrem Schöpfer mit gewissen unabdingbaren Rechten ausgestattet wurden und dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören.«
Die militärisch gestützte Außenpolitik der einzig verbliebenen Supermacht dient dazu, die Profitinteressen der Finanzindustrie durchzusetzen, die Marktmacht der internationalen Konzerne auszuweiten und den reichen Nationen die Rohstoffe der armen Länder zu sichern. Schon 1991 hatte der Hardliner des Pentagons, Paul Wolfowitz, gefordert, die USA sollten jeden Industriestaat daran hindern, die Vormachtstellung Amerikas herauszufordern oder auch nur eine größere regionale oder globale Rolle zu spielen. Das ist das ungeschminkte Verlangen nach der Weltherrschaft. Jeder Versuch, die Hegemonie der USA irgendwo auf dem Erdball infrage zu stellen, soll unterdrückt werden.
Wie soll sich Deutschland in dieser Situation verhalten und welche Außenpolitik soll es angehen? Von der rot-grünen Koalition durfte man eine Fortsetzung der Friedens- und Entspannungspolitik Willy Brandts erwarten. Brandt setzte auf die nichtmilitärische Lösung von Konflikten und warb für internationale Abrüstung und Beschränkung der Waffenexporte. Der Friedensnobelpreisträger trat dafür ein, die Entwicklungshilfe für die armen Länder deutlich zu erhöhen. In den Programmdiskussionen der Sozialdemokratischen Partei befürwortete er die Stärkung der UNO und die Beachtung des internationalen Rechts. Seine Politik gründete auf den Ideen des Gewaltverzichts und der gemeinsamen Sicherheit.
Der außenpolitische Sündenfall der Regierung Schröder war der Kosovokrieg, bei dem auch die Nato auf das Recht des Stärkeren setzte. Es war ein großer historischer Fehler, die USA darin zu bestärken, das internationale Recht zu missachten.Und es war ein ebenso großes Versäumnis, die militärische Vorgehensweise der Supermacht nicht zu thematisieren. Meine in der letzten Kabinettssitzung, an der ich im März 1999 teilgenommen habe, wiederholt gestellte Frage »Kann mir jemand sagen, was in Jugoslawien militärisch unternommen werden soll?« wurde weder von Außenminister Fischer noch von Militärminister Scharping beantwortet. Wenn die US-Strategie – möglichst »keine eigenen Toten« – zum Sterben unschuldiger Zivilisten führt, dann darf sich Deutschland an dieser Art der Kriegführung nicht beteiligen. Der jugoslawische Staatspräsident Vojislav Kostunica klagte, die »humanen Bomben« der Nato hätten 1500 Zivilisten getötet, darunter 81 Kinder. Richtig wäre die Einrichtung von Schutzzonen gewesen, um das Leben der Zivilbevölkerung zu verteidigen. Obwohl viele gerade von der Regierung Schröder etwas anderes erhofften, stiegen die deutschen Waffenexporte. In Afghanistan versprach die Bundesregierung uneingeschränkte Solidarität auch dann noch, als die Fehler der Amerikaner und der UNO nicht mehr zu übersehen waren.Wenn die USA auf Terroranschläge mit Flächenbombardements und Streubomben antworten können, dann dürfen das die Inder auch in Pakistan, die Russen in Tschetschenien, die Israelis in Palästina und die Mazedonier gegen die UCK. So setzt man die Welt in Brand. Zweifellos steht es jedem Staat zu, sich gegen Terrorismus zu verteidigen.Dabei muss er sich aber bei der Wahl der Ziele und der Mittel an moralische und rechtliche Regeln halten. Die Schuldigen müssen einwandfrei festgestellt werden. Strafrechtliche Verantwortung ist immer eine personelle Angelegenheit. Sie kann nicht auf Nationen, Ethnien und Religionen, denen die Terroristen zufällig angehören, übertragen werden. Bei der Kriegführung und der Gefangenenbehandlung müssen alle Staaten, auch die USA, die Genfer Konventionen und das internationale Völkerrecht beachten.
Wie gerufen kam mir die Erklärung von Bürgerrechtlern der ehemaligen DDR zur Politik der rot-grünen Regierung, die ich auszugsweise zitiere: »Wir fühlen uns in wachsendem Maße ohnmächtig gegenüber wirtschaftlichen, militärischen und politischen Strukturen, die für Machtgewinn und Profit unsere Interessen in lebenswichtigen Fragen einfach ignorieren. Wir sind verblüfft und entsetzt, dass unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit mit höhnischem Gelächter und dem süffisanten Verweis auf den Rechtsstaat beantwortet wird. Wir sind entsetzt, wie selbstverständlich von hochrangigen Politikern gebilligt wird, dass die vermeintlichen Anstifter des Terroranschlags mit einer grotesk übermächtigen Militärmaschinerie umgelegt werden. Wir sind entsetzt, mit welcher Dumpfbackigkeit Gegnern des Kriegseinsatzes in Afghanistan entgegengehalten wird, dass Krieg gegen Terroristen helfen kann. Weshalb traut sich niemand an die Waffenhändler in den USA und in der Bundesrepublik heran? Wir haben einen Bundeskanzler satt, der um der Macht willen Abgeordnete dazu bringt, Ja zum Krieg zu sagen, wenn sie Nein meinen, und Nein zu sagen, wenn sie Ja meinen. Wir machen nicht mit, wenn Kriegseinsätze mit Worthülsen wie ›Verantwortung übernehmen‹, ›der neuen Rolle Deutschlands in der Welt‹, mit ›Politikfähigkeit‹ und ›der Durchsetzung der Rechte der Frauen‹ verharmlost werden. Wir verweigern uns diesem Krieg.«
Es war kaum zu verstehen, dass ausgerechnet die rot-grüne Koalition gegenüber den Amerikanern eine Servilität an den Tag legte, die mit dem Wort Renegatentum noch zurückhaltend beschrieben ist. Sowohl beim Kosovo- als auch beim Afghanistankrieg machten Schröder und Fischer einfach mit. Das internationale Recht wurde missachtet und Fragen zur Kriegsführung Washingtons – Streubomben, Flächenbombardements, Uranmunition – wurden nicht gestellt.Sich mit der mächtigsten Macht der Welt zu verbünden, ist im deutschen Interesse.Aber die moralische Versuchung besteht darin, zum bequemen Mitläufer zu werden und auch dann zu schweigen, wenn ein offenes Wort unter Partnern geboten ist. Als George W. Bush von der »Achse des Bösen« sprach – gemeint waren der Irak, der Iran und Nordkorea – und dem irakischen Diktator Saddam Hussein immer unverhohlener mit Krieg drohte, wurden in Europa kritische Stimmen laut. Konservative Politiker warnten vor dem rücksichtslosen amerikanischen Unilateralismus. Da wollte auch Außenminister Joschka Fischer nicht mehr zurückstehen und kritisierte zur Abwechslung mal wieder Amerika. Die Opposition warf ihm billigen Populismus vor, weil der Wiedereinzug der Grünen in den Bundestag nach aktuellen Umfragen gefährdet war. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Bundesregierung immer erklärt, sie halte sich mit öffentlicher Kritik zurück, um Einfluss bei den amerikanischen Entscheidungen zu nehmen. Es war aber im Lauf der Zeit offenkundig geworden, dass die Mitsprache der Bundesregierung wie die der anderen Nato-Partner bei den Entscheidungen der Bush-Regierung gleich Null war. Die Kritik des Bundesaußenministers wirkte auch deshalb unglaubwürdig, weil in Kuwait deutsche ABC-Einheiten zusammen mit US-Soldaten eine Übung abhielten.Schröder erklärte dann, die Einheiten blieben bei einem Krieg der USA gegen den Irak auch dann in Kuwait, wenn der Angriff ohne einen Beschluss der UNO erfolge. Wie schon im Kosovo wollte der Kanzler auch dann mitmachen, unabhängig davon, ob das internationale Recht beachtet wird. Die Amerikaner ließen sich deshalb auch von Fischers doppelzüngiger Kritik nicht beeindrucken. Außenminister Colin Powell nannte sie lapidar »heiße Luft«.
Da Militärinterventionen in aller Welt zum selbstverständlichen Instrument der Politik geworden sind, nenne ich Verteidigungsminister »Militärminister«. Als ich vor Jahren einmal die bulgarische Hauptstadt Sofia besuchte, spazierte ich mit einem einheimischen Germanistikprofessor am Verteidigungsministerium vorbei. Er blieb stehen und sagte mir: »Hier beginnt die Lüge. In meiner Jugend stand über dem Portal des Gebäudes ›Kriegsministerium‹. Das war ehrlicher.«
In seiner Abschiedsrede von 1961 warnte der amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower vor dem »militärisch-industriellen Komplex« seines Landes. Er bedrohe den Staat und richte sich gegen das Volk. An den Universitäten werde nicht mehr geforscht, sondern für die Rüstung gearbeitet. Eisenhower ahnte noch nicht, in welchem Umfang Ronald Reagan zwei Jahrzehnte später den Militäretat steigern würde. Und er konnte sich damals sicher nicht vorstellen, dass er im Zuge des Antiterrorfeldzuges des Präsidenten George W. Bush bis zum Jahr 2007 auf 451 Milliarden Dollar steigen soll. Das von Ozeanen und friedlichen Nachbarn umgebene Amerika mit 4,5 Prozent der Weltbevölkerung benötigt zu seiner »Verteidigung« mehr als 40 Prozent der Militärausgaben der gesamten Welt.
Die Aufgaben der Weltinnenpolitik
Nicht der 11. September, sondern die Auflösung der Sowjetunion und des Warschauer Paktes haben die Welt ganz entscheidend verändert. Zwar sprach der amerikanische Präsident George Bush sen. schon 1990 von einer neuen Weltordnung, aber die Menschheit brauchte Zeit, um den grundlegenden Wandel zu verstehen. Die Terroranschläge vom 11. September 2001 auf das World Trade Center und das Pentagon haben deutlich gemacht, dass tatsächlich eine neue Weltordnung entstanden ist. Der Duopol zweier Weltmächte und zweier Militärblöcke, die sich feindlich gegenüberstanden, ist aufgelöst. Die Vereinigten Staaten und die Nato sind übrig geblieben. Und was aus der Nato wird, muss sich noch zeigen. An den Strukturen des Atlantischen Bündnisses vorbei führt die USA den Krieg in Afghanistan. Zwar stellte die Verteidigungsgemeinschaft der westlichen Demokratien zum ersten Mal in ihrer Geschichte nach Artikel 5 des Nordatlantikvertrags den Bündnisfall fest, aber anschließend spielte die Nato keine Rolle mehr. »Die Missionen suchen sich ihre Bündnisse, nicht die Bündnisse ihre Missionen«, gab der amerikanische Militärminister Donald Rumsfeld zu verstehen. Als die Antiterrorkoalition gebildet wurde, trat die Hegemonie der Vereinigten Staaten voll zutage. Einstimmig unterstützten Sicherheitsrat und Vollversammlung der UNO eine Entschließung, die die USA ermächtigte, gegen Terroristen und gegen Staaten vorzugehen, die diese unterstützen oder beherbergen. Der Afghanistankrieg begann.
Die Amerikaner diskutierten über die neue Rolle Amerikas. Die New York Times berichtete, es sei ein Kampf darüber entbrannt, welche Form das amerikanische Empire annehmen soll. Hardliner wie Rumsfeld und sein Stellvertreter Wolfowitz seien der Meinung, Amerika müsse führen und zwar »ohne Rücksicht auf bestehende Verträge oder Einwände von Alliierten«. Die USA sollten »im muskulösen Ton des Interventionismus zur Welt sprechen«. Gemäßigtere wie Außenminister Colin Powell argumentierten, Amerika müsse das Beispiel einer großmütigen Macht abgeben und eine Außenpolitik betreiben, die ohne Ultimaten auskomme und sich pragmatischer Mittel bediene. Offensichtlich setzten Rumsfeld und Wolfowitz sich durch.
Will man die Reaktionen der Welt auf die USA verstehen, dann darf man eines nicht vergessen: Das Land von Coca-Cola, McDonalds, Levis-Jeans, Hollywood und NBC hat die kulturelle Hegemonie auf dem Erdball. Der Dollar ist die Leitwährung der Welt. Amerika ist der Hauptakteur auf den internationalen Finanzmärkten. Die Ölrechnungen werden in Dollar ausgestellt. Wie kein anderer Industriestaat kann Amerika den Ölpreis beeinflussen. Die Achillesferse der Supermacht: Amerika ist vom Kapitalexporteur zum größten Kapitalimporteur in der Welt geworden. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten lebt auf Kosten der übrigen Menschheit. Im Jahr 2000 sind 64 Prozent der globalen Kapitalexporte in die Vereinigten Staaten geflossen und 400 Milliarden Dollar lieh sich Amerika im Jahr darauf auf den Kapitalmärkten der Welt. Die Nettoschuld gegenüber dem Ausland beträgt 2200 Milliarden Dollar, das sind 22 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Der Chef der amerikanischen Notenbank, Alan Greenspan, sieht darin eine große Gefahr. Je größer dieser Berg von Forderungen wird, umso höher steigen die Zinszahlungen, die Amerika an die ausländischen Geldgeber leisten muss. Wenn George W. Bush weiter so viel Schulden macht wie sein Vorbild Ronald Reagan, dann könnte der Dollar, wie bereits in den achtziger Jahren, plötzlich abstürzen.
Anfang 2003 begann der Dollar seine Talfahrt und wertete gegenüber dem Euro um 30 Prozent ab. Neue Verwerfungen in der Weltwirtschaft sind die Folge. Interessant ist, dass die Höhe des jährlichen Leistungsbilanzdefizits mit 400 Milliarden Dollar in etwa der Höhe des Militäretats entspricht. Wenn man so will, lässt sich Amerika seine gewaltige Militärmacht vom Ausland finanzieren, vor allem von Japanern und Europäern.
Auf lange Sicht müsste den Vereinigten Staaten daran gelegen sein, nicht die einzige Hegemonialmacht der Welt zu bleiben. Jedes Übergewicht zieht gleichsam automatisch universellen Widerstand auf sich und verlangt nach einem entsprechenden Gegengewicht. Die Europäer haben dabei eine große Verantwortung. Schließlich wurde der Euro nicht nur als Gemeinschaftswährung für den einheitlichen europäischen Markt, sondern auch als Gegenpart zum Dollar geprägt. Auch andere Länder wollten sich mit der Hegemonie der Vereinigten Staaten nicht abfinden. Als Boris Jelzin 1996 mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Peng zusammentraf, forderten die beiden Politiker die Rückkehr zu einer multipolaren Welt. Die atomare Aufrüstung Indiens und Pakistans ist ein Zeichen dafür, dass diese Länder sich einen eigenen Handlungsspielraum schaffen wollen. Eine Welt mit mehreren Polen, die über eine starke Volkswirtschaft und eine entsprechende militärische Macht verfügen, ist stabiler als eine monopolare.
Für die Weltpolitik sind nach wie vor drei politische Ziele maßgebend: Die Schaffung von Frieden, die Herstellung sozialer Gerechtigkeit und die Bewahrung der Umwelt. Die Ereignisse der Jahre nach dem Fall der Mauer zeigten, wie unverzichtbar es weiterhin ist, die Außen- und Innenpolitik der Staaten auf diese Ziele auszurichten.Krieg beginnt mit der Produktion von Waffen. Die alte römische Weisheit, si vis pacem para bellum, wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor, ist im Atomzeitalter schon lange nicht mehr gültig. Die Menschheit hat technische Fähigkeiten entwickelt, die ihrem moralischen Vermögen weit vorauseilen. Will sie ihren Untergang vermeiden, dann muss sie die alte Machtpolitik miteinander rivalisierender Staaten durch eine internationale Ordnung ersetzen, die Frieden und soziale Gerechtigkeit ermöglicht.
Zu Beginn des 3. Jahrtausends sind die großen Industriestaaten die Waffenproduzenten und die Waffenlieferanten der Welt. Sie sind die eigentlichen »Schurkenstaaten«, allen voran die USA. Die Verringerung der Waffenproduktion und die Abrüstung bleiben aber die Voraussetzungen eines stabilen Friedens. Dabei muss man mit den Atomwaffen beginnen. Sie sind Waffen mit einem unvorstellbaren Vernichtungspotenzial und wurden bisher von den Vereinigten Staaten in Hiroshima und Nagasaki eingesetzt. Danach, in der Zeit des Kalten Krieges, kam es zum atomaren Overkill. Jede der beiden Supermächte hatte die Fähigkeit, die jeweils andere mehrfach zu vernichten. In den siebziger Jahren begannen zwischen den USA und der UdSSR die Verhandlungen zum Abbau der Atomwaffen. Es kam zu Vereinbarungen, die Zahl der Atomsprengköpfe zu begrenzen und zu reduzieren. Mit der Umsetzung der Verträge taten sich beide Supermächte schwer. Erst mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion eröffnete sich die Chance auf eine weitere atomare Abrüstung. Im Jahre 2001 kündeten der amerikanische Präsident George W. Bush und der russische Präsident Wladimir Putin an, die Zahl der Atomwaffen weiter zu verringern. Als Bush den Vertrag, der beinhaltete, keine Raketenabwehr aufzubauen, ohne Absprache mit den Verbündeten kündigte, gab es neue Vorgaben. Er stellte in Aussicht, das amerikanische Atomarsenal einseitig von 6000 auf 1700 bis 2200 stationierte Sprengköpfe abzubauen. Im Gegenzug erklärte Putin, Russland werde die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe auf 1500 bis 2200 verringern.
Kurz danach setzte das amerikanische Militär aber durch, dass die Atomsprengköpfe nicht verschrottet, sondern »eingelagert« werden. Und als sei das noch nicht genug, wurde im März 2002 ein Pentagon-Papier bekannt, in dem Einsatzoptionen kleiner Atomwaffen erörtert wurden. Auf der Liste der Zielländer standen Iran, Irak, Nordkorea, Libyen, Syrien, China und Russland. Die Russen fühlten sich düpiert und lernten wieder einmal, dass sich das Militär in den USA gegen den Präsidenten durchsetzt. Ein weiteres Beispiel: Auch der ehemalige amerikanische Präsident Bill Clinton trat für das Verbot von Landminen ein, aber das Pentagon verhinderte den Beitritt der USA zu einem entsprechenden internationalen Abkommen. Eisenhower hatte Gründe, vor dem militärisch-industriellen Komplex Amerikas zu warnen.
Unabhängig von den Verhandlungen der Supermächte entwickelten immer mehr Staaten Atomwaffen. Das war unvermeidlich, weil die Politik der jetzigen Nuklearmächte zur Rüstungskontrolle auf einem unüberwindbaren Widerspruch beruht. Sie wollen selbst Atomwaffen behalten, aber anderen Staaten verbieten, derartige Waffen herzustellen. Dass diese Rechnung nicht aufgeht, versteht sich von selbst. Viele Staaten hatten den Atomwaffensperrvertrag nur deshalb unterzeichnet, weil die Nuklearmächte ihnen versprochen hatten, abzurüsten. Im Atomwaffensperrvertrag haben diese sich 1968 verpflichtet, »einen Vertrag zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle« abzuschließen. Leider sind die Atommächte vertragsbrüchig geworden und haben damit die weitere atomare Aufrüstung in Gang gesetzt. Es kann keine auserwählten Völker geben, die über Atomwaffen verfügen, während der Rest der Welt auf dieses militärische Drohpotenzial zu verzichten hat. Aus ähnlichen Gründen wurde der Atomteststoppvertrag von einigen Staaten abgelehnt. Aus ihrer Sicht war das Spiel des Atomclubs durchschaubar. Nachdem seine Mitglieder selbst viele Atomversuche durchgeführt hatten, wollten sie es anderen Ländern unmöglich machen, das notwendige Knowhow zur Herstellung der Bomben zu entwickeln. Mit welchem Argument will man aber Staaten wie Indien und Pakistan die atomare Bewaffnung verbieten, wenn die USA, Russland, Großbritannien, Frankreich und China weiterhin Atomstreitkräfte besitzen? Ja, selbst die von den Amerikanern so oft an den Pranger gestellten Länder wie der Irak, Nordkorea oder Libyen – die so genannten Schurkenstaaten –, können auf Israel verweisen und mit guten Gründen bei der atomaren Bewaffnung gleiches Recht für alle verlangen. 1981 vernichteten die Israelis mit einem Überraschungsangriff einen irakischen Kernreaktor, der spaltbares Material liefern sollte. Wie selbstverständlich nimmt Israel das Recht für sich in Anspruch, als einziger Staat im Nahen Osten Atomwaffen zu besitzen. Da im Konfliktfall die Atommächte, allen voran die USA, nicht nur ihre überlegenen konventionellen militärischen Fähigkeiten anwenden können, sondern ihre Nuklearmacht immer noch in der Hinterhand haben, setzen sie ihre politischen Ziele durch. Aufstrebende Staaten, die noch keine Atomwaffen haben, werden daher notwendigerweise versuchen, in den Besitz solcher Waffen zu gelangen. Will man diese Kette von atomarer Vor- und Nachrüstung durchbrechen, dann gibt es nur die Möglichkeit der völligen atomaren Abrüstung. In der Zwischenzeit sollten die Nuklearwaffen der Kontrolle der UNO unterstellt werden. Eingefleischte Realpolitiker sehen darin sicher eine weltfremde Träumerei. Aber es gibt nur zwei Wege: Entweder verzichten alle Staaten auf Atomwaffen oder immer mehr Länder werden aus Gründen des Gleichgewichts nuklear aufrüsten. Und wenn viele Staaten über Bomben verfügen, dann werden sie eines Tages auch wieder eingesetzt.
Wie mit den Atomwaffen, so verhält es sich auch mit den biologischen und chemischen Waffen. Auch hier wird es keine Weltordnung geben, in der einzelne Staaten diese Waffen besitzen, während andere auf sie verzichten. Ein Chemiewaffenabkommen wurde im Januar 1993 in Paris von 130 Staaten unterzeichnet. Spätestens zehn Jahre, in Ausnahmefällen 15 Jahre nach Inkrafttreten des Vertrages am 29.4.1997, müssen sämtliche Arsenale chemischer Waffen und die entsprechenden Produktionsanlagen vernichtet sein. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen mit Sitz in Den Haag soll die Einhaltung des Vertrages überwachen sowie Kontrollen im militärischen Bereich und bei der chemischen Industrie durchführen. Es ist also möglich, internationale Vereinbarungen abzuschließen, die den Besitz bestimmter Waffen verbieten. Aber die größeren Mächte konnten dieses Abkommen auch deshalb leicht unterzeichnen, weil sie ja immer noch auf die Atombomben zurückgreifen können. Die atomare Abrüstung bleibt die vorrangige Aufgabe der internationalen Politik.
Für die biologischen Waffen wurde 1972 ein Vertrag unterzeichnet. Er verbietet die Herstellung dieser Waffen und schreibt vor, alle Bestände innerhalb von neun Monaten nach der Vereinbarung zu vernichten. Das Abkommen wurde von 143 Staaten ratifiziert. Nicht unterschrieben haben unter anderem Israel, der Sudan und der Irak. Der Vertrag sieht aber keine ausreichenden Kontrollmöglichkeiten vor. Die Vereinigten Staaten waren trotz ihrer Erfahrungen mit den Anthrax-Anschlägen auch im Jahr 2001 nicht bereit, ein Zusatzprotokoll zu unterschreiben, das es ermöglichte, die Herstellung biologischer Waffen einer stärkeren Kontrolle zu unterziehen.
Die USA sind am Beginn des 3. Jahrtausends für die Hälfte der Waffenexporte verantwortlich und liefern an 140 Staaten, von denen 90 Prozent entweder Diktaturen sind oder die Menschenrechte nicht achten. Nicht nur imperiale oder militärische Überlegungen liegen diesen Waffenlieferungen zugrunde. Es geht oft nur ums Geld. Die Waffenproduzenten haben in den Industriestaaten eine starke politische Lobby. Sie schmieren Politiker und Parteien. So wie der Waffenhändler Karlheinz Schreiber in Bonn die politische »Landschaft« pflegte, so gibt es viele Schreibers auf der Welt. Oft sind Politiker selbst in den Waffenhandel involviert. Solche Vorwürfe wurden beispielsweise gegen den ehemaligen argentinischen Präsidenten Carlos Menem erhoben, der deshalb eine Zeit lang inhaftiert war, bis ein mit seinen Günstlingen besetztes Verfassungsgericht die Haft aufhob. Wenn die Politiker selbst nicht beteiligt waren, dann waren manchmal Mitglieder ihrer Familien in dubiose Waffengeschäfte verwickelt, wie die Söhne von Margaret Thatcher und François Mitterand. Würden Waffenexporte verboten, dann bliebe der Menschheit millionenfacher Tod und viel Leid und Elend erspart. Bei der UNO sollte eine Behörde angesiedelt werden, die das Verbot der Waffenexporte überwacht.
Nach der Auflösung der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges ist tatsächlich die Chance zu einer gerechteren Weltordnung gegeben. Sie kann aber nur genutzt werden, wenn die UNO und ihre Vollversammlung als Vorläufer einer Weltregierung und eines Weltparlaments begriffen werden. Eine neue Weltordnung setzt voraus, dass alle Staaten das von den Vereinten Nationen gesetzte internationale Recht respektieren. UNO-Generalsekretär Kofi Annan reklamiert die Zuständigkeit der Weltorganisation für die Terrorismusbekämpfung. Seine Organisation sei das natürliche Forum, um eine weltweite Koalition zu bilden. Sie allein könne dem langfristigen Kampf gegen den Terrorismus Legitimität verleihen. Da aber nur derjenige etwas durchsetzen kann, der auch über militärische Macht verfügt, muss eine Streitmacht aufgestellt werden, die im Konfliktfall von der UNO eingesetzt werden kann. Sie muss auch über technisch gut ausgerüstete Katastrophenschutzeinheiten verfügen. Als Saddam Hussein den Persischen Golf mit Öl verseuchte, sah die Weltgemeinschaft hilflos zu. Während es Bomber, Raketen und Kriegsschiffe im Übermaß gibt, fehlt es an Geräten, um Leben zu retten und Umweltkatastrophen zu bekämpfen. Weltpolizei kann nur die UNO sein, nicht ein einzelner Staat. Auch die Vereinigten Staaten werden sich auf Dauer übernehmen, wenn sie aus falsch verstandenem Eigeninteresse die Rolle des alleinigen Weltpolizisten anstreben.Weil er das sah, wollte Präsident Franklin D. Roosevelt ein System kollektiver Sicherheit, in dem die USA neben Großbritannien, der UdSSR und China die Rolle eines von vier Weltpolizisten übernehmen sollten.
Internationale Streitfälle rufen nach internationalen Gerichten. Der Gerichtshof in Den Haag muss von allen Staaten anerkannt werden. Während das Den Haager Gericht Staaten zur Rechenschaft zieht, würde ein internationaler Strafgerichtshof über Einzelpersonen urteilen. Bisher werden dafür UNO-Tribunale eingerichtet. Vor einem solchen steht auch der ehemalige serbische Präsident Slobodan Milošević. Im Zeitalter des Terrorismus ist ein internationaler Strafgerichtshof unverzichtbar. Es ist bedauerlich, dass die Vereinigten Staaten sich der Gründung eines Gerichts, das über Individualfälle verhandelt, widersetzen. Die Republikaner haben im amerikanischen Verteidigungshaushalt Hürden errichtet. Durch Zusätze zum Militärbudget wird der Präsident verpflichtet, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um Amerikaner zu befreien, die sich vor einem solchen Gericht zu verantworten hätten. In Zukunft wollen sich die USA nur dann an UNO-Friedensmissionen beteiligen, wenn die Weltorganisation den US-Soldaten Immunität garantiert. Zudem missachten Amerikaner das Kriegsvölkerrecht. Der Einsatz von Streubomben in Afghanistan widersprach den völkerrechtlich verbindlichen Genfer Konventionen.
Washington setzt auf eine militärisch gestützte Außenpolitik, die immer auch Energie- und Wirtschaftspolitik ist. Das ist nichts Neues. In seinem 1933 veröffentlichten Buch »Jahre der Entscheidung« schrieb der Kulturphilosoph Oswald Spengler: »Die Kolonial- und Überseepolitik wird zum Kampf um Absatzgebiete und Rohstoffquellen der Industrie, darunter in steigendem Maße um die Ölvorkommen. Denn das Erdöl begann die Kohle zu bekämpfen, zu verdrängen. Ohne die Ölmotoren wären Automobile, Flugzeuge und Unterseeboote unmöglich gewesen.« Der konservative Denker, dessen Hauptwerk, »Der Untergang des Abendlandes«, ein Welterfolg war, hatte gegen diesen Wirtschaftsimperialismus keine Einwände. Vielmehr warf er den deutschen Politikern das Versäumnis vor, in Mittelafrika kein großes Kolonialreich errichtet zu haben. Für ihn war der Mensch ein Raubtier. Und Sozialethiker nannte er »Raubtiere mit ausgebrochenen Zähnen«. Da wir heute allen Menschen die gleichen Grundrechte zubilligen und die Idee der sozialen Gerechtigkeit anders bewerten, müssen wir entscheiden, ob sich Deutschland an einer solchen Politik beteiligen will. Bisher waren wir stolz darauf, eine Friedensmacht zu sein. Wir hatten gelernt, auf Diplomatie, friedlichen Ausgleich und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu setzen. Auf einmal hieß es, wir dürften, wenn andere kämpfen, nicht auf den Zuschauerbänken sitzen bleiben. Aber ist uns der Platz auf den Zuschauerbänken, während die USA nach dem Zweiten Weltkrieg an vielen Orten der Erde Krieg führten, nicht gut bekommen? Damit es keine Missverständnisse gibt: Deutschland muss zum Aufbau einer internationalen Ordnung beitragen und sich an UNO-Missionen beteiligen. Aber die UNO braucht für ihre Polizeieinsätze klare Kriterien. Sie darf nicht zum Spielball einzelner Mitgliedstaaten werden. Das Vetorecht der Vereinigten Staaten, Russlands, Großbritanniens, Frankreichs und Chinas im Sicherheitsrat ist überholt. In der Demokratie geben Mehrheitsentscheidungen den Ausschlag. Das Mitmachen im Afghanistankrieg wurde von der rot-grünen Regierung aus der deutschen Bündnisverpflichtung abgeleitet. Das war weit hergeholt. Ehrlicher wäre es gewesen, zu sagen, wir laufen dem Stärksten hinterher. Mitläufertum ist in allen Zeiten und in allen Gesellschaften das Verhalten der Mehrheit. Aber es ist nicht immer richtig. Eine kleine Anekdote, die über General Charles de Gaulle erzählt wird, handelt davon, dass Menschen oft die Seiten wechseln und verschiedenen Fahnen hinterherlaufen. Als der ehemalige französische Staatspräsident am Ende des Zweiten Weltkriegs im Triumph auf den Champs-Élysées in Paris einzog, jubelten ihm viele tausend Menschen zu. Eilfertig und beflissen sagte sein Adjutant, das seien aber viel mehr als bei Pétain. Marschall Henri Philippe Pétain, der während der Besatzungszeit mit den Nazis kollaborierte, hatte als französischer Staatschef ebenfalls die Champs-Élysées genutzt, um den Jubel der Bevölkerung entgegenzunehmen. Nachdem sein Adjutant ihm mehrfach zugerufen hatte, es seien aber mehr als bei Pétain, drehte sich de Gaulle um und erwiderte barsch: »Nein, es sind genauso viele und es sind dieselben.«
Die deutsche Debatte speist sich auch aus der Erinnerung an die Nazi-Zeit. War mitmachen tatsächlich »Pflicht«, wie da und dort zu hören ist? Oder war mitmachen im totalitären Staat eher ein Zwang, dem die meisten sich fügten? Diejenigen, die sich verweigern, die Deserteure, werden immer noch verachtet. Adolf Hitler hatte in »Mein Kampf« geschrieben: »Der Soldat kann sterben, der Deserteur muss sterben.« Auf die Idee, Menschen könnten Gründe haben, sich dem Militärdienst und dem Krieg zu verweigern, kam der »Führer« nicht. Nach vielen Jahren wurde im ehemaligen KZ Buchenwald ein Gedenkstein für Kriegsdienstverweigerer und Deserteure der Wehrmacht enthüllt. Auf ihm ist zu lesen: »In Erinnerung an die Opfer der nationalsozialistischen Militärjustiz, die den Krieg verweigert haben und einem verbrecherischen Regime nicht mehr dienen wollten.« Es gibt Zeiten, in denen die Verweigerung eine moralische Pflicht ist. So lehnten französische Piloten im Afghanistankrieg mehrere Einsätze ab, weil sie das Bombardement für die Bevölkerung als zu risikoreich einschätzten. Ebenso erklärten israelische Reserveoffiziere, sie seien nicht mehr bereit, sich an Aktionen der Armee in widerrechtlich von Israelis besetzten Gebieten zu beteiligen. Der Pazifismus hat in Deutschland Tradition. Menschenliebe, christlicher Glaube oder das Bekenntnis zu einer anderen Religion können zur Ablehnung des Krieges führen. Die Pazifisten verweigern den Militärdienst und lehnen den Krieg zwischen Staaten ab. Was aber ist ihre Antwort, wenn nicht mehr Staaten gegeneinander stehen, sondern organisierte Banden die Welt terrorisieren, und wenn eine Weltregierung die Polizei einsetzt? Pazifisten hatten nie die Abschaffung der Polizei verlangt. Gegen Verbrecher wird notfalls auch mit Waffengewalt vorgegangen. Die UNO-Polizei ist aber verpflichtet, wie die Polizei der klassischen Nationalstaaten, bei der Anwendung von Waffengewalt auf die Verhältnismäßigkeit der Mittel zu achten.