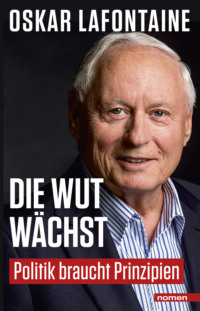Kitabı oku: «Die Wut wächst», sayfa 3
Frieden und soziale Gerechtigkeit sind untrennbar miteinander verbunden. Gerecht muss es zugehen, wenn die Güter der Welt verteilt werden. Das beginnt bei den Rohstoffen. Einer der wichtigsten Rohstoffe der Welt ist das Öl. Und die Ölquellen sind heute für Militärstrategen von ähnlicher Bedeutung wie Atombomben, Raketen oder Satelliten. Die Vereinigten Staaten stellen 4,5 Prozent der Weltbevölkerung, verbrauchen aber 25 Prozent der Welterdölproduktion. Das soll eine gerechte Weltordnung sein? Wie kein anderes Land wären die Vereinigten Staaten verpflichtet, ihre technologische Überlegenheit zur Energieeinsparung zu nutzen. Selbst der wirtschaftsnahe britische Economist empfahl den USA, nach dem 11. September eine Ökosteuer einzuführen. Die billige Polemik von CDU, CSU und FDP gegen die ökologische Steuer- und Abgabenreform der rot-grünen Koalition ist auch ein Ausweis mangelnder außenpolitischer Konzeption. Wenn die führenden Industriestaaten der Welt – zu ihnen gehört die Bundesrepublik Deutschland – bei der Energieeinsparung und bei der Entwicklung neuer Technologien zur Energiebereitstellung nicht vorangehen, dann werden die kriegerischen Auseinandersetzungen um die Öl- und Gasvorräte weitergehen. Außenpolitik im Zeitalter der Globalisierung ist Energie- und Wirtschaftspolitik.
Auch im Afghanistankrieg geht es nicht nur um Osama Bin Laden und das Talibanregime, sondern um die Öl- und Gasvorräte des Kaspischen Meeres. Es dient nicht dem Frieden, wenn die Vereinigten Staaten, unterstützt von den Europäern und der Bundesrepublik, die militärische Sicherung der Rohstoffquellen zum Bestandteil ihrer Außenpolitik erklären. Was würde man wohl sagen, wenn sich die muslimischen Staaten die texanischen Ölquellen militärisch sichern wollten?
»Überseepolitik wird zum Kampf um Absatzgebiete«, schrieb Oswald Spengler in seinem Buch »Jahre der Entscheidung«. Der Nobelpreisträger und ehemalige Chefökonom der Weltbank, Joseph E. Stiglitz, verweist auf Beispiele, die zeigen, dass es auch heute noch so ist. Das amerikanische Finanzministerium und die Weltbank forderten in Indonesien und Pakistan Verträge mit privaten Energieversorgern, die den Staat verpflichteten, große Mengen zu überhöhten Preisen abzunehmen. Als die korrupten Politiker, die diese Verträge abgeschlossen hatten, stürzten – Hutomo Suharto 1998 in Indonesien und Nawaz Sharif 1999 in Pakistan –, setzte die US-Administration die neuen Regierungen unter Druck, die Verträge zu erfüllen. Fair wäre es gewesen, auf die Neuverhandlungen der schlechten Vertragsbedingungen zu drängen. Bei diesen Konflikten müssen die Schwachen geschützt werden, damit sie überhaupt eine Chance haben. Dafür ist die Marktwirtschaft keine Garantie. In der Marktwirtschaft herrscht Wettbewerb. Wenn Kartellgesetze unfairen Wettbewerb und Monopolbildung nicht verhindern, dann haben kleine Unternehmen oft keine Chancen.
Diese Überlegungen gelten auch für den Welthandel. Dem Kampf um die Absatzgebiete soll die Welthandelsorganisation, die WTO, Regeln geben. Den Grundsätzen des fairen Wettbewerbs trägt sie aber nicht Rechnung. Sie verkehrt sie in ihr Gegenteil. Die Starken werden begünstigt und die Schwachen benachteiligt. Während die Zölle für die Industriegüter im Interesse der westlichen Staaten abgebaut wurden, verwehren diese den Entwicklungsländern den Zutritt zu ihren Agrarmärkten. Gleichzeitig stützen sie mit Milliardensubventionen ihren Agrarexport und ruinieren die Bauern in den weniger entwickelten Ländern. Hier setzen die Globalisierungskritiker an. So wie die Industriestaaten lange Jahre die heimische Wirtschaft mit Zöllen geschützt haben, bis sie wettbewerbsfähig wurde, so fordern sie, den Entwicklungsländern heute die gleichen Rechte und Chancen einzuräumen.Auch die Kritik an der Struktur der Weltfinanzmärkte wendet sich vor allem gegen die Benachteiligung der armen Länder. Die Weltfinanzkrisen haben gezeigt, wie Währungen wirtschaftlich weniger entwickelter Länder plötzlich abstürzen und wie schwere volkswirtschaftliche Schäden entstehen. Während Spekulanten gutes Geld verdienen, bezahlen Asiaten und Südamerikaner starke Wechselkursveränderungen mit Massenarbeitslosigkeit und sozialem Elend. Zu einseitig vertreten Weltbank und Internationaler Währungsfonds die Interessen des Finanzkapitals und der multinationalen Konzerne. Die mit dem »Washington-Konsens« verbundene Deregulierung des Kapital- und Güterverkehrs nützt den einen und schadet den anderen. Es war ein Fehler, in den ostasiatischen Staaten ohne eine solide Bankenstruktur den Kapitalverkehr freizugeben. Ihre Volkswirtschaften waren für diesen Schritt noch nicht reif. Um ein stetiges Wachstum der Weltwirtschaft zu erreichen, brauchen wir wieder stabilere Wechselkurse und die Kontrolle des kurzfristigen Kapitalverkehrs.
Der Export der westlichen Technologie und Lebensweise in alle Welt stößt auf kulturelle Hürden. Nach den Bombenangriffen auf Bagdad und Basra im Golfkrieg 1991 schrieb die Times of India, der Westen strebe ein regionales Jalta an, bei dem die »mächtigen Nationen die arabischen Beutestücke unter sich aufteilen«. Und weiter: »Das Verhalten der Westmächte hat uns die Kehrseite der westlichen Zivilisation gezeigt: ihre ungezügelte Gier nach Herrschaft, ihre morbide Anbetung hochtechnologischer Rüstung, ihren Mangel an Verständnis für fremde Kulturen, ihren abstoßenden Chauvinismus …«
Bei dem rasanten Tempo wirtschaftlicher und technologischer Veränderungen können viele Menschen nicht mehr folgen. Sie setzen sich zur Wehr. Kommt noch das Gefühl hinzu, benachteiligt zu sein oder gar ausgebeutet zu werden, dann wird der Nährboden des Terrorismus bereitet. Die westliche Staatengemeinschaft wäre gut beraten, stärker als bisher auf die Kulturen anderer Länder Rücksicht zu nehmen. Das gilt vor allem für die muslimische Welt.Wir haben keinen Grund, überheblich zu sein. Das Christentum kannte Kreuzzüge, Folter und Hexenverbrennungen in großem Ausmaß.
Um im Nahen Osten die Säkularisierung zu unterstützen, sollte der Türkei – wenn sie zusagt, künftig die Menschenrechte zu beachten – eine enge Zusammenarbeit mit Europa angeboten werden. Sie wäre ein Brückenkopf Europas in der muslimischen Welt. Die Türkei verdient auch deshalb unsere Hilfe, weil sie ihr Modell der Trennung von Staat und Religion in die turksprachigen Staaten Mittelasiens exportieren will. Wäre die Säkularisierung ein Ziel der westlichen Außenpolitik, dann hätte es die Unterstützung der Taliban seitens der Vereinigten Staaten über mehrere Jahre hinweg nicht gegeben. Besonders die Frauenbewegung in Amerika hat darauf hingewiesen, dass es in Afghanistan nicht nur um Pipelines, sondern auch um die Rechte der Afghaninnen gehen sollte. Wichtig ist, dass diese nicht als Mittel zum Zweck missbraucht werden. Oft genug stehen hinter einer vordergründigen Verteidigung der Menschenrechte wirtschaftsund machtpolitische Interessen. Die Gleichstellung der Frauen in Beruf und Gesellschaft muss Bestandteil der neuen Weltordnung werden.
Der Fall der Mauer und der Zusammenbruch der kommunistischen Staaten fiel in die Ära des Neoliberalismus. Mit dem Amtsantritt von Margaret Thatcher in England und Ronald Reagan in Amerika hatte sich in der westlichen Welt der Marktfundamentalismus durchgesetzt. Die Individuen sollten auf der Basis von Privateigentum einen vom Staat möglichst wenig eingeschränkten Handlungsspielraum haben. Privatisierung, Deregulierung und Flexibilisierung waren die Heilsbotschaften dieses neuen Dogmatismus. Hatte man es im Wettbewerb mit dem östlichen Kommunismus noch für notwendig angesehen, der Marktwirtschaft den Sozialstaat zur Seite zu stellen, so gab es nach dem Zusammenbruch des Ostblocks kein Halten mehr. Nicht mehr von Menschen war die Rede, sondern nur noch von Marktpreisen und Kosten. Ein neuer Totalitarismus, ein menschenverachtender Ökonomismus, wurde zur globalen Leitkultur. Aber die Ökonomisierung der Gesellschaft ist ein Weg in die Barbarei. Der Sozialstaat wurde zur überflüssigen Einrichtung erklärt, die abgebaut werden müsse. Auch sozialdemokratische Parteien und Gewerkschaften verfielen mehr und mehr dem neoliberalen Paradigma. Die Entsolidarisierung der westlichen Gesellschaften setzte ein, die Idee der Solidarität schien ihren Glanz verloren zu haben. Ein verkürztes Verständnis von Modernisierung machte sich breit. Ging es früher darum, sich aus traditionellen Bindungen zu lösen, um freier und mündiger zu werden, so geht es heute um die Anpassung der Politik an die Zwänge des internationalen Wettbewerbs. Unter Modernisierung werden jetzt Maßnahmen verstanden, die die Möglichkeiten der Menschen zu einem freien selbstbestimmten Leben erheblich einschränken. Im Zentrum wirklicher Reformpolitik steht die Freiheit des Menschen. Modernisierung ist ein anderes Wort für Emanzipation, nicht für Profit, Shareholdervalue und neue Abhängigkeit.
Solidarität in unserer Zeit heißt immer auch Verantwortung für kommende Generationen. Ihnen wollen wir eine Welt hinterlassen, in der man das Wasser noch trinken und die Luft noch atmen kann und deren Böden noch fruchtbar genug sind, um die Menschheit zu ernähren. Die Welt braucht eine umweltverträgliche Energiepolitik und die reichen Länder müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Es ist daher ein Hoffnungszeichen, dass im Jahre 2001 mehr als 100 Staaten in Marrakesch ein UNO-Abkommen zur Einschränkung der Treibhausgasemissionen getroffen haben, um die Erderwärmung zu verlangsamen. Der Vertrag wurde von den Vereinigten Staaten nicht unterschrieben – obwohl in keinem Land der Welt der Ausstoß von Treibhausgasen so hoch ist. Dem Ereignis kommt deshalb besondere Bedeutung zu, weil die Völkergemeinschaft auch dann zu globalen Vereinbarungen fähig ist, wenn die einzig verbliebene Supermacht nicht mitwirkt. Auf Dauer werden die Vereinigten Staaten jedenfalls ihre isolierte Position in der Welt nicht durchhalten können.
Langfristig ist nur eine Politik erfolgreich, die sich auf klare Grundsätze stützt und diese auch dann beherzigt, wenn ihre Missachtung von außen betrachtet kurzfristige Scheinerfolge bringt. An der Utopie der Aufklärung, der Weltgesellschaft der Freien und Gleichen müssen wir uns weiter orientieren. In der Weltgeschichte gibt es den Kairos, den richtigen Zeitpunkt. Wird der amerikanische Präsident George W. Bush die Chance erkennen und einen Beitrag zum Entstehen einer gerechteren Weltordnung leisten? Denkt er überhaupt darüber nach, warum sein Land mit 4,5 Prozent der Weltbevölkerung 25 Prozent der gesamten Erdölförderung verbraucht, 40 Prozent der Militärausgaben der Welt in seinen Haushalt stellt, für 50 Prozent aller Waffenexporte verantwortlich ist und, obwohl es zu den reichsten Ländern gehört, 64 Prozent des auf den Weltmärkten angebotenen Kapitals zur Verbesserung seines Lebensstandards benötigt? Bisher spricht vieles dagegen. Bush hatte mit einem »compassionate conservatism«, einem mitfühlenden Konservatismus, Wahlkampf gemacht.
Als seinen Lieblingsphilosophen nannte er Jesus. Und er ließ die Welt wissen, seine Kraft und seinen Optimismus ziehe er aus seinen Gebeten. Bush ist von missionarischem Eifer erfüllt, das Böse auszurotten. Seit dem 11. September, so las man in der New York Times, sieht er sich als Werkzeug Gottes. Dafür halten sich auch die muslimischen Selbstmordattentäter. So wie Bush von der »Achse des Bösen« spricht, so nennen sie die USA den »großen Satan«.
Werden auf der anderen Seite die Europäer, deren Kontinent die Philosophie der Aufklärung hervorgebracht hat, ihre Rolle in der neuen Weltordnung finden? In keinem Fall dürfen sie der Versuchung erliegen, den USA beim Aufbau einer globalen Militärmacht nachzueifern. In der Welt gibt es viele Waffen, aber zu wenig Hilfe für die Hungernden und Unterdrückten. Auch in der Weltpolitik sollte Immanuel Kants kategorischer Imperativ Geltung haben: »Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde.« Würden alle Staaten das Völkerrecht missachten, Atomwaffen produzieren, Waffen exportieren und so viel Energie verbrauchen, wie die Industriestaaten, dann wäre die Welt bereits zerstört. In ethischer Hinsicht sind die entwickelten Länder, allen voran die Vereinigten Staaten, unterentwickelt. Eine gerechte Weltordnung setzt voraus, dass die reichen Länder lernen, mit den ärmeren Solidarität zu üben. Dabei müssen sie ihre Ansprüche zurücknehmen. Das gilt vor allem für Amerika, das seinen Willen zur Weltherrschaft aufgeben und zu partnerschaftlicher internationaler Zusammenarbeit bereit sein muss. Der Anschlag vom 11. September hat die großen Stärken und Schwächen der Vereinigten Staaten noch einmal jedem vor Augen geführt.
Anschlag auf Amerika
Gebt mir Eure Müden, Eure Armen, Eure bedrängten Massen, die sich danach sehnen, frei zu atmen, das elende Strandgut Eurer überbevölkerten Gestade. Schickt sie, die Heimatlosen, die Sturmverwehten zu mir, ich erhebe meine Lampe am goldenen Tor.« Diese bewegenden Worte stehen auf dem Sockel der amerikanischen Freiheitsstatue. Die Vereinigten Staaten sind eine Nation von Einwanderern.
Sie mussten stets gegen Beschränktheit und Fremdenfurcht kämpfen. Immer wieder haben sie Zuwanderer aufgenommen, deren Ideen, Werte, Traditionen und Lebensart verschieden waren. Die Bürgerinnen und Bürger der USA lernten mit Menschen zusammenzuleben, die aus anderen Kulturkreisen kamen. Nirgendwo erlebt man das so beeindruckend wie in New York. Der Terroranschlag vom 11. September erschütterte das Land in seinem Selbstverständnis. Die Gewissheit, unangreifbar und unbesiegbar zu sein, wich einem Gefühl der Angst. Vier amerikanische Passagiermaschinen waren von arabischen Terroristen gekapert worden. Zwei wurden in die Türme des World Trade Centers gelenkt. Eine Maschine stürzte auf das Pentagon. Das vierte Flugzeug verfehlte sein Ziel. Es sollte den Landsitz des amerikanischen Präsidenten, Camp David, zerstören. Nach einem Handgemenge zwischen Terroristen und Passagieren stürzte diese Maschine in Pennsylvania ab. Mit großem Erstaunen las ich kurz nach den Anschlägen ein Gedicht, das Erich Kästner 1930 geschrieben hat. Hier ein Auszug:
Am 12. Juli des Jahres 2003
lief folgender Funkspruch rund um die Erde,
dass ein Bombengeschwader der Luftpolizei
die gesamte Menschheit ausrotten werde.
Die Weltregierung, so wurde erklärt, stelle fest,
dass der Plan, endgültig Frieden zu stiften,
sich gar nicht anders verwirklichen lässt,
als alle Beteiligten zu vergiften.
Am 13. Juli flogen von Boston 1000
mit Gas und Bazillen beladene Flugzeuge fort
und vollbrachten, rund um den Globus sausend
den von der Weltregierung befohlenen Mord.
Die Flugzeuge, die das World Trade Center zerstörten, starteten in Boston. Von den Twin-Towers, die die Skyline der Stadt New York krönten, blieb nur ein Haufen Schrott und Steine. Über 3000 Menschen kamen ums Leben. Bei den Rettungsversuchen fanden 400 Feuerwehrleute und Polizisten den Tod. Nie werde ich die Bilder von den verzweifelten Menschen vergessen, die sich aus den Fensters stürzten. Zum Ground Zero pilgerten Staatsmänner aus aller Welt, um ihre Trauer über die Opfer der Anschläge und ihre Solidarität mit Amerika zu bekunden. Noch Wochen später sah man überall dunkle Rauchschwaden. Wenn Trümmerteile entfernt wurden, loderte das Feuer immer wieder auf. Der Terroranschlag hat Opfer aus mehr als 80 Nationen gefordert. Die Menschen, die im World Trade Center arbeiteten, waren unterschiedlicher Rasse und Religion. Die Twin-Towers galten als Symbol des internationalen Handels und Wohlstandes. Nach den Anschlägen wurde der damalige Bürgermeister von New York City, Rudolph Giuliani, zur Leitfigur seiner Stadt. Er dirigierte die Aufräumarbeiten und machte den New Yorkern Mut. Zu den Anschlägen sagte er: »Dies war ein Angriff auf die Idee einer freien, offenen Gesellschaft. Auf die Idee selbst, auf die Herrschaft des Rechts, auf die politische, religiöse und wirtschaftliche Freiheit, ja auf unsere Ehrfurcht vor dem Leben. Es war ein Angriff auf die zivilisierte Welt. Jede moralische Relativierung, mit der versucht wird, ihn zu rechtfertigen, ist ein Angriff auf die Prinzipien unserer Kultur. Diejenigen, die Terrorismus praktizieren, haben das Recht verwirkt, ihre Ziele durch normale Menschen und gesetzestreue Nationen gewürdigt zu sehen … Moralischer Relativismus hat in dieser Debatte keinerlei Platz, denn es gibt keinen moralisch gangbaren Weg, um mit amoralischen Nationen zu sympathisieren.«
Die Worte des ehemaligen Bürgermeisters von New York geben Stärke und Schwäche Amerikas exemplarisch wieder. Nach dem Massaker gab Giuliani seiner Stadt neuen Lebensmut und verlieh der Trauer Ausdruck. Aber wenn er »moralischen Relativismus« verwirft, wird er angreifbar. Amerika ist im Vergleich zu anderen Ländern eine freie und offene Gesellschaft. Aber die demokratischen Wahlen, an denen gerade die Hälfte der US-Bürger teilnimmt und der unglückliche Wahlentscheid zwischen George W. Bush und Al Gore – Gore hatte mehr Stimmen als Bush, aber Letzterer wurde Präsident – trüben das Bild. Die Wahlkampffinanzierung sorgt für die Herrschaft des Geldes und nicht für die des Volkes. Die soziale Gerechtigkeit hat in Amerika einen geringen Stellenwert. Millionen Amerikaner haben keine Gesundheitsvorsorge und die Gefängnisse sind überfüllt. Und wie steht es mit der Ehrfurcht vor dem Leben? In den USA gibt es die Todesstrafe. Und seit Hiroshima und Nagasaki und den vielen Bombenkriegen in den zurückliegenden Jahren, fällt es schwer, die Ethik des großen elsässischen Humanisten Albert Schweitzer mit Amerika in Verbindung zu bringen. Auf der internationalen Ebene halten sich die Vereinigten Staaten nicht an Recht und Gesetz.
Präsident George W. Bush sprach von einer nationalen Tragödie und kündigte Vergeltung an.Man werde die Verantwortlichen »zur Strecke bringen« und »die Terroristen in ihren Löchern ausräuchern«. Die Vereinigten Staaten würden, so Bush weiter, keinen Unterschied machen zwischen Terroristen, die diese Taten begangen haben, und denjenigen, die sie unterstützten.
Erwartungsgemäß verdächtigten die USA Osama Bin Laden als den Drahtzieher der Anschläge. In einem erst später entdeckten Video bekannte sich dieser zu deren Urheberschaft. Er sagte: »Die Brüder, die den Einsatz leiteten, wussten nur, dass es um eine Märtyrer-Operation gehen sollte und wir baten jeden von ihnen, nach Amerika zu gehen. Sie waren ausgebildet, und wir haben ihnen gegenüber die Operation nicht offenbart, bis sie dort waren und erst kurz bevor sie an Bord gingen … Mohammed Atta aus der ägyptischen Familie war für die Gruppe verantwortlich. Diejenigen, die das Fliegen erlernt hatten, kannten die anderen nicht … Wir berechneten im Voraus die Anzahl der Menschen, die aufgrund der Position der Türme getötet werden würden. Aufgrund meiner Erfahrungen auf diesem Gebiet rechnete ich damit, dass das Feuer aus dem Kerosin im Flugzeug das Stahlgerüst des Gebäudes zum Schmelzen bringen würde.« Die kalte Analyse des Terrorscheichs empörte viele Menschen.
Bush forderte noch vor der Veröffentlichung dieses Videos die Taliban auf, Bin Laden und seine Gefolgsleute auszuliefern. »Wir sind bereit, mit den USA über das Schicksal von Osama Bin Laden zu verhandeln, aber die USA müssen zuerst genügend Beweise gegen ihn übergeben«, sagte der Taliban-Botschafter in Pakistan. Auf Verhandlungen ließ sich Bush aber nicht ein. Auch wenn die USA die Beweise rechtzeitig gebracht hätten, wären die Taliban nicht in der Lage gewesen, ihren Gast der amerikanischen Justiz zu übergeben. Die mehrere tausend Mann umfassende Truppe arabischer Gotteskrieger hätte ihren Anführer bis zur letzten Patrone verteidigt. In der ersten Phase des Afghanistankrieges fielen 400 bis 600 Mann dieser Elitetruppe der al-Qaida. 3000 bis 3500 Kämpfern gelang nach Geheimdienstberichten die Flucht.
Nach den Terroranschlägen verlor Amerika seine Unschuld. Die Abgeordnete Barbara Lee, die im Kongress als Einzige gegen Bushs Feldzug gestimmt hatte, brauchte Polizeischutz. Menschen, die fremd aussahen, wurden verdächtigt. John Cooksey, republikanischer Kongressabgeordneter in Washington, rief zur Jagd auf Turbanträger auf: »Wenn da einer am Steuer sitzt mit einer Windel auf dem Kopf, wird der Kerl natürlich rausgewunken und dann müssen wir uns den Burschen vorknöpfen.« Zwar entschuldigte sich Cooksey später, aber das verhinderte nicht mehr, dass einige Turbanträger in Amerika angegriffen und ermordet wurden. Um die aufkommende fremdenfeindliche Stimmung zu dämpfen, besuchte George W. Bush eine Moschee. Zum Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan sandte er eine Grußbotschaft an die Moslems in aller Welt. In ihr hieß es: »Der Islam lehrt den Wert und die Bedeutung von Wohltätigkeit, Gnade und Frieden.«
Eine Demokratie bewährt sich dadurch, dass sie die Rechte der Minderheiten schützt. Amerika wollte nach den Terroranschlägen vom 11. September anders reagieren als im Zweiten Weltkrieg. Als die japanische Luftwaffe im Dezember 1941 die US-Marine in Pearl Harbor bombardierte, kamen 3500 Amerikaner ums Leben. Viele tausend Japaner, die in die Vereinigten Staaten eingewandert waren, wurden danach in Sammellager gesperrt. Im Jahr 2001 veranstaltete man dagegen in New York bewegende Trauerfeiern, an denen auch viele amerikanische Muslime teilnahmen.
Unabhängig davon wurden die US-Bürger misstrauisch und unruhig. Neue Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen forderte man im ganzen Land. Wachsende Angst vor dem unbekannten Feind breitete sich aus. Der Kongress verabschiedete ein Antiterrorgesetz, in dem die Einschränkung der Bürgerrechte in Kriegszeiten verankert wurde. Weil vier Terrorverdächtige hartnäckig schwiegen, wurde die Einführung der Folter gefordert. 45 Prozent der Amerikaner sprachen sich nach einer Gallup-Umfrage dafür aus. Im Wall-Street-Journal wurde daran erinnert, dass philippinische Folterknechte Pläne vereitelt hatten, in denen vorgesehen war, amerikanische Flugzeuge abstürzen zu lassen. Warum foltern wir nicht Terroristen, um Anschläge zu verhindern, bei denen tausende sterben können, wurde gefragt. Die Gegner dieses Rückfalls in die Barbarei wiesen auf die vielen Feldzüge hin, die Amerika für die Menschenrechte unternommen hatte. Artikel 5 der Internationalen Erklärung der Menschenrechte wurde zitiert: »Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.« Etwas später berichtete die Washington Post, die CIA habe eine Lösung gefunden. Die Verdächtigen werden an Länder mit »ungewöhnlichen Verhörmethoden« ausgeliefert. Diese geben die durch die Folter erhaltenen Informationen dann an die USA weiter. Im Kampf gegen den Terror werden die Werte verraten, für die die freiheitlichen Demokratien stehen.
George W. Bush erließ eine Anordnung, dass Terrorprozesse vor US-Militärgerichten geführt werden sollen. Solche Militärgerichte wurden zuletzt 1942 im Zweiten Weltkrieg vom damaligen Präsidenten Franklin D. Roosevelt eingesetzt, um deutschen Saboteuren den Prozess zu machen. Durch diese Maßnahme erschwerte Bush die internationale Strafverfolgung. Gegen den Plan, ausländische Terroristen vor Militärgerichte mit stark eingeschränkten rechtsstaatlichen Verfahren zu stellen, wandten sich vor allem die Europäer. In den Gefängnissen Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und Spaniens saßen Verdächtige, die die Vereinigten Staaten gerne übernehmen wollten. Aber die Europäer wussten nicht, wie sie vorgehen sollten, ohne die eigenen Rechtsgrundsätze aufzugeben, weil die amerikanischen Militärtribunale die in Europa geächtete Todesstrafe verhängen konnten.
Gefangene Taliban und al-Qaida-Kämpfer internierten die USA auf dem kubanischen Militärstützpunkt Guantanamo. Gegen das internationale Recht wurde ihnen zunächst der Status des Kriegsgefangenen nach der Genfer Konvention vorenthalten. Sie waren in Käfigen mit einer Grundfläche von einem Meter achtzig mal zwei Meter vierzig eingepfercht. Die UNO-Menschenrechtsbeauftragte Mary Robinson musste öffentlich die Einhaltung der Grundrechte für die Gefangenen anmahnen.
Hinter der rigorosen Beschränkung bürgerlicher Rechte stand der Justizminister John Ashcroft. Er ist der Sohn eines Pfingstler-Pfarrers und wurde erzogen, Seelen zu retten. Wenn andere Zeitungen lesen, liest Ashcroft morgens in seinem Büro Mitarbeitern die Bibel vor. Er raucht nicht, trinkt nicht, flucht nicht und tanzt nicht. Auch den traditionellen Brauttanz bei Hochzeitsfeiern, so wird berichtet, lehnt er ab, weil dieser ihn sexuell erregen könnte. In der Halle seines Ministeriums ließ Ashcroft eine weibliche Statue mit entblößter Brust verhüllen. Die Lebensweise Ashcrofts erinnert an den religiösen Fundamentalismus der Muslime.
Nach den Anschlägen, die Schrecken und Furcht verbreiteten, war Patriotismus angesagt. Amerika war ein einziges Flaggenmeer. Frauen und Männer trugen stets sichtbar Anstecknadeln mit dem Sternenbanner. Die Kinder kamen in T-Shirts, auf denen die amerikanische Flagge gedruckt war. Feuerwehrmänner, Polizisten und Soldaten waren die Helden der Nation. Die Meinungsfreiheit geriet in Gefahr. Robert Jensen beispielsweise hatte im Houston Chronicle einen Artikel veröffentlicht. Darin verurteilte er die Terroranschläge. Gleichzeitig sah er in ihnen eine Reaktion auf die verfehlte amerikanische Nahostpolitik und auf die massenhaften Akte des Terrorismus, welche die USA im Irak und in anderen Staaten begangen hätten. Der Aufsatz löste Proteststürme aus. Ähnlich erging es anderen Amerikanern, die es wagten, sich dem Mainstream entgegenzustellen.Verfasser kritischer Artikel verloren ihren Job. Erinnerungen an die Hexenjagd der fünfziger Jahre kamen hoch. Schwarze Listen tauchten wieder auf. In ihnen wurden »unpatriotische Umtriebe« von Liberalen und Pazifisten aufgelistet. In einer Zeit, in der die Meinungsfreiheit eine demokratische Gesellschaft vor Fehlentscheidungen bewahren kann, wurde sie unterdrückt. Unterdessen übten sich einige US-Bürger in makabrem Humor. Toilettenpapier mit dem Konterfei Bin Ladens wurde angeboten. In den Urinbecken amerikanischer Imbisshallen klebten Fotos des Terrorscheichs. Den Vogel schoss das Investmenthaus Merrill Lynch ab. Am 13. September veröffentlichte es in einer italienischen Wirtschaftszeitung eine Anzeige: »Von heute an hat der Aktienmarkt einen neuen Anführer.« Der Hauptkonkurrent Morgan Stanley hatte im Südturm des World Trade Centers Büros, in denen 2500 Mitarbeiter beschäftigt waren. Die Freude von Merrill Lynch währte nicht lange. Morgan Stanley teilte mit, dass so gut wie alle Mitarbeiter gerettet werden konnten. So geht es zu im Raubtierkapitalismus.