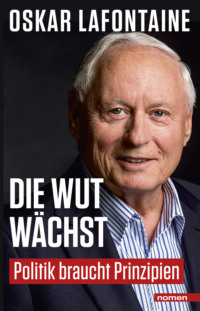Kitabı oku: «Die Wut wächst», sayfa 4
Die Schwurfinger des Geldes
Das World Trade Center war ein Zentrum der Globalisierung. Der Schriftsteller Botho Strauß nannte die Twin-Towers »Schwurfinger des Geldes«. Sie seien »abgehackt worden«. Das Gesetz des Islam, die Scharia, sieht vor, Dieben die Hand abzutrennen. Im Bild des Dichters wird der Kampf der Armen gegen die Reichen, der Muslime gegen die restliche Welt, zusammengefasst. Aber wie so oft wurden Unschuldige zum Opfer dieses Kampfes. Der Anschlag hatte eine Symbolik, die nicht zu übertreffen ist. Schon der russische Anarchist Michail Aleksandrowitsch Bakunin forderte, dass von dem Terrorakt eine Propagandawirkung ausgehen müsse, und er empfahl den Schlag gegen das Zentrum. Der war den Attentätern gelungen. Wenn irgendwo die Spielhöllen des Kasinokapitalismus stehen, dann in New York. Wenn Geld die Welt regiert, dann ist New York die Welthauptstadt. Hier jagen Investmentbanker und Derivatenhändler Milliarden Dollar um den Erdball. Insidergeschäfte werden gemacht und Analysten und Journalisten spielen zusammen, um den Anlegern »die Haut vom Gesicht zu reißen«. So drücken sich die Händler aus, wenn sie einen Anleger um eine Menge Geld gebracht haben. Die Wall Street ist mächtiger als der amerikanische Präsident.
Viele Filmregisseure und Schriftsteller hatten New York schon zuvor zum Schauplatz ähnlicher Katastrophenszenarien gewählt. Aber als das schreckliche Ereignis dann eintrat, waren alle geschockt. Das Massaker hatte nur wenige sichtbare Leichname hinterlassen. Die Menschen trauerten, aber sie konnten ihre Toten nicht begraben. »Warum waren in den Türmen keine Fallschirme?«, fragte ein Kind. Dass die Gigantomanie der modernen Architektur Gefahren birgt, haben viele gewusst oder zumindest geahnt. Der saarländische Lyriker Johannes Kühn, der besonders in Frankreich hohe Wertschätzung genießt, verfasste am 31. Januar 2001 ein Gedicht mit dem Titel »Hochhaus«. Dort heißt es:
Unter ihm geh ich staunend hin,
verwünsch die Bombe,
die es treffen könnte,
und bin in Kriegsangst.
Aufdämmern lässt sie ein Flugzeug,
das noch höher fliegt,
als das Haus steht,
in lauter Raserei voll Raketenlärm
am Mittagshimmel.
Ich glaubte, ich sei im Film, weil ich im Kino ähnliche Bilder gesehen hatte. Dass das soeben gesehene Wirklichkeit war, drang nur langsam in mein Bewusstsein. Dabei war die Welt vorgewarnt.
Der Terrorist Ramzi Ahmed Yousef hatte am 26. Februar 1993 in einer Tiefgarage unter dem World Trade Center eine Bombe gezündet, die er selbst konstruiert und gebaut hatte. Bei seinem Anschlag kamen fünf Menschen ums Leben und 1000 wurden verletzt. Die Explosion war die größte Katastrophe, mit der die New Yorker Feuerwehr bis dahin in ihrer 128-jährigen Geschichte konfrontiert worden war. Zwar hatten die US-Behörden Telefongespräche aufgezeichnet, die auf die Planung eines Bombenanschlags im World Trade Center hinwiesen, leider konnte aber keiner der zuständigen Beamten Arabisch. Yousef schwieg sich über seine Geldgeber aus. Er stand auch als Informant auf der Gehaltsliste des FBI. Seine Identität konnte nicht eindeutig festgestellt werden. Er war in Großbritannien zum Elektrotechniker ausgebildet worden und anschließend in den von Bin Laden finanzierten Camps in Afghanistan zum Terroristen. Yousef war kein Selbstmordattentäter. Vielmehr hatte er seine Fluchtwege sorgfältig vorbereitet. Im Zuge der Ermittlungen hatten die Behörden herausgefunden, dass auch die Sprengungen wichtiger Tunnels und Brücken und des UN-Gebäudes in New York geplant worden waren. Als Yousef zu 240 Jahren Haft verurteilt wurde, erklärte er: »Ich bin ein Terrorist, und ich bin stolz darauf.« Sein Ziel sei es gewesen, die amerikanische Politik im Nahen Osten zu verändern. Er warf den Vereinigten Staaten vor, unschuldige Menschen zu töten. Sie hätten die indianischen Ureinwohner und andere Minderheiten unterdrückt und misshandelt. Die USA hätten seiner Ansicht nach den Terrorismus erfunden.
Von dem erneuten Anschlag auf das World Trade Center konnte daher niemand überrascht sein. Die Ermittlungen nach dem Terrorakt vom 26. Februar 1993 lieferten alle notwendigen Hinweise. Der Regierung Bush, so wurde später bekannt, lagen Informationen der Geheimdienste vor, nach denen es bald zu größeren Terroranschlägen kommen würde. Zudem hatte ein Fluglehrer aus Minnesota das FBI im August 2001 gewarnt, Terroristen könnten ein Linienflugzeug als Waffe benutzen. Er schöpfte Verdacht, weil einer seiner auszubildenden Piloten – er stellte sich tatsächlich als einer der Terrorpiloten des 11. September heraus – sich auffallend für die Boing 747 interessierte. Zudem wollte er keine Fragen nach seinem persönlichen Hintergrund beantworten. Die CIA hatte sich in den letzten Jahrzehnten überwiegend auf technische Verfahren konzentriert.Sie überwachte den Funkverkehr und machte Satellitenfotos. Das war im Kalten Krieg sicher sinnvoll. Aber wie sich zeigte, reichen diese Mittel nicht aus, um den Terrorismus zu bekämpfen. Es wurde gefordert, wieder mehr Agenten einzusetzen. Bei näherem Hinsehen stellte man aber fest, dass die Orientalistik in den Vereinigten Staaten zu den Fächern gehört, für die sich kaum jemand interessiert. Die Voraussetzungen für das Anwerben von Mitarbeitern, die ein kulturelles und soziales Verständnis der islamischen Länder haben, sind äußerst schlecht.
Die amerikanischen Politiker mussten neu darüber nachdenken, wie sie ihren Bürgern Schutz und Sicherheit gewährleisten konnten. Das Antiraketenprogramm, das Präsident George W. Bush mit seiner Regierung zum vorrangigen Ziel erklärt hatte, war auf einmal infrage gestellt. Nicht heranfliegende Raketen mit atomaren, biologischen oder chemischen Sprengköpfen bedrohten Amerika, sondern Menschen, die, mit Teppichmessern bewaffnet, eine große Katastrophe auslösen konnten. Den Terroristen wäre es beinahe gelungen, die Zentren der amerikanischen Politik komplett zu zerstören. Wer hätte je gedacht, dass es so leicht sei, eine Boeing über dem Pentagon abstürzen zu lassen? Man musste doch davon ausgehen, dass die Schaltzentrale der größten Militärmacht der Welt gegen solche Anschläge mehrfach gesichert war. Unwillkürlich fühlte ich mich an den jungen Sportflieger Matthias Rust aus Wedel bei Hamburg erinnert, der vor Jahren seelenruhig mit einem Privatflugzeug auf dem Roten Platz in Moskau gelandet war. Er hatte vorher – von der russischen Luftabwehr unbehelligt – eine Schleife über dem Kreml gedreht.
Anfang 2002 steuerte ein 15-jähriger Schüler mit einer Sportmaschine in ein Hochhaus, nachdem er für kurze Zeit in den Luftraum über dem Luftwaffenstützpunkt MacDill in Tampa eingedrungen war. Dort ist das Hauptquartier des Zentralkommandos der Vereinigten Staaten, das den Krieg in Afghanistan leitet. Hätte der Schüler es mit Sprengstoff beladen und über der Kommandozentrale abstürzen lassen, dann wäre sie schwer beschädigt worden. Obwohl die Luftabwehr schon gegenüber kleinen Privatflugzeugen versagte, hielt die Bush-Administration an dem Antiraketenprogramm fest. Schließlich versprach sich die Republikanische Partei, wie zu Zeiten Ronald Reagans, von der Aufrüstung Impulse für die amerikanische Wirtschaft. Zudem hatte die Rüstungsindustrie für Bushs Wahlkampf viel Geld gespendet.
Die Reaktionen in der übrigen Welt auf die Terroranschläge vom 11. September waren zwiespältig.Während in den westlichen Industriestaaten Anteilnahme und Trauer vorherrschten, kam im Nahen Osten, in Asien, Südamerika und Afrika Schadenfreude auf. Viele fragten sich, warum es zu diesen Anschlägen gekommen war und warum die amerikanische Politik soviel Hass in der Welt hervorrief.
Eine Umfrage der in Paris erscheinenden Zeitung International Herald Tribune unter 275 einflussreichen Persönlichkeiten aus Politik, Medien, Wirtschaft und Kultur ergab, dass 58 Prozent der Befragten – soweit sie keine Amerikaner waren – meinten, die US-Politik sei eine der wichtigsten Ursachen für den 11. September. Unter den US-Bürgern vertraten nur 18 Prozent diese Ansicht. 60 Prozent der Nichtamerikaner gaben zudem an, dass die USA zumindest teilweise für die große Kluft zwischen Arm und Reich auf der Erde verantwortlich seien, und dass das reichste Land der Erde zu wenig für die armen Länder täte.
Das trifft ohne Zweifel zu, denn Amerika gibt am meisten für das Militär, aber am wenigsten für die Entwicklungshilfe aus. Und was ist mit der Außenpolitik Washingtons als Ursache des Terrors? Wenigen Amerikanern war im September 2001 bewusst, dass die USA in einem gemeinsamen Einsatz mit Großbritannien den Irak regelmäßig bombardierte. 500 000 irakische Kinder starben bislang an Unterernährung und Krankheit – als Folge des verhängten Wirtschaftsembargos. Seit Pearl Harbor hat kein Staat die USA angegriffen, aber die Vereinigten Staaten mussten immer wieder Länder mit Gewalt daran hindern, die freie Welt zu verlassen und kommunistisch zu werden. Jetzt werden Staaten angegriffen, die Terroristen beherbergen oder Massenvernichtungswaffen herstellen. Mit dieser Begründung ließ Präsident Bill Clinton während der Lewinsky-Affäre eine Aspirinfabrik im Sudan bombardieren. Die Liste der Länder, mit denen Amerika seit dem Zweiten Weltkrieg Krieg geführt hat, die es bombardiert hat oder in denen es in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt war, ist lang: Korea, Guatemala, Indonesien, Kuba, Zaire, Laos, Vietnam, Kambodscha, Grenada, Libyen, El Salvador, Nicaragua, Panama, Irak, Bosnien, Sudan, Jugoslawien und jetzt Afghanistan. Als Präsident George W. Bush die Luftangriffe auf Kabul ankündigte, sagte er: »Wir sind eine friedliche Nation.« Aber warum hat die friedliche Nation in den letzten Jahren so viele Kriege geführt? Alle nur im Namen der Freiheit und der Menschenrechte? Der englische Schriftsteller Harold Pinter zitierte im November 2001, als ihm die Hermann-Kesten-Medaille verliehen wurde, in seiner Dankesrede im Hinblick auf die amerikanische Machtpolitik William Shakespeare, der im »Julius Cäsar« den Cassius sagen lässt:
Ja, er beschreitet, Freund, die enge Welt
wie ein Colossus, und wir kleinen Leute,
wir wandeln unter seinen Riesenbeinen,
und schauen umher nach einem schnöden Grab.
Das Pentagon ist sich sehr wohl der Tatsache bewusst, dass die vielen Militärinterventionen der Amerikaner Folgen haben. So schrieben schon 1997 Mitglieder des Defense Science Board, eine Abteilung des amerikanischen Militärs zur Entwicklung neuer Strategien und Konzepte, in einem Bericht: »Historische Daten belegen einen engen Zusammenhang zwischen der US-amerikanischen Verwicklung in internationale Situationen und einer Zunahme von Terroranschlägen gegen die Vereinigten Staaten. Zudem verleitet die militärische Asymmetrie, die anderen Staaten offene Angriffe auf die USA unmöglich macht, zum Einsatz von übernationalen Tätern.« Gemeint sind damit Terroristen, die Anschläge auf Einrichtungen der Vereinigten Staaten verüben. In der amerikanischen Diskussion ist vom »Blowback«, vom Rückstoß der amerikanischen Außenpolitik die Rede. Wann werden die Vereinigten Staaten aus dem engen Zusammenhang zwischen den US-Militärinterventionen und den Terroranschlägen gegen die Vereinigten Staaten Konsequenzen ziehen? Und haben die Staatsmänner Europas diese Gefahren bedacht, als sie die Beteiligung ihrer Soldaten am Afghanistankrieg anboten? Der Terrorismus kann nicht durch Krieg bekämpft, geschweige denn ausgerottet werden. Wenn im Bombenhagel viele Unschuldige sterben, wächst die nächste Terroristengeneration heran. »Der Krieg ist darin schlimm, dass er mehr böse Menschen macht, als er deren wegnimmt«, schrieb Immanuel Kant.
Keine eigenen Toten
Unmittelbar nach den Anschlägen war oft vom Krieg die Rede. Aber bald wurde klar, dass das Wort »Krieg« nicht angemessen war. Unter »Krieg« versteht man das Gegeneinander von Staaten und Armeen. Davon konnte keine Rede sein. Zwar kämpften in vielen Ländern der Welt bereits marodierende Banden gegeneinander, die kein Interesse an der Rückkehr des Friedens hatten, aber diese Deregulierung und Privatisierung des Krieges war bisher eine Angelegenheit der Dritten Welt. Jetzt aber hatte diese neue Form der Gewaltanwendung die einzig verbliebene Supermacht erreicht. Das war kein Zufall. In den achtziger Jahren wurden in den USA in verschiedenen Städten Rekrutierungsbüros für die Anwerbung islamischer Jugendlicher für den »Heiligen Krieg«, den Dschihad, in Afghanistan eröffnet. Solche Büros gab es unter anderem in New York, Detroit und Los Angeles. Das Al-Kifah-Afghan-Refugee-Center in Brooklyn war von Osama Bin Ladens Freund Scheich Abdullah Azzam gegründet worden, der 1989 ermordet wurde. Er reiste damals quer durch die USA und sammelte Spenden und Freiwillige für den Dschihad. Unter Präsident Jimmy Carter hatte man damit begonnen, »heilige Krieger« zu trainieren. Sie sollten gegen die Kommunisten kämpfen. Ronald Reagan führte dieses Programm fort. Auch der Bundesnachrichtendienst hatte Mitte der achtziger Jahre die afghanischen Mudschaheddin Kampf gegen die sowjetischen Invasoren unterstützt. Während die CIA Waffen lieferte, schickte der BND Gasmasken, Nachtsichtgeräte, Decken und Zelte in die pakistanische Stadt Peschawar.
Kriege zwischen Staaten werden nach Auffassung von Militärtheoretikern immer seltener, weil starke Länder in der Lage sind, Atomwaffen zu bauen. Diese Waffen bedrohen auch die Supermacht USA und andere Industriestaaten in ihrer Existenz. Dieser Gefahr wollen sie um jeden Preis ausweichen. In den zurückliegenden Jahren wurden die Kriege häufig von Organisationen geführt, die keine Territorien besitzen und die keinen Staat repräsentieren. Zu nennen sind hier die ETA, die IRA, die Hamas, die Hisbollah und auch al-Qaida. Auch eine Supermacht kann diesen Organisationen nicht mit Raketen und Atomwaffen drohen. Terrorismus ist die Möglichkeit, eine übermächtige Militärmacht herauszufordern. Von den mehr als 100 bewaffneten Konflikten, die nach 1945 in der Welt ausgetragen wurden, waren die meisten von nichtstaatlichen Organisationen angezettelt worden. Schwere Waffen sind immer weniger in der Lage, solche Konflikte zu beenden.
Ein Wandel im Wesen des Krieges ergab sich aber vor allem dadurch, dass die Supermacht USA im Lauf der Jahrzehnte die Art und Weise ihrer Kriegführung entscheidend veränderte. Im Ersten Weltkrieg ließen 114 000 Amerikaner ihr Leben, im Zweiten Weltkrieg waren es 292 000. Im Vietnamkrieg kamen 57 939 Soldaten um, im Koreakrieg waren es 37 904. Solche Verluste an Menschenleben waren dem amerikanischen Volk kaum noch zu vermitteln. Daher wurde die Strategie der Kriegführung derart neu gestaltet, dass möglichst wenig amerikanische Soldaten fielen. Im Golfkrieg starben dann nur noch 148 Soldaten, und im Kosovokrieg hatte die US-Armee keine Toten zu beklagen. Während die amerikanischen Luft- und Seestreitkräfte den jeweiligen Gegner mit einem Bombenteppich belegten, kämpften am Boden diejenigen, denen die Amerikaner den Weg freibombten. In Jugoslawien die Kroaten und Albaner und in Afghanistan die Nordallianz. Diese Art der Kriegführung geht zulasten der jeweiligen Zivilbevölkerung. Viele Menschen sterben im Bombenhagel. Diese, die Regeln des Kriegsvölkerrechts außer Kraft setzende Vorgehensweise, entwickelte sich vor allem im Zweiten Weltkrieg, als die Nazis begannen, Städte zu bombardieren und die Alliierten mit entsprechenden Mitteln antworteten. Der Höhepunkt dieser Entwicklung war der Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Das Abwerfen von Bomben aus 5000 Meter Höhe und das Abfeuern einer Rakete fällt manchem leichter, als das Schlachten eines Huhnes oder eines Kaninchens. Der Soldat drückt auf einen Knopf und beobachtet den Einschlag auf dem Bildschirm wie bei einem Computerspiel.
Ende 2001 berichtete die Washington Post von einem Wendepunkt in der Militärgeschichte. Erstmals werde im Afghanistankrieg von den Amerikanern eine ferngelenkte, unbemannte aber bewaffnete Aufklärungdrohne erprobt. Dieses Fluggerät war mit einer Hellfire-Rakete bestückt worden, die zur Bekämpfung von Panzern geeignet ist. Die amerikanischen Militärplaner wollen in einem künftigen Krieg den noch moderneren unbemannten Aufklärer »Global Hawk« bewaffnen und einsetzen. Dieser hat eine Reichweite von 25 000 Kilometern und kann 40 Stunden in der Luft bleiben. Der mit neuesten Digitalkameras, Infrarot- und Radargeräten ausgestattete Global Hawk fliegt viel höher als alle bisherigen Aufklärungsflugzeuge. Er ist daher schwerer zu bekämpfen und kann ein größeres Gebiet überwachen. In einigen Jahren sollen auch unbemannte Kampfflugzeuge einsatzbereit sein. Weil sie deutlich kleiner sind, können sie billiger gebaut werden. Die Flugzeugkonstrukteure müssen dabei auch auf die körperlichen Belastungsgrenzen der Piloten keine Rücksicht mehr nehmen.
Mittlerweile werden für den Kampf am Boden auch Roboter entwickelt. Ihre Vorzüge wurden im Januar 2002 in der Zeitung Die Welt gepriesen: Sie haben keinen Hunger. Sie werden nicht müde. Sie haben keine Angst. Sie haben keine Zweifel. Sie empfinden keine Schmerzen. Sie bekommen kein Heimweh. Sie kennen keine Liebe und keinen Hass. So sollen sie sein, die perfekten Krieger. In dem Artikel wurde weiterhin berichtet, dass die US-Armee Forschungsprogramme für »Unmanned Ground Vehicles«, unbemannte Bodenfahrzeuge, ins Leben gerufen hat. Die ersten tatsächlich hergestellten Bodenroboter der US-Armee wurden für die Minensuche und Minenräumung konstruiert. Sie sind handtaschengroß und können von Soldaten in feindlichen Städten ausgesetzt werden, um Tunnels und Abwasserkanäle auf biologische und chemische Kampfstoffe zu untersuchen. Darüber hinaus werden Miniroboter kreiert, die mit Wärmesensoren und Sprengstoff ausgestattet sind. Sie sollen im Gelände Soldaten aufspüren, sich an deren Körper heften und explodieren. Diese Miniroboter werden »Kampfkäfer« genannt. Sie würden für die amerikanische Armee damit ähnliche Aufgaben übernehmen wie die Selbstmordattentäter. In dem Bericht der Welt wird ein Experte zitiert, der den technischen Wahn relativiert: »Der Mensch als Krieger ist nicht ersetzbar.« Und es wird darauf hingewiesen, dass unbemannte Waffensysteme, die mit großem Abstand operieren, störanfällig sind.
Aber wenn wir bald unbemannte Flugzeuge und Maschinen als Soldaten haben, dann wäre es vielleicht angebracht, vor Kriegsbeginn die Zivilbevölkerung zu evakuieren und auch sie durch Roboter zu ersetzen.
Zu Beginn des Jahres 2002 hielt Militärminister Donald Rumsfeld vor den Studenten der Nationalen Verteidigungsakademie eine programmatische Rede. Er sprach von einer »Revolution des Kriegshandwerks«: Während im Golfkrieg zehn Prozent Präzisionswaffen mit Erfolg eingesetzt worden waren, steigerte es sich im Kosovokrieg auf 30 Prozent und in Afghanistan waren es schon bis zu 60 Prozent – mithin eine »deutliche Verbesserung«. Dort hätten sich Soldaten aus Sondereinheiten als Afghanen verkleidet, hinter den Stellungen der Taliban positioniert und die Zieldaten übermittelt. Etwa 20 Minuten nach der Zielerfassung werde bombardiert. Die Trefferquote sei sehr hoch. Man brauche daher zukünftig weniger Bomber und Stützpunkte. In den nächsten Jahren würden immer mehr unbemannte Flugzeuge eingesetzt. Im neuen Militärhaushalt sei genug Geld für Computernetze, Radaraufklärung, Hochgeschwindigkeitsraketen und Sonderkommandos bereitgestellt.
Die Militärtechnik schreitet unaufhaltsam voran. Und die Welt fällt immer weiter auseinander. Die reichen Länder schicken zukünftig unbemannte Tötungsmaschinen, die armen kämpfen mit Selbstmordattentätern gegen diese Übermacht. »Keine eigenen Toten«, das ist die Strategie der Supermacht, »eigene Tote« ist die verzweifelte Antwort der Ohnmächtigen.
Nicht nur Wut und Verzweiflung motivieren die Selbstmordattentäter, sondern vor allem der gerechte Lohn im Himmel. Wer die Gerechtigkeit auf Erden nicht findet, sucht sie im Paradies. Die Terroristen vom 11. September 2001 waren Selbstmordattentäter. Auch japanische Kamikazeflieger – Kamikaze heißt im Japanischen »göttlicher Wind« – stürzten sich gegen Ende des Zweiten Weltkriegs mit ihren mit Sprengstoff beladenen Flugzeugen auf Einheiten der amerikanischen Flotte. Die »Black Tigers« in Sri Lanka begehen im dortigen Bürgerkrieg Selbstmordattentate. Im Krieg zwischen Iran und Irak wurden tausende von Jugendlichen als Minensucher eingesetzt. Sie trugen einen Schlüssel um den Hals, der ihnen im Todesfall, so war es versprochen, die Pforten des Paradieses öffnen werde.Die Familien der jungen Männer, die ihr Leben opfern, bekommen Geld und können anschließend ein besseres Leben führen. Die palästinensische Islamistenbewegung Hamas diskutierte über die Zulässigkeit solcher Selbstmordattentate, denn Selbstmord ist nach der Lehre des Islam verboten. Doch es wurde ein Ausweg gefunden: Die Attentäter verübten keinen gewöhnlichen Selbstmord, vielmehr begingen sie ein Gott wohlgefälliges Werk. Denn das Ziel sei die Befreiung der heiligen Stätten von der Herrschaft der Ungläubigen. Entsprechend geben die Palästinenser zu verstehen: Wir sind unterdrückt und haben keine Möglichkeit, uns zu befreien, es sei denn durch die Selbstaufopferung unserer mutigsten jungen Leute. Gegen unsere Selbstmordkommandos hat der Feind keine Waffen.
Besondere Formen hatte die Anwerbung von Selbstmordattentätern in Afghanistan angenommen. Man versprach den jungen Männern für ihren Opfertod himmlische Liebe. Auf jeden von ihnen warteten 72 Mädchen, die sich immer wieder in Jungfrauen zurückverwandeln. In pakistanischen Koranschulen, Medressen genannt, wurden Nachwuchskräfte für die Gotteskrieger der Taliban ausgebildet. Dabei wird – wie in Palästina – die Not armer Eltern ausgenutzt. Die Koranschulen bieten Essen und Kleidung. Wenn ein Junge in den Krieg zieht, erhalten die Eltern monatlich 100 Dollar. Wenn er den Märtyrertod stirbt, gibt es etwa 3000 Dollar zusätzlich. Soziales Elend führt zu Krieg und Terror.
15 der 19 Terroristen des 11. September kamen nach offizieller Lesart aus Saudi-Arabien. Und das Geld, das sie brauchten, wurde aus den Arabischen Emiraten überwiesen. Im Testament Mohammed Attas stehen drei aufschlussreiche Sätze: »Weder schwangere Frauen noch unreine Personen sollen von mir Abschied nehmen … Frauen sollen weder bei der Beerdigung zugegen sein noch irgendwann später sich an meinem Grab einfinden … Derjenige, der meinen Körper rund um meine Genitalien wäscht, soll Handschuhe tragen, damit ich dort nicht berührt werde. Das Vermögen, das ich zurücklasse, soll nach den Regeln der islamischen Religion aufgeteilt werden, so wie der allmächtige Gott es uns aufgetragen hat: ein Drittel für die Armen und Bedürftigen.«
Die Verpflichtung zur sozialen Gerechtigkeit ist ein immanenter Bestandteil der islamischen Lehre. Wenn nach den Ursachen des Terrors in der Welt gefragt wird, dann sind die westlichen Freizügigkeiten, insbesondere bei den Frauen, die eigene unterdrückte Sexualität und das Empfinden für soziale Gerechtigkeit Beweggründe, die junge Männer dazu bringen, Gewalttaten zu begehen. Manche Kommentatoren sahen auch in der Sucht nach Ruhm ein Motiv. Für sie waren Mohammed Atta und seine Kumpane Widergänger des Herostrat. Dieser Grieche hatte im Jahre 356 v. Chr. den Tempel der Diana in Ephesus in Brand gesteckt. Der Tempel war eines der Sieben Weltwunder. Die Parallele zu den Twin-Towers des World Trade Centers ist augenfällig. Herostrat war zu allem bereit, auch zum Sterben, um die Unsterblichkeit Alexanders des Großen zu überbieten. Je größer die Zerstörung, umso größer der Ruhm.
Die Geschichtsbücher sind voll von Männern, die aus Geltungssucht Kriege anzettelten, in denen viele Millionen Menschen umkamen. Auch die Staatenlenker der Demokratien gefallen sich, wie wir immer wieder erleben, in der Rolle des Kriegsherrn. Wenn der Krieg beginnt, gehen ihre Umfragewerte steil nach oben, bis die Ernüchterung einsetzt.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.