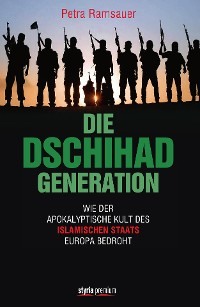Kitabı oku: «Die Dschihad Generation», sayfa 3
DAS RISIKO DER EINSAMEN WÖLFE
Es überlebte kein Attentäter dieses Tages, außer Amedy Coulibalys Komplizin und Freundin Hayat Boumeddiene. Es gelang ihr, zu entkommen und in Syrien beim IS Unterschlupf zu finden. In einem Interview für das Magazin Dabiq, das die Gruppe online auf Englisch verbreitet, schilderte sie eine bezeichnende Anekdote: „Amedy verbot mir, ihm Videos vom Leben im Islamischen Staat zu zeigen. Sonst hätte er es vor Sehnsucht nicht mehr ausgehalten, und anstatt die Tat in Paris auszuüben, wäre er einfach losgefahren.“
Es ist ein Satz, der viel aussagt. Bei Weitem nicht alle IS-Fans reisen in „ihren Staat“, vor allem nicht jene, die planen, in ihrer eigentlichen Heimat aktiv zu werden.
So schreibt „Abu Muhadjar“, ein Brite, in einer E-Mail aus der IS-Hochburg Raqqa: „Es gab viele Gründe, warum ich mein Leben, wie ich es kannte, verlassen habe. Vorrangig waren es religiöse Motive. Es ist die Pflicht eines jeden Muslims, das Land von Muslimen zu verteidigen, wenn es angegriffen wird. Und der zweitwichtigste Grund war es, helfen zu wollen: Ich kämpfe nicht nur, sondern kümmere mich auch um die Zivilbevölkerung.“ Ein anderer, er nennt sich „Abu Islam“, schreibt: „Großbritannien ist mein Zuhause. Dort bin ich geboren. Wenn ich geplant hätte, dort als Gotteskrieger zu kämpfen, dann hätte ich ja nicht nach Syrien fahren müssen. Es kommt mir ein wenig surreal vor, dass jemand glaubt, ich werde von hier zurückkehren und Terrorist werden. Ich verstehe natürlich die Sorge der Sicherheitsbeamten. Aber es wäre nötig, nicht alle über denselben Kamm zu scheren. Es gibt große Unterschiede.“
Es wäre freilich ein Fehler, Dschihadisten, die zurückkommen, einen Persilschein auszustellen, wie das Attentat in Belgien im Mai 2014 beweist. Wichtig ist es aber, jene nicht aus den Augen zu verlieren, die in Europa bleiben. Nicht die Rückkehrer, so Experte Peter Neumann, würden die größte Bedrohung darstellen, „sondern sich frei herumtreibende Fans, die im Westen leben und eben nicht ausreisen.“29 Wie viele es sind, wagt niemand zu schätzen.
Sicher ist allerdings, dass sie bestens organisiert sind. So wurde etwa am 19. März 2015 über den Twitter-Account @Shahadastories ein elektronisch abrufbares Buch mit dem Titel „How to Survive in the West: A Mujahid Guide“ beworben. Frei übersetzt bedeutet das: „Ein Leitfaden, um als Gotteskrieger im Westen zu überleben“. Es ist Teil einer Serie, die vor allem praktische Tipps gibt, um „den Dschihad zu Hause zu führen“, wie es heißt. Ein Kapitel widmet sich etwa der Frage, wie man „seine extremistische Identität verbergen kann, um nicht aufzufallen“. Es wird abgeraten, sich einen Bart wachsen zu lassen oder ähnliche Veränderungen im Lifestyle sichtbar zu machen, um nicht auf eine Terrorliste zu geraten: Das Beste sei, sich so freundlich und offen wie möglich zu geben. Es helfe auch, sich einen Spitznamen zuzulegen, der möglichst westlich klingt. Dazu finden sich Abschnitte, die erläutern, wie man eine Bombe baut, unauffällig Waffen transportiert, seine Internetkommunikation sicher gestaltet. Die Strategie scheint aufzugehen. „Die Anschläge in Paris haben uns die schmerzhafte Realität vor Augen geführt, dass es angesichts der Größenordnung des Problems für die Behörden derzeit außerordentlich schwierig ist, potenziell gefährliche Personen zu identifizieren“, so Europol-Chef Rob Wainwright.30
Die Entwicklung nach den fürchterlichen Morden vom Jänner 2015 bestätigt dies: Nur eine Woche nach dem Terroralarm in Brüssel, als die Polizei die Zelle vor den Anschlägen ausheben wollte, starben in Verviers dreizehn Menschen. In der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2015 eröffnete ein junger Däne mit palästinensischen Wurzeln das Feuer auf eine Synagoge und die Teilnehmer einer Diskussionsveranstaltung über das Recht auf freie Meinungsäußerung, an der auch ein schwedischer Cartoonist teilnahm. Fünf Polizisten wurden dabei verletzt, zwei Männer und der Attentäter starben.
Mehr als sechzig verübte oder versuchte Anschläge des globalen IS-Netzwerks wurden zwischen Juni 2014 und Juni 2015 in Europa, Nordamerika und Australien gezählt. Viele scheiterten, was darauf schließen lässt, dass die „freischaffenden“ Einzeltäter glücklicherweise meist äußerst amateurhaft vorgehen. Gleichzeitig geht es nicht darum, mit einzelnen, spektakulären Anschlägen Aufmerksamkeit zu schaffen, sondern eine kontinuierlich bestehende Drohkulisse zu inszenieren. Laut einer Analyse des „Spanischen Instituts für Strategische Studien“ (IEEE),31 das zum Verteidigungsministeriums gehört, stellen „sogenannte ‚einsame Wölfe‘ die größte Bedrohung für Europa dar. Das sind Aktivisten, die heimlich den Treueeid gegenüber al-Baghdadi leisten, sie agieren, ohne sich mit irgendjemandem abzusprechen. Es ist die Hölle, wenn man versuchen möchte, solche Personen zu stoppen“, heißt es in dem Bericht. „Terroristen sind heute nicht mehr darauf angewiesen, mit den Führern ihrer Bewegung per E-Mail oder Telefon direkt in Kontakt zu treten, um zu wissen, wann und was sie genau zu tun haben. Ob Codes, Angriffsziele oder Timing: Sie bekommen ihre Befehle übers Netz.“ Als Beispiel wird ein Video erwähnt, das vom IS im Juli 2014 verbreitet wurde und die Befreiung „Andalusiens“ propagiert und dazu anregt, es als Provinz ins Kalifat einzugliedern. Es wird dabei Bezug auf den historischen Begriff „al-Andaluz“ genommen: jenes Gebiet im Süden Spaniens, das ab dem 8. Jahrhundert von den Mauren gehalten und 1492 von den „katholischen Königen“ erobert wurde. Ein Dschihadist, der Spanisch spricht, verkündet in dieser Aufnahme: „Ich gebe diese Warnung der ganzen Welt. Wir kämpfen unter der Islamischen Flagge und wir wollen alle Länder der Muslime, die von Ungläubigen besetzt sind, zurückerobern. Von Jakarta bis Andalusien. Spanien ist das Land unserer Vorfahren und mit der Macht Allahs holen wir es zurück.“
Harleen Gambhir vom „Institute for the Study of War“ (ISW) erkennt darin eine klare Strategie der IS-Führung. Um die Macht zu konsolidieren, werde auf drei Taktiken gesetzt. Erstens: Der militärische Konflikt rund um das Kalifat wird laufend angestachelt. Zweiter Pfeiler der Strategie sei es, Dschihadistengruppen weltweit einzugliedern. Ein wesentlicher Stützpfeiler der Strategie sei das dritte Element, im Westen „einsame Wölfe“ für Anschläge zu motivieren. Gambhir: „Das alles folgt dem Ziel, einen globalen apokalyptischen Krieg zu starten.“32
Wann immer der IS in seiner Hochburg an Terrain verlor, wurde dieser dritte Pfeiler im Kampf wichtig. Im März 2015 starben 21 Menschen bei einem Anschlag auf das tunesische Nationalmuseum, zu dem sich die Gruppe bekannte. Damals war die Terrormiliz in ihren Hochburgen in Syrien und im Irak massiv unter Druck geraten. So auch Mitte Juni 2015, kurz bevor am 26. des Monats eine Anschlagswelle in Frankreich, Kuwait und Tunesien Tote forderte. „Die Feinde Allahs sind direkt vor euren Augen. Greift sie an, wo immer in der Welt ihr sie finden möget!“ Mit diesen Worten wandte sich IS-Sprecher Abu Mohammed al-Adnani nur wenige Tage später per Audiobotschaft an die Fangemeinde. Wenige Tage später enthauptete der 35-jährige französische Lastwagenfahrer Yassin Salhi seinen Chef, setzte das Betriebsgelände in Brand und schickte ein „Selfie“ von sich und dem Kopf des Toten zu seinen Freunden, die in Syrien im IS kämpften. Am selben Tag griff ein IS-Sympathisant aus Saudi-Arabien eine schiitische Moschee in Kuwait an und Seifeddine Rezgui Touristen am Strand von Sousse in Tunesien. Ob es je einen direkten Kontakt zwischen der IS-Führung und diesen Terroristen gegeben hat, ist unklar. Klar ist, dass dieser gar nicht nötig war. Der „Dschihad 3.0“ läuft wie von Zauberhand gesteuert.
Diese Strategie ist zentral für den IS. Bereits während der ersten Tage nach der Gründung des Kalifats war dies spürbar. Über das Internet lief eine Kampagne namens „Eine Milliarde Muslime zur Unterstützung des islamischen Staates“ an. Weltweit wurden Fans der Gruppe aktiv, hielten Zettel mit diesen Worten vor Sehenswürdigkeiten. In Wien war es das Riesenrad. Jemand namens „Abu Umar“ fotografierte es und stellte es ins Netzwerk Twitter. Sechzehn Mal wurde es binnen weniger Stunden weitergeleitet, dreizehn Mal wurde es „favorisiert“. Als Heimatland gibt „Abu Umar“ in seinem Profil „das Diesseits“ an.33
Und auch in Österreich zeigten erste Verhaftungen, dass Möchtegern-Dschihadisten quasi im Fernstudium die „IS-Internetakademie“ nutzen. So plante ein Vierzehnjähriger, den Wiener Westbahnhof zu sprengen. Seit acht Jahren lebte der Bub da schon in Österreich, auf die Welt kam er in Istanbul. Nach der Scheidung seiner Eltern wuchs er ohne Vater auf und besuchte die Sonderschule, stritt sich ständig mit der Mutter. Im Internet fand er in der Propaganda des IS eine Gegenwelt. Er plante, nach Syrien auszureisen, suchte Kontaktpersonen in Wien. Diese redeten ihm die Reise aus. Er könne doch auch in Österreich für den Heiligen Krieg nützlich sein, wurde ihm gesagt. Also recherchierte er online, wie man eine Bombe baut, und suchte nach Plänen des Wiener Westbahnhofs als mögliches Anschlagsziel.34
Sind Personen wie er, die mit der Anklage konfrontiert sind, Teil einer terroristischen Gruppe zu sein, vor Gericht und auch im Gefängnis am richtigen Ort aufgehoben? In diesem Fall wurde lediglich eine bedingte Strafe ausgesprochen. Dies mag auch damit zu tun haben, dass fast alle Attentäter, die zuletzt in Europa zuschlugen, nicht eine Reise nach Syrien gemeinsam haben, sondern allesamt erst im Gefängnis ihre Radikalisierung erlebten. Deshalb ist diesem Problem ein beträchtlicher Abschnitt in diesem Buch gewidmet. Zuvor gilt es aber, die Spurensuche des Phänomens IS aufzunehmen. Was sind „Dschihadismus“ und „Salafismus“, welche Bedeutung hat die Ideologie und wie konnte sie sich in eine bedrohliche Jugendbewegung verwandeln? Vor allem: Wie ticken diese Jugendlichen, wie funktioniert ihre PR-Abteilung, die Gehirnwäsche, wie werden sie rekrutiert, wie grausam gehen sie vor und wie gefährlich ist die „Dschihadmania“ für uns?
2.
„MAMA, ICH BIN IN SYRIEN!“
DIE PSYCHOTRICKS DES IS-KULTS, SEINE IDEOLOGIE UND WIE DIE REKRUTIERUNG DER FANGEMEINDE LÄUFT
Ein paar Tage nach seiner Ankunft in Syrien sei ihm blitzartig klar geworden, worauf er sich eingelassen habe: „Wollt ihr mich in den Tod schicken?“, will Oliver entsetzt seine Mitstreiter gefragt haben. Eine Woche im Trainingscamp für Neuankömmlinge hatte der minderjährige Möchtegern-Dschihadist da gerade hinter sich gebracht, ein paar Lektionen Islamkunde intus, nun sollte er kämpfen: im Irak, wo die Anti-IS-Koalition eben einen Luftkrieg gegen die Stellungen der Terrormiliz begonnen hatte. „Ich wurde nie im Umgang mit Waffen ausgebildet, “ sagt der Wiener Teenager, der sich nur drei Monate nach seinem Übertritt zum Islam der Terrormiliz des IS angeschlossen hatte und ins Kalifat auswanderte.
Drei Wochen blieb er damals im Irak, versteckt in einem Haus, aus Angst vor den Raketen, bevor er wieder in die Hauptstadt des Kalifats, nach Raqqa, verlegt wurde. Es sei alles „ein Irrtum, eine große Enttäuschung gewesen“, beteuert er, als er nach seiner Rückkehr nach Österreich vor Gericht gestellt wird. In Wien habe man ihm ganz andere Perspektiven in Aussicht gestellt, wenn er, der frisch gebackene Muslim, „dem Ruf seiner Religion folge“. Es hieß, „ich könnte dort auch gut leben, ohne kämpfen zu müssen. Ich verstand darunter, dass ich eine Frau, Geld und ein Haus bekommen werde.“ Zu diesem Zeitpunkt war Oliver sechzehn.
Von August 2014 bis März 2015 lebte der Teenager im sogenannten „Islamischen Staat“. Schwer verletzt und scheinbar reumütig kehrte er zurück, stellte sich der Polizei und erzählte seine Version des Alltags in der Zentrale der Gotteskrieger. Er hätte zwar immer ein automatisches Gewehr mit dreißig Schuss Munition bei sich gehabt, sagte er bei seiner ersten Einvernahme durch die Polizei: „Das hatten dort alle“, aber er habe es nie benutzt, außer zur Selbstdarstellung auf Facebook und in anderen Internetforen. Im Krieg will er nur drei Tage lang gewesen sein, und dies als Rettungsfahrer: „Ich bin mit einem Hummer, einem Jeep, bis zur Front bei Kobane gefahren und habe die Toten und Verletzten geborgen.“ Verletzt wurde er bei einem Raketenangriff auf die Stadt Raqqa. „Nur mit Glück habe ich überlebt.“ Pech hatte Firas, ein anderer Österreicher, der auch ins Kalifat auswanderte und mittlerweile tot ist. Mit ihm teilte sich Oliver über Monate eine Wohnung. Er identifizierte die Leiche von Firas, trug bei seiner Rückkehr dessen Kleider.
Nun will er als Hauptbelastungszeuge gegen die zentralen Figuren der deutschen Fraktion der Terrormiliz auftreten, denn in Syrien hatte er es mit der mutmaßlichen Europa-Elite des IS zu tun: dem Österreicher Mohammed Mahmoud und dessen Freund, dem Ex-Rapper Denis Cuspert. Dazu könnte er den ebenso naiven Fans der Bewegung einen dringend nötigen Realitycheck verpassen. Dem Kalifen nachzureisen brachte Oliver herzlich wenig. Mit siebzehn hat er eine zerfetzte Milz, nur noch eine Niere, einen schwer lädierten Lungenflügel und einen Schuldspruch wegen Mitgliedschaft bei einer Terrorvereinigung samt einer Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Haft. Helden sehen anders aus als das Häufchen Elend mit dem blonden Kurzhaarschnitt.
Vieles in seiner Biografie weist Parallelen zu jener anderer IS-Sympathisanten auf: Als Oliver vier war, trennten sich seine Eltern, seine Mutter war mit der Erziehung ihrer vier Kinder überfordert, immer wieder landete er in Krisenzentren der Sozialwohlfahrt, in Heimen. Aus Sicht der Gerichtspsychiaterin Gabriele Wörgötter führte dies zu massiven Entwicklungsstörungen seiner Persönlichkeit. „Er ist entwurzelt, nicht zu Empathie fähig, es fehlten ihm Zuneigung und Anerkennung“, heißt es in ihrem Gutachten. Sie nähme ein psychopathisches Muster wahr, wie sie dann vor Gericht erläuterte, sowie „Narzissmus und Entwurzelung. Die Ohnmacht, die dies in ihm hinterlassen hatte, versuchte er mit Gewalt gegen andere zu kompensieren. Deshalb hat er die Ideologie dieser radikal-islamistischen Gruppierung so rasch verinnerlicht. Sie rechtfertigte diese Gewalt, die bis zur Tötung anderer geht.“
Zum Zeitpunkt seiner Ausreise nach Syrien war dem Jugendamt die Vormundschaft des Minderjährigen übertragen. Der Lehrling bei einem Versicherungsunternehmen hatte eine eigene Wohnung, ging auf Partys, traf Freundinnen, trank Alkohol und spielte gerne „Ego-Shooter“. Wenige Monate bevor er am Flughafen Wien-Schwechat mit einem Dschihadisten-Kollegen in ein Flugzeug Richtung Türkei stieg, war sein Leben erneut aus den Fugen geraten. Er hatte seinen Job verloren und sich in die Idee verrannt, bei den IS-Sympathisanten eine Heimat zu finden.
Auf dem Papier war er römisch-katholisch – bis zum Mai 2014: „Da bin ich zum Islam konvertiert.“ Yassin, ein Bekannter mit türkischem Background, habe ihn dazu überredet. Im Internet suchte er dann nach Informationen über seine neue Religion und fand dort Aussagen wie, dass die „Hidschra“ Pflicht eines jeden Muslims sei. Der Begriff bezieht sich eigentlich auf die Flucht des Propheten Mohammed im Jahr 622 von Mekka nach Medina und markiert den Beginn der islamischen Zeitrechnung. Mit diesem Wort bezeichnen radikale Muslime heute aber auch die Verpflichtung zur Ausreise in den „Islamischen Staat“.
Oliver besuchte mehrere Gebetshäuser, bis er in der Omar al-Faruq Moschee in Wien-Favoriten auf einen Prediger stieß, der die Texte so interpretierte, wie Oliver es im Internet gelesen hatte. Er lernte dort auch eine afghanische Familie kennen, der er sich anschloss und mit der er viel Zeit verbrachte. Wie die Menschen hießen, die mittlerweile alle im Gebiet des IS leben, daran will er sich nicht mehr erinnern können, aber sehr wohl an die Sätze, die sie ihm eintrichterten: „Sie sagten, wer als Muslim nicht kämpfen geht, versündigt sich.“ Am meisten, ergänzt er, hätten ihn die Söhne – zwischen neunzehn und 25 Jahre alt – beeinflusst. „Ich habe sie dann später auch in Raqqa getroffen.“
Oliver hätte sich ab diesem Sommer 2014 fünf Mal am Tag die Füße zu waschen und zu beten begonnen, berichteten die besorgten Arbeitgeber dem Jugendamt. Dies war kurz vor seiner Entlassung. Unternommen wurde nichts, im Gegenteil: Ihm wurde sein Pass ausgehändigt, weil er behauptete, er müsse einem Freund ein Buch ins Gefängnis bringen. Ob er noch aufzuhalten gewesen wäre? Die Abreise am 24. August 2014 war bereits sein dritter Versuch. „Ich war damals stark im Glauben“, erzählt Oliver, „verbrachte auch die Nächte zum Gebet in der Moschee, hatte starke Schuldgefühle, weil ich nicht kämpfte. Damals tauchten einige Deutsche mit türkischen Wurzeln in der Moschee auf, die mich dann gefragt haben, ob ich nicht mitkommen möchte. Sie haben dann meine Reise in die Wege geleitet.“ Ein Mann sei plötzlich da gewesen, ein Deutscher, den er „Organisator“ nennt. Dieser hätte den Rest an Vorbereitung übernommen und ihm und seinem deutschen Reisegefährten einen Umschlag mit 1500 Euro in die Hand gedrückt.
Über Istanbul ging es in die türkische Stadt Gaziantep und dann illegal nach Syrien, in den IS. Aus Oliver wurde „Abu Muktail al Almani“, der ab diesem Zeitpunkt in sozialen Medien seine neue Existenz zelebrierte. „Ich warte nur auf das Treffen mit unserem Herrn. Und wenn es sein Wille ist, werde ich Shahid (Märtyrer)“, postete er etwa am 4. Oktober 2014 auf Facebook. „Man kann schwer in den Dschihad ziehen und nur Tee trinken wollen“, kommentiert er solche Fotos heute. Er habe eben kein Feigling sein wollen.
Später wirkte er in einem Propagandavideo des IS mit. Darin fordert er „seine Brüder im Glauben auf, die Kuffar (Ungläubigen) wie die Schafe zu schlachten“. Dazu meint er jetzt abwiegelnd: „Ein Dschihadist aus Bielefeld wollte anlässlich eines islamischen Feiertags ein Schaf schächten. In dem Schlachthaus sind dann fünf andere samt Kamera aufgetaucht, die mich aufforderten, mitzumachen.“ Hätte er es nicht getan, wäre er ausgepeitscht worden.
Egal ob er seine Taten tatsächlich zutiefst bedauert oder sich als Kronzeuge anbietet, um eine möglichst geringe Strafe zu bekommen. An einer echten Reue zweifelt die Psychiaterin, die ihn im Auftrag des Gerichts untersuchte. „Es wird Jahre dauern, bis er wirklich begreift, was geschehen ist. Der Grund seiner Abreise war aus meiner Sicht, dass er so schwer verletzt wurde. Die Verletzungen, die anderen von der Gruppe zugefügt wurden, haben ihn nicht berührt.“
Doch trotz der Bedenken der Psychiaterin helfen Aussteiger wie Oliver, den IS zu entzaubern und die Radikalisierung zu bremsen. Dies betont etwa Nazir Afzal, der schon zitierte ehemalige britische Staatsanwalt:35 „Die Botschaft gegen den IS wäre wesentlich kraftvoller, wenn sie von ehemaligen Fans käme.“ Die aktuellen Kampagnen zur Deradikalisierung würden wenig bringen, meint Afzal: „Ich weiß aus Erfahrung, dass dies meist darauf basiert, dass die Polizei endlose Sitzungen mit den immer gleichen Vertretern der islamischen Gemeinschaft hält.“ Um das Phänomen zu stoppen, müsste man Augenzeugen erzählen lassen: nicht bloß über die grauenhafte Realität im IS, sondern auch darüber, wie sie in den Bann der Bewegung gezogen wurden. „Die Rekrutierenden nutzen dabei ähnliche Methoden wie Kinderschänder, die ihre Opfer anlocken. Sie manipulieren sie, distanzieren sie von Freunden und Familie.“ Und so erfahren die meisten Verwandten erst im Nachhinein, dass ihr verschwundenes Kind als Jünger des Kalifats auftaucht. Etwa durch einen Anruf mit den Worten: „Mama, ich bin in Syrien!“
WIE DIE „RECRUITER“ ARBEITEN
„Der erste Schritt besteht darin, ihn ganz aus seiner Umgebung zu lösen. Versuche entweder einen neuen Freundeskreis für deinen Schützling zu finden oder beanspruche so viel von seiner Zeit, dass er nicht mehr dazu kommt, jemand anderen zu sehen.“ Dieses Zitat stammt aus dem „Handbuch von der Kunst des perfekten Rekrutierens“, veröffentlicht 2009 von der „Al-Kaida-im-Irak“, der Mutterorganisation des IS.36 Diese Fibel dürfte noch immer Drehbuch für die Anwerbung von IS-Dschihadisten rund um den Globus sein. Es ist frappierend, wie sehr sich etwa Olivers Geschichte mit den Leitlinien dieses Handbuchs überschneidet. Die afghanische Familie, von deren großen Einfluss er berichtet, agierte exakt, wie dieser Leitfaden vorgibt: „Der Recruiter muss in allen Gesprächen sehr genau zuhören, wann immer es geht, sich empathisch an den Glücksmomenten und den Problemen beteiligen. Ziel ist es, sie immer näher an sich zu binden.“
Was an dem Dokument so überrascht, ist seine Präzision. Schablonen für Evaluierungstabellen nehmen hier den größten Platz ein; ein Punktesystem macht die Eignung der Kandidaten bei jedem Schritt der Anwerbung objektivierbar. Drei Wochen soll, so ist es vorgesehen, die Phase des Kennenlernens dauern, in der konkrete Themen tunlichst vermieden werden sollten: so etwa der Dschihad, die Kriege, die gegen Muslime geführt werden, auch Politik ist am Anfang tabu. „Der Rekrut darf nicht misstrauisch werden.“ Wichtig sei es jetzt, eine tiefe Vertrauensbasis aufzubauen. Erst wenn diese stabil ist, beginnt Phase zwei, die Einführung in die Pflicht zum Heiligen Krieg, dem Dschihad, in die Qualität eines Gotteskriegers. 24 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche wird der Schützling nun von seinem Anwerber überwacht.
Abschließend folgt die Phase der „Erweckung“, die mindestens sechzig Tage in Anspruch nimmt. Der „Catcher“, wie Sicherheitskräfte solche Rekrutierer auch bezeichnen, konzentriert sich jetzt auf die Schilderungen der „Schönheit des Paradieses für Gotteskrieger“, aber auch auf die Lehren über Höllenqualen, die jenen, die sich von der „wahren Religion“ abwenden, drohen. „Geh mit ihm auf den Friedhof, um darüber zu reden“, so ein Tipp aus dem Handbuch. Oder: „Sprich mit ihm häufig über die aktuellen Gräueltaten gegen Muslime. Besonders der Gaza-Konflikt würde sich dazu eignen, da er in allen muslimischen Kreisen unumstritten ist.“
Zuletzt folgt der „Abschlusstest“, der sich wie ein Fragebogen zur Berufseignung liest. Hier geht es um Fragen wie: „Hat er den blinden Gehorsam internalisiert?“, „Nimmt er regelmäßig am empfohlenen Nachtgebet teil?“ Der Proband hat das Curriculum bestanden, wenn er es sich nicht bloß wünscht, Dschihadist zu werden, sondern wenn er es richtig will. Und wenn er oder sie ein anderer beziehungsweise eine andere geworden ist: Ein maßgebliches Symbol ist dabei die Namensänderung. „Abu-irgendwas“ oder – im Falle von Frauen – „Umm-so-undso“. „Kuna“ heißen diese Kampfnamen. Sie signalisieren, dass die alte Identität wie mit einer Delete-Taste gelöscht worden ist.
Es scheint, als wäre basierend auf diesem Handbuch ein weltweites Rekrutierungssystem aufgebaut worden. In Stein gemeißelt ist es freilich nicht. So wie nichts, was den IS betrifft, der sich laufend adaptiert, um seine Effizienz zu erhöhen, auch im Bereich der Anwerbung. Seit 2014 nahm die Zahl der Anschläge von Einzeltätern gegen westliche Ziele im Namen des IS dramatisch zu, gleichzeitig stiegen die Ausreisen von jungen Gefolgsleuten der Miliz – Männern wie Frauen – signifikant. Ab diesem Moment hatten die Anwerber eine Trumpfkarte in der Hand. Das „Kalifat“ war wiedererrichtet worden und die Auswanderung aus den Ländern der „Ungläubigen“, die „Hidschra“, in ein nach islamischen Gesetzen regiertes Land gilt in Extremistenkreisen als Pflicht. Wie stark der Magnetismus eines „Islamischen Staates“ sein kann, entdeckte der italienische Experte für islamistischen Extremismus, Lorenzo Videno, wie er im Gespräch für dieses Buch berichtet, bereits ein Jahrzehnt vor dem Entstehen des IS während einer Forschungsarbeit im Auftrag der kanadischen Regierung. Dazu analysierte er die Protokolle von Internetchats junger extremistischer Muslime in Kanada. „Zu den Themen, die am häufigsten diskutiert wurden, zählte die Pflicht, in ein Land auszuwandern, wo islamisches Recht gilt. Doch die jungen Diskutanten fanden keine Lösung. Kein Land schien geeignet. Immer wieder kreisten sie ratlos um die Frage: Wir müssten auswandern, nur wohin?“
Dies hat sich nun geändert: Die PR-Agenten des IS werben nicht mehr bloß für irgendeine neue Terrorgruppe, sondern sie sind in offizieller Mission des Kalifats unterwegs, eines „Islamischen Staates“, wie ihn sich Extremisten vorstellen. Dieser „Unique Selling Point“ unterscheidet den „Dschihadismus à la IS“ massiv von sämtlichen vorigen Bewegungen. Die „Catcher“ agieren aber nicht nur als Botschafter, sondern auch als Avantgarde eines „Pop-Dschihadismus“. Sie treten als fromme Muslime auf, die sich nahtlos in das Milieu ihrer „Beute“ fügen. Sie infiltrieren verarmte Viertel europäischer Städte, wo die Erfolglosen, die Sinnsuchenden abhängen: wo sie unter sich sind, in Jugendtreffs, Dönerbuden und Shisha-Bars. „Wenn sie chillen, ist es der beste Moment, um sie zu catchen“, beschrieben ehemalige Rekrutierer ihre Arbeit in einem Interview für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel:37 Sie verglichen die jungen Männer mit aufladbaren Batterien, die sie erst entladen, um sie dann neu aufzuladen. Das Leben auf Erden wird als eine Art Computerspiel vermittelt, in dem man Punkte für das Jenseits sammeln kann, etwa indem man in den Heiligen Krieg zieht.
So sind selbst im Zeitalter des „Dschihad 3.0“ Kontakte im echten Leben wichtiger, als viele denken. Der wichtigste Radikalisierungsfaktor der ausgereisten Dschihadisten waren Freunde, in knapp einem Drittel der Fälle hatten sie maßgeblichen Einfluss, hieß es schon Anfang 2014 in einem Bericht deutscher Terrorexperten. Konkreter wurde im Juni 2015 der Berliner Verfassungsschutz in einer Analyse der Biografien von ausgereisten Dschihadisten: „Die in Sicherheitskreisen manchmal zu hörende Theorie, die Radikalisierung verläuft mehr und mehr über das Internet, trifft auf die Berliner Szene nicht zu. Die Mehrheit der sechzig von uns untersuchten Kämpfer hat Kontakte zu dem Verfassungsschutz bekannten Moscheen und anderen von Islamisten genutzten Trefforten unterhalten.“38
Gleichzeitig ist unbestritten: Die PR im Internet ist nicht minder maßgeblich. So warnen Experten des österreichischen Bundesamts für Verfassungsschutz davor, dass Techniken benutzt werden, die jenen gleichen, die Firmen anwenden, um mehr über die Kundschaft zu erfahren oder sie direkt anzuwerben. Stöbert jemand auf einer Dschihadisten-Website, werden Informationen über den Benutzer recherchiert. Passt das Profil ins Bild, wird direkt Kontakt aufgenommen.39 Meist dürfte es sich im fortgeschrittenen Radikalisierungsprozess also um einen Mix handeln: Die meisten IS-Sympathisanten geraten in die Zange aus Online- und Offlinegehirnwäsche.