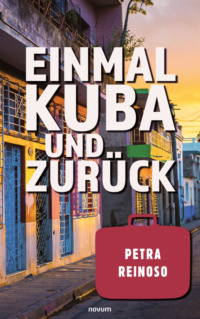Kitabı oku: «Einmal Kuba und zurück», sayfa 3
Der Zeitpunkt der endgültigen Rückreise von Raul rückte immer näher. Seine Zeit in der DDR war abgelaufen und eine Verlängerung gab es nicht mehr und war im Grunde genommen auch nicht mehr nötig. Dennoch war uns klar, dass er wohl vor mir nach Kuba fliegen würde. Wir beschlossen auch, alles, was wir besaßen, mit nach Kuba zu nehmen. So bestellten wir einen Container, der einen Monat vor Rauls Abreise zu packen war, damit er noch verschifft werden konnte, denn schließlich hatte er einen langen Weg auf dem Ozean vor sich und sollte wenigstens ungefähr zeitgleich mit uns in Kuba sein. Wir organisierten das alles so, dass sobald unsere Einrichtung im Container verstaut war, meine Freundin Sonja, die auch mit einem Kubaner zusammen war, in unsere Wohnung zog. Sie wollte ohnehin aus ihrer feuchten Wohnung raus und da es auf legalem Wege Jahre dauerte, bis jemand in der DDR eine Wohnung bekam, nahm ich sie als Untermieterin zu mir und wenn ich dann nach Kuba ginge, würde der Mietvertrag auf sie umgeschrieben. Das war zwar nicht legal, aber erfüllte den Zweck für uns alle, denn auch zu befürchten hatte sie dadurch später nichts. Auf die Straße konnte man sie schließlich nicht so einfach setzen. Ihr Freund war schon einige Monate wieder in Kuba, nur hatten sie es nicht geschafft, bei all dem Papierkrieg vorher zu heiraten. Sie versuchten es jedoch im Nachhinein, was sich sehr schwierig gestaltete.
Es war eine sehr anstrengende Zeit, denn Raul forderte auch dann noch immer sein Recht als Ehemann und als sich bei mir immer noch keine Tür auftat und er nun bald zurückmusste, ließ er seinen Zorn wie immer an mir aus. Nun war es so weit, an einem Sommertag im August brachte ich Raul nach Berlin zum Flughafen. In diesem Moment spürte ich eine nicht enden wollende Traurigkeit. Plötzlich war es so weit, er musste weg und Raulito und ich mussten zurückbleiben im Ungewissen. Unser Zuhause schwamm in einem Container auf dem Ozean und keiner von uns wusste, wann wir uns wiedersehen würden. Ich wollte nun auch so schnell wie möglich weg und wäre am liebsten gleich mitgeflogen. Raulito war inzwischen vier Jahre alt. Für ihn war sein Papa jetzt mal schnell weg und ich sagte ihm, dass wir ihn bald wiedersehen würden. Raul hatte ihm seine Heimat immer im schönsten Licht beschrieben. „Raulito, Kuba ist ein schönes Land. Dort ist es immer warm, die Sonne scheint den ganzen Tag, du kannst im Meer baden und immer draußen spielen, deine Großeltern und deine Cousins und Cousinen freuen sich auch schon auf dich.“ Er erzählte ihm dies alles und Raulito freute sich so sehr darauf. Ich war froh darüber, denn das machte ihn glücklich und wenn ich auch nicht wusste, in was für eine ungewisse Zeit ich ging, so wusste ich doch, dass das, was Raul ihm erzählte, die Wahrheit war. Denn so viel hatte ich inzwischen von der Kinderliebe der Kubaner mitbekommen. Daran gab es keinen Zweifel. Das Flugzeug hob ab und nun war Raul weg. Ich steuerte nur noch auf unsere Ausreise hin. Es vergingen Monate und mit Sonja konnte ich sehr gut zusammenleben. Wir halfen uns, wo wir konnten, und verbrachten viel Zeit zusammen, sogar Weihnachten machten wir uns ein schönes gemütliches Fest mit allem, was dazugehört. Leider blieb es mir nicht erspart, meinen kleinen Sohn und mich noch mal mit Wintersachen einzukleiden. Dass es nun doch noch so lange dauern würde und auch noch einen Winter, damit hatten wir nicht gerechnet. Unsere Möbel waren auch inzwischen auf Kuba eingetroffen und bei seinen Eltern verstaut. Maria besuchte ich jetzt auch wieder regelmäßig und ab und zu meine Eltern. Es war stark spürbar, dass die Tage gezählt waren, an denen wir uns noch sehen konnten. Sie wollten mich zwar allesamt dazu überreden, die Ausreise zurückzuziehen, aber sie schafften es nicht. Ich war nun fest entschlossen, ich wollte mit Raulito zu Raul und seiner Familie nach Kuba. Alle meine Vorstellungen über dieses Land, in dem unsere Beziehung sich endlich erholt, sollten doch wahr werden. Das war es doch, was mich die ganzen Jahre zu Raul hat halten lassen. Obwohl auch mich immer wieder, wenn ich bei Maria war, eine Wehmut überkam, denn die Vorstellung ganz weit weg zu sein, war auch mir manchmal etwas zu viel. Dieses absolut Endgültige war mir zu diesem Zeitpunkt nicht ganz bewusst. Denn niemand wusste, ob ich jemals als Republikfeind zurückkommen könnte, denn die erzwungene Einbürgerung meines Vaters war auf einmal wieder gegenwärtig.
Raul und ich schrieben uns regelmäßig Briefe, sodass wir fast jede Woche voneinander Post bekamen. In seinen Briefen fiel nie ein böses Wort und er verging fast vor Sehnsucht nach uns. Es beschlich ihn auch die Angst, dass wir vielleicht doch nicht mehr kommen würden. Dennoch konnte ich ihm nicht meinen Missmut über unsere Ausreise zum Ausdruck bringen, denn die Briefe wurden gelesen und wenn ich etwas Negatives über die DDR geschrieben hätte, dann hätte Raul meine Briefe nie bekommen. An einem Tag im Februar war es endlich so weit. Ich bekam einen Brief, der mich aufforderte, auf dem Amt zu erscheinen. Endlich bekam ich unsere lang ersehnte Ausreisegenehmigung. Innerhalb von 14 Tagen hatte ich die DDR zu verlassen. Verglichen mit anderen Ausreisenden hatte ich eher noch viel Zeit, denn es gab Leute, die in 24 Stunden weg sein mussten. Aber trotzdem waren auch die 14 Tage nicht viel bei der weiten Reise, da ich noch nach Berlin auf die kubanische Botschaft musste, um das Einreisevisum für uns zu bekommen, was nicht ohne Termin ging, und die Flüge mussten auch noch gebucht werden. Nach dieser langen Zeit des Wartens waren diese zwei Wochen für mich die traurigste Zeit. Die Zeit des Abschiedes, denn unsere Tickets waren One-Way-Tickets.
Ich musste Raul ein Telegramm schicken in der Hoffnung, dass er es auch erhält, denn für einen Brief, der vier Wochen unterwegs war, hätte die Zeit nicht mehr gereicht. Raulito war überglücklich mit der Freude, bald seinen Papa wiederzusehen. Überall erzählte er: „Wir gehen nach Kuba zu meinem Papa.“ Es war so schön, ihn so glücklich zu sehen, aber ich wusste dennoch, dass er sich sicher nicht vorstellen konnte, wie weit wir weggingen. Unser Gepäck musste ich so zusammenstellen, dass wir die 40 kg nicht überschritten. In der Zwischenzeit hatte sich aber schon wieder so viel an Kleidung angesammelt, dass ich einiges zurücklassen musste. Es war der 22. Februar 1986, der Tag, an dem wir abflogen. Bei meinen Eltern hatte ich mich am Abend zuvor verabschiedet. Meine Mutter war so traurig, dass sie fasst kein Wort herausbrachte. Sie wusste, es gab an dieser Entscheidung nichts mehr zu ändern. Das schien sie fasst ohnmächtig werden zu lassen. In ihren Augen las ich: Eine Mutter bleibt immer die Mutter und ich werde immer ihr Kind bleiben, ganz egal was auch passiert war. Sie tat mir so unendlich leid, sie konnte sich meinem Vater nie widersetzen und nun, wo ich für immer wegging, hoffte ich, dass meine Schwester sich ihrer annahm. Sie sagte: „Wann geht euer Zug morgen früh nach Berlin zum Flughafen?“ „Wir müssen den Zug um acht nehmen, da wir sonst den Flieger am Nachmittag nicht schaffen, wenn wir einen Zug später fahren würden.“ „Lebwohl mein Kind und schreibe bitte sofort, wenn ihr angekommen seid!“ Mein Vater behielt die ganze Zeit die Fassung, er verabschiedete sich von uns, wünschte uns alles Gute und gab mir 50 Deutsche Mark. „Man weiß ja nie was passiert und mit dem Geld kannst du überall bezahlen.“ Am nächsten Morgen begleiteten mich meine Schwester, ihr Sohn Max und Sonja. Ich war so froh, dass sie sich die Mühe machten, uns bis nach Berlin zu bringen, denn schließlich mussten sie ja dann auch noch anschließend zwei Stunden Rückfahrt in Kauf nehmen. So selten wie es bei uns in Leipzig schneite, schneite es ausgerechnet an diesem 22. Februar unentwegt. Es war sehr kalt und wir fuhren alle zusammen schon um sieben Uhr auf den Leipziger Hauptbahnhof. Es war das reinste Caos. Die Züge standen alle auf den Gleisen, die nicht in unseren Tickets angegeben waren. Sicher waren überall die Weichen gefroren und man musste wieder mal improvisieren. Wir rannten zu fünft durch den Bahnhof und suchten unseren Zug. Die Kinder mussten wir auf den Arm nehmen, dazu kam noch mein Gepäck, zwei Koffer, eine Reisetasche, ein Rucksack und die Gitarre von Raulito. Niemand war in der Nähe, den man hätte fragen können – und obwohl wir noch Zeit gehabt hätten, wussten wir intuitiv, dass wir uns beeilen mussten. Irgendetwas trieb uns, da wir uns denken konnten, dass die Deutsche Bahn die Fahrpläne überraschend geändert hatte. Auf die Kälte und den Schnee waren sie nicht vorbereitet und selbst wenn, standen dagegen kaum Mittel zur Verfügung. Also hieß es rennen und irgendwie zusammenbleiben. Endlich fanden wir einen Zug, der unserer zu sein schien. Die Schaffnerin stand schon davor, hielt ihre Kelle nach oben und pfiff. In diesem Moment erst erkannte ich den Ernst der Lage und wusste, wenn der Zug weg war, dann auch unser Flugzeug und damit unser letztes Geld, das ich für die Tickets ausgegeben habe. Ich schrie und schrie und schrie: „Haaaaaaalt, stoppen Sie den Zug, sie müssen den Zug stoppen, wir müssen unbedingt mit“! Die Schaffnerin war so erschrocken, dass sie nun nur noch in ihre Pfeife pfiff, die ihr um den Hals hing. Wie sah das wohl aus, drei Erwachsenen beladen mit Gepäck und zwei davon mit einem Kind auf dem Arm, schreiend und rennend auf dem Leipziger Hauptbahnhof. Der Zug stoppte ruckartig, die Schaffnerin riss die Tür auf. „Beeilt euch, das ist heute der letzte Zug, der nach Berlin geht.“ Diese elenden hohen Treppen in einem Zug, die einem das Einsteigen so schwer machen und das Gefühl hinterließen, dass man daneben tritt. Ich stieg als Letzte ein, aber während dem Einsteigen von Sonja und meiner Schwester hielt ich die ganze Zeit an ihrer Hand, das gab mir das Gefühl, dass ich da auch noch rein muss. Wir standen nun im Zug und flogen erst mal über mein Gepäck, die Schaffnerin rannte neben dem Zug her und schrie: „Schließen Sie die Tür, um Himmels willen schließen Sie die Tür.“ Obwohl der Zug nur langsam anfuhr, schaffte sie es nicht, von außen die Tür zu schließen, und ich wusste mit meinen 22 Jahren nicht mal, wie man eine Tür im Zug zumachte. Plötzlich glaubte ich, nicht richtig zu sehen, meine Eltern rannten neben dem Zug her. Sie hatten nun die Zugtür erreicht, die immer noch offen stand, und ich streckte meine Hand zu meiner Mutter. Für mich ein unendlich langer Augenblick des nicht Loslassens. „Mein Kind, mein Kind, geh nicht weg!“ Sie weinte, ich weinte. Ich schrie: „Mutti lass mich los, der Zug wird schneller, lass mich los.“ Sie ließ einfach meine Hand nicht los und mein Vater rannte die ganze Zeit hinter ihr und mit ihm die Schaffnerin, die wiederum schrie: „Türen schließen!“ Maria zog mich von hinten zurück und schloss endlich mit ihrer ganzen Kraft die Tür. Was für ein Drama, was für ein trauriger Abschied. Meine Eltern waren tatsächlich noch mal zum Bahnhof gekommen. In diesem Moment verzieh ich ihnen alles und erkannte, dass es ihnen wirklich wehtat, dass ich für immer ging. In der Zwischenzeit hatten sich genug Leute im Zug zu einer Menschentraube gebildet, die das ganze Schauspiel beobachteten. Ich konnte nun meine Tränen nicht mehr zurückhalten und schluchzte nur noch. Zum Glück war unseren Kindern nichts passiert, denn ich fragte mich, wo sie die ganze Zeit waren. Gar nicht auszudenken, was hätte passieren können. Die Fahrt verlief länger als geplant, immer wieder waren die Weichen vereist. Wir waren dann gegen Mittag am Flughafen Berlin Schönefeld. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich auf einem Flughafen und ich fand es sehr spannend. Die vielen Menschen verschiedener Nationalitäten, das war so aufregend und interessant für mich. Wir erfuhren nun, dass mein Flug drei Stunden Verspätung haben würde. Dreißig Minuten später hieß es, dass wir vor 20 Uhr nicht fliegen können, denn es schneite ununterbrochen. Maria entschied sich, nun doch zurückzufahren, da sie noch einen langen Weg vor sich hatte und auch nicht wusste, was für eine lange Rückreise nun noch vor ihr lag. Sonja war ebenfalls dieser Meinung und uns war allen klar, dass es wohl das Beste war. Wir verabschiedeten uns alle unter Tränen, Maria gab mir ihren Ring und ich gab ihr meinen. „Damit du immer an mich denkst, mein Schwesterchen.“ Das war wirklich eine gute Idee von ihr. Raulito und Max gaben sich ein Küsschen und wir winkten ihnen so lange zu, bis nichts mehr von ihnen zu sehen war. Ich blieb mit Raulito allein zurück und da stand ich nun mit meinem ganzen Gepäck, das ich mit meinen zwei Händen gar nicht tragen konnte. Ein Gepäckwagen war auch nirgends aufzutreiben, so blieb uns nichts anderes übrig, als uns auf die Bänke zu setzen und zu warten. Nach fünf Minuten dann die Durchsage. Vor morgen früh ging kein einziger Flug mehr, alle Passagiere sollten sich im Flughafenrestaurant einfinden, wo sie mit einem kleinen Imbiss versorgt werden. Ich starte die ganze Zeit den Ring von Maria an und dachte nur, zum Glück waren sie gegangen, und hoffte, dass sie noch einen Zug erwischten, der heute noch zurück nach Leipzig fährt. Aber was sollte ich jetzt hier die ganze Nacht machen und hoffentlich würden Raul so lange auf uns in Havanna warten. Es war eine nicht enden wollende Nacht. Wir versuchten, auf den Bänken zu schlafen. Raulito lag auf meinem Schoß und ich hatte ständig mit einem Auge unser Gepäck im Visier. Schlafen konnten wir nicht recht, da ich auch Angst hatte, den Flug vielleicht noch zu verpassen. Früh um vier Uhr hörten wir endlich die lang ersehnte Durchsage. Es ging endlich los. Wir hatten nun 22 Stunden Verspätung, als das Flugzeug abhob. Müde waren wir nicht, da wir beide viel zu aufgeregt waren, denn es war unser erster Flug im Leben. Im Flugzeug selbst ging es ziemlich laut zu, da eine ganze Gruppe Kubaner mit uns flog. Schnell war auch hier Raulito wieder der Mittelpunkt und fast jeder von ihnen kam zu uns an den Platz, um mit ihm zu spielen oder rumzualbern. Alle interessierten sich für unsere Geschichte, wieso wir nach Kuba auswanderten. Fernando, ein Kubaner, der direkt vor uns saß, war besonders hingerissen von Raulito und von seinen blauen Augen. Er alberte die ganze Zeit mit ihm und sang ihm kubanische Kinderlieder vor. Es war einfach so unterhaltsam, das mit anzusehen und anzuhören. In Kanada hatten wir Zwischenlandung und auch hier schien die Warterei wieder kein Ende zu nehmen. Wir mussten noch einmal drei Stunden bis zum Weiterflug warten, da sich eine Deutsche aus der DDR abgesetzt hatte und den Weiterflug verweigerte. Auf kanadischem Boden war sie frei und plante so anscheinend ihre Ausreise in die BRD. Zwar auf Umwegen, aber wenigstens ohne Repressalien, die mit einer Ausreise aus der DDR zusammenhingen. Nun endlich waren auch diese drei Stunden überstanden und wir konnten endlich unserem Ziel entgegenfliegen.
Kapitel 3
Zum Anflug unserer Landung gerieten alle Kubaner an Bord ins Schwärmen. Sie freuten sich alle auf ihre Heimat. Die Sicht war so klar, dass man das Land mit den Palmen und den Feldern gut sehen konnte. Als wir ausstiegen, war es sehr heiß, etwa 30 Grad und natürlich hatten wir viel zu viel an. Nachdem wir unser Gepäck hatten, gingen wir hinaus. Fernando wich uns nicht mehr von der Seite und half uns, wo er konnte. So schön und hilfreich das auch war von ihm, aber mich überkam schon wieder dieses Gefühl der Angst, wenn mein Mann das sehen würde, wie sollte ich ihm denn so schnell erklären, wer Fernando war. Ich konnte jedoch seine Hilfe nicht ablehnen, hatten wir doch so einen angenehmen Flug mit ihm, so konnte ich ihn jetzt unmöglich einfach ignorieren. Alle Kubaner wurden von ihren Familien empfangen und es herrschten ein enormer Lärm um uns herum. Meine Blicke suchten nach Raul, aber ich konnte ihn nirgendwo sehen. Raulito und ich standen da voll bepackt und rührten uns nicht von der Stelle in der Hoffnung, dass Raul uns in diesem Durcheinander sah. Nach einer halben Stunde leerte sich die Halle etwas und wir gingen hinaus. Fernando stellte uns seiner Familie vor. Wo war nur mein Mann, ich glaubte es nicht, wir standen hier in einem fremden Land, die Sprache verstanden wir nicht und niemand war da, der uns abholte. Ich fühlte mich so elend, diese Hitze, die Sonne, die uns enorm blendete, diese stickige Luft, meine Haare hingen wie Schnittlauch an mir herunter. Wir hatten Jeans an und trugen Turnschuhe und einen langärmligen Pullover. Diese verdammten Hosen, die keinen Luftzug an meine Haut ließen, machten mich fast verrückt. Raulito klammerte sich mit einer Hand an mich und mit der anderen hielt er seine kleine grüne Maus, ein Stofftierchen, fest. Um uns herum nur Kubaner, alles war so fremd und ich bekam Angst. Wir waren nun schon über 48 Stunden unterwegs und ich hatte fast nichts gegessen und überhaupt nicht geschlafen. Jetzt spürte ich meine Erschöpfung. Fernando verabschiedete sich von uns. „Ich muss nun gehen, meine Familie wartet auf mich, was willst du machen? Ist dein Mann noch nicht da?“ „Nein er ist nicht da.“ Mir schossen die Tränen in die Augen und ich sagte. „Ich nehme ein Taxi.“ „Aber weißt du denn überhaupt, wohin du musst? „Ja, die Adresse habe ich, ich muss nach Santa Clara.“ „Aber das sind über 300 Kilometer. Das wird schwer, ein Taxi zu finden, das euch so weit fährt und das ist auch nicht ganz ungefährlich.“ „Kannst du uns nicht noch schnell ein Taxi organisieren. Die Familie meines Mannes wird das dann schon bezahlen.“ In Gedanken erinnerte ich mich an die 50 Deutsche Mark von meinem Vater. Notfalls zahle ich mit denen. Fernando redete mit einem älteren Mann und kam dann wieder zu uns zurück. „Ich habe euch ein Taxi organisiert. Der Mann dort wird euch nach Santa Clara fahren. Ich habe ihm gesagt, dass er auf euch aufpassen soll und euch heil zu deiner Familie bringt.“ Nun war der Flughafen endgültig leer und nur noch mein kleiner Sohn und ich und unser Gepäck standen verloren in der heißen Sonne herum. Der Taxifahrer kam auf uns zu, lud unser Gepäck ein und wir nahmen auf dem Rücksitz wortlos und verschüchtert Platz. Er machte jedoch wirklich einen soliden Eindruck. Das Taxi war ein uralter, rotweißer, amerikanischer Schlitten. Nicht gerade vertrauenerweckend aber was soll’s. Die Vordersitze waren eine durchgehende Lederbank, was ich noch nie gesehen hatte und es war unsagbar heiß und laut in diesem Auto. Unser Taxifahrer hatte alle Anweisungen von Fernando bekommen und von mir bekam er nur wortlos meinen Kofferanhänger, auf welchem mein Name und die Adresse von meinem Mann in Santa Clara standen, damit er auch wusste, wo er uns hinfahren sollte. Ich selber machte mir kein Bild von der Strecke, die vor uns lag. Was waren schon 300 Kilometer, das hatten wir doch in drei Stunden hinter uns gebracht. So zumindest bei deutschen Straßenverhältnissen und Autobahnen. Nach ungefähr zehn Minuten hielt unser Taxifahrer vor einem großen, alten Haus mit Vorgarten an. Er stieg aus und sagte etwas auf Spanisch zu mir. Ich verstand kein Wort, aber er machte eine Geste mit der Hand, was wahrscheinlich zu bedeuten hatte, dass wir einen Moment warten und im Auto sitzen bleiben sollen. Ich ließ ihn nicht aus den Augen. Er ging auf den Hauseingang zu, wo auch schon eine Frau auf ihn wartete. Sie diskutierten hektisch, was ja bei den Kubanern normal ist und mir kam es wie eine Ewigkeit vor. Plötzlich gingen beide ins Haus und ich sah nichts mehr von ihnen. In meinem Kopf schwirrten mir die Gedanken chaotisch durcheinander. Er würde uns doch wohl nicht hier einfach so sitzen lassen. Ich wusste nur, dass ich das Taxi vor Santa Clara nicht mehr verlassen würde. Er musste zurückkommen, schließlich war es sein wertvolles Auto, auch wenn wir jetzt darinsaßen. Was hatte das nur zu bedeuten, wäre doch nur Fernando noch dagewesen. Nach einer Weile kehrte er zurück, seine Frau stand am Hauseingang und verabschiedete sich von ihm. Endlich kam er zurück. Er stieg ein, sagte etwas, was ich wieder nicht verstand, aber es hatte was Beruhigendes. Sicher hat er nur seiner Familie Bescheid gesagt, dass er länger unterwegs war, da er anscheinend wusste, wie lange diese 300 Kilometer auf kubanischen Straßen dauern würden. In seiner Hand hielt er etwas Essbares, es sah aus wie eine kleine Boulette, er bot es uns an, aber ich nahm nichts. Dann bot er uns aus einer verbeulten Aluminiumkanne Wasser an und ich lehnte wieder mit einer Handbewegung ab. Raulito nahm einen Schluck und das war auch gut so, dass er etwas trank. Nicht dass ich Bedenken hatte, er würde uns etwas unterjubeln, aber ich war wie versteinert und so stark auf alles um uns herum konzentriert, dass ich mich durch nichts ablenken lassen wollte. Wir fuhren nun los und schaukelten erst einmal fast eine Stunde durch Havanna mit einem kurzen Stopp zum Tanken. Bei dieser Hitze waren die Fenster im Taxi alle geöffnet. So blieben mir auch der Fahrtwind und der Lärm von draußen nicht erspart. Aber das war jetzt auch schon egal. Raulito lag zusammengerollt mit dem Kopf auf meinem Schoß und schlief. Er sah so friedlich aus, aber auch erschöpft. Seine Haare klebten förmlich auf seinem kleinen Kopf. Ich schaute die ganze Zeit nach vorne zu unserem Taxifahrer. Wo waren wir hier nur, diese Straßen – fuhren die denn nie auf eine Autobahn. Wo war nur mein Mann, warum war mein Mann nicht zum Flughafen gekommen? Was war passiert? Wieso hatte er uns da alleine stehen lassen? Er wusste doch, dass wir hier völlig fremd waren. Hatte ich ihn vielleicht doch übersehen? Um Himmels willen alles, nur das nicht. Ich wusste es nicht. All diese Gedanken ließen mich nicht mehr los. Kaum, dass wir zehn Minuten auf einer Autobahn fuhren, verließen wir diese auch schon wieder. Nicht weil wir abbiegen mussten, sondern sie hörte eben einfach so auf und die Fahrt ging weiter auf Asphaltstraßen mit riesengroßen Löchern und auf Straßen die nur feste Erde waren. Links und rechts sah ich die wirklich schöne Landschaft mit wunderschönen, großen Palmen und hier und da eine kleine Holzhütte. Ich dachte, was für niedliche, kleine Gartenlauben die Kubaner doch haben. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass dies ihre Wohnhäuser waren. Allmählich fing es an zu dämmern und schnell wurde es dunkel. Ich sah nun nichts mehr, denn es gab keine Straßenbeleuchtung. Lediglich die Scheinwerfer vom Taxi erhellten dem Fahrer die Straße. Es kam uns auch die ganze Strecke über kein einziges Auto entgegen. Diese Dunkelheit und wir waren immer noch nicht da. Ich konnte kein Auge zu machen, ich blieb wach. Santa Clara hatten wir schon vor einer Weile hinter uns gelassen und hier waren wir in Camajuani, ein kleines Dorf. Es war bereits früh morgens vier Uhr, als das Taxi in einer etwas breiteren Straße aus blanker Erde vor einem kleinen Haus anhielt. Er stieg aus und ich bekam irgendwie nicht mit, warum. Ich sah, wie er an der Tür klopfte und etwas rief, lauter und immer lauter. Plötzlich kam ein alter Mann, verschlafen, auf dem Kopf einen Sombrero, aus dem Haus. Ich hörte, wie der Taxifahrer meinen Namen sagte und der alte Mann ihm antworte. Aus seinen Worten verstand ich nur „No, no“ und „Havanna“. Aha, wir waren da und ich sah, wie der Taxifahrer dem alten Mann immer wieder meinen Kofferanhänger zeigte. In der Zwischenzeit kamen noch einige Leute aus diesem und aus dem Nachbarhaus. Jetzt erst begriff ich, dass er nach mir fragte, da ja mein Name darauf stand. Ich stieg aus, das erste Mal, seit ich in Havanna eingestiegen war. „Ich bin Petra, das bin doch ich“ Aber niemand verstand mich, na ja aber nun sahen sie mich und ihnen war jetzt auch klar, dass Petra und Raulito aus der DDR da waren, nur ohne Raul. Alle waren hellwach, Rauls Bruder Ricardo war auch dabei und selbst ich hatte im ersten Moment gedacht, es wäre Raul, so eine verblüffende Ähnlichkeit bestand zwischen den beiden. Ich stand immer noch am Taxi und holte nun meinen kleinen allerliebsten Schatz aus dem Auto, der nun auch aufgewacht war. Ich bekam noch am Rande mit, wie Rauls Vater, welcher der alte Mann war, dem Taxifahrer etwas gab und ihn ins Haus brachte. Später erfuhr ich, dass er auch im Haus übernachtet hatte. Raulito rannte auf Ricardo zu und rief Papi, Papi. Es dauerte eine Weile, bis er merkte, dass es nicht sein Papi war. Das war einfach unglaublich. Alle stürmten jetzt auf uns ein, Laura, die Schwester von Raul, mit ihrer Familie, die im Nachbarhaus wohnte, Marisol und Teo, die Eltern von Raul, und überhäuften uns mit Fragen, die wir wieder nicht verstanden. Wir gingen ins Haus und ich sah, dass es sehr bescheiden war. Im Eingang befanden sich nur zwei uralte Schaukelstühle und ein Fernsehapparat. Plötzlich gingen wir alle nach nebenan in das Haus von Laura, ihrem Mann Leonardo und ihren zwei Kindern. Raulito und ich saßen zu zweit auf einem Schaukelstuhl. Er klammerte sich an mich fest und ließ mich nicht mehr los. Er war völlig verschreckt, so viele Leute, die so durcheinanderredeten und in einer Sprache, die wir nicht verstanden. Aber die ganze Familie lachte und war so lieb zu uns. Sie versuchten, herauszufinden, was passiert war, und wieso wir allein ohne Raul da waren. Mit einem Spielflugzeug, was Ricardo brachte, versuchte ich, es zu erklären. Ich begriff nur, dass sie mir damit sagen wollten, dass Raul in Havanna war und auf uns wartete. Aber das alles konnte mir nicht erklären, wieso er nicht am Flughafen war. Raulito weinte und erst als Ricardo ihm das Motorrad seines Vaters zeigte, das er aus der DDR mit nach Kuba verschifft hatte, beruhigte er sich wieder. Hier und da standen einige Dinge aus unserer Wohnung, sodass es ihm nun doch so langsam vertraut vorkam. Ich gab ihnen mit Händen und Füssen zu verstehen, dass ich nicht eher schlafen ginge, bis Raul da wäre. Ich konnte mir das nicht vorstellen, in so einer Fremde allein ins Bett zu gehen. Sie jedoch versuchten, mir klarzumachen, dass das noch Stunden dauern könnte, denn woher sollte Raul denn wissen, wo ich war. Er wäre extra ein paar Tage vorher zu seinem Bruder nach Havanna gefahren. Das wurde mir dann auch klar. Wir gingen dann gegen halb sechs alle schlafen. Raulito und ich wurden in ein kleines Zimmer geführt, wo gerade ein großes und ein kleines Bett Platz hatten.
Raul war inzwischen in Havanna auf dem Flughafen und als er fragte, ob denn nun die Maschine aus der DDR schon gelandet sei, sagte man ihm: „Ja schon vor 14 Stunden.“ Raul sagte: „Aber ich war doch hier und Sie sagten mir ich, könnte wieder nach Hause gehen. Das Flugzeug hat enorme Verspätung. Wo ist die deutsche Frau mit dem Kind, die mit diesem Flug gelandet ist?“ „Da war keine Deutsche dabei“, sagte die Frau vom Flughafenpersonal. „Natürlich da muss eine deutsche Frau mit einem Kind dabei gewesen sein, bitte überlegen Sie genau oder sehen Sie sich die Passagierlisten an.“ „Moment mal, es waren so viele Leute, ich frage meine Kollegin.“ Die Kollegin kam, „Ja, doch ich erinnere mich, es war eine Deutsche mit einem Kind dabei, sie stand bis zuletzt noch hier, als schon fast alle gegangen waren.“ „Wie sah sie aus?“ „Das weiß ich nicht mehr so genau, aber sie hatte bei ihrem Gepäck eine Gitarre und der Junge hatte ein grünes Stofftier in den Händen.“ „Das sind sie, ja das sind sie, aber wo sind sie jetzt? Wo um Himmels willen sind sie jetzt hin? Wenn ihnen was passiert ist!“ „Ich glaube, sie sind mit einem Taxi weggefahren.“ „Mit einem Taxi? Das ist doch nicht Ihr Ernst? Wissen Sie, was das bedeutet, wenn der Taxifahrer sie vielleicht unterwegs einfach rausgeschmissen hat oder ihnen sonst was angetan hat. Wie konnten Sie eine Fremde mit einem kleinen Kind einfach so mit einem Taxi wegfahren lassen.“ „Machen Sie sich keine Gedanken, hier verkehren nur uns bekannte Taxifahrer und so wie es aussah, wird er sie wohl direkt nach Hause gefahren haben.“ Raul war außer sich, aber er hatte keine andere Wahl, als auf dem schnellsten Weg nach Santa Clara, Camajuani zu fahren in der Hoffnung, dass ich und sein Sohn dort angekommen waren.
Ich konnte kaum schlafen und als es hell wurde, hörte ich immer mehr Stimmen, oe, wie viele Leute wohnten hier in diesem Haus? Ich hörte die Hähne krähen, das Dach lag nur auf dem Haus auf, sodass ich auch die Stimmen vom Hof und von der Straße hören konnte. Es war ungefähr neun Uhr. Ich traute mich nicht, aufzustehen. Wo war ich hier, ich spürte diese Endgültigkeit, die mich erstarren ließ. Ich konnte nicht mehr zurück, es gab kein Zurück mehr. Ich wünschte, ich hätte das alles nur geträumt, aber es war Wirklichkeit. Was hatte ich getan? Niemals zuvor war mir das so bewusst wie jetzt. Wir befanden uns so weit weg von unserer Heimat und mussten das jetzt irgendwie durchstehen. Ich lag da wie gelähmt, Raulito schlief noch. Ich hatte das Gefühl, unter Schock zu stehen. Noch immer wagte ich nicht, aufzustehen. Ich hörte die Familie in der Küche sprechen, denn es trennte uns nur ein Vorhang. Immer wieder merkte ich, wie jemand den Vorhang vorsichtig zur Seite schob, schnell schloss ich wieder die Augen und stellte mich schlafend. Mit einem Mal wurde es lauter, oh mein Gott diese Schockstarre. Auf einmal öffnete sich der andere Vorhang, welcher uns vom Flur trennte und Raul kam rein. Er war außer sich vor Freude und ließ sich direkt aufs Bett fallen und umarmte uns natürlich unter Beobachtung der ganzen Familie, die nun den Vorhang komplett zur Seite geschoben hatte. Ich fühlte eine enorme Erleichterung. Raulito war so glücklich, seinen Papa wiederzusehen. „Raulito mi Amor, gib deinem Papi einen Kuss. Petra, was ist passiert? Wieso hast du nicht auf mich gewartet am Flughafen?“ Nach dem ich ihm alles erklärt hatte, erfuhren wir, dass Raul schon zwei Tage vorher zu seinem Bruder nach Havanna gefahren war, um auch dann, wenn wir da waren, mit uns zwei Wochen bei ihm zu verbringen. Er erfuhr am Flughafen, dass das Flugzeug Verspätung hatte und ging deshalb zurück zu seinem Bruder. Nur hatte man ihm eine falsche Ankunftszeit genannt, sodass er dann erst kam, als das Flugzeug längst gelandet war. Endlich konnten wir aufstehen. Ich fühlte mich noch nicht so richtig wohl, aber wenigstens war Raul da er uns jetzt auch bei der Verständigung helfen konnte. Wir wurden nun von allen möglichen herbeigerufenen Familienmitgliedern begutachtet. Sie strahlten alle Glückseligkeit aus. Natürlich waren sie alle neugierig auf uns und sie überhäuften Raulito mit Küssen. Raulito und ich saßen in der ärmlichen Küche am Tisch. Marisol kochte uns Milch und Kaffee, während Raulito mich fragte, „Mama wann gehen wir wieder nach Hause?“ Ich war nicht fähig, ihm zu antworten. In dieser Küche standen nur ein Tisch mit zwei Stühlen, ein Kühlschrank und eine betonierte Ablagefläche mit einem eingelassenen Becken und auf der ein Eisengerüst mit zwei Flammen stand, was der Kochherd war. Dieser hatte seitlich einen Tank, der mit Petroleum gefüllt war. Das Haus war nicht sehr groß. Wir hatten ein Zimmer für uns zu dritt, wo nur unsere Betten darin Platz hatten, getrennt mit einem Vorhang zur Küche und zum Flur. Ein Zimmer war von Rauls Eltern und ein Salon für uns alle. Das Bad war nur ein betonierter Raum mit einem WC und einem Becken am Boden aus Beton. Einen Wasserhahn gab es nicht, zum Duschen mussten wir uns einen Trog mit Wasser in das Becken stellen, aus dem wir dann schöpften, uns abseiften und dann das Wasser über uns gossen, wenigstens hatte dieses Becken einen Abfluss. Unsere Möbel hatte Raul in einer Abstellkammer im Haus verstaut, benutzen konnten wir sie jedoch nicht. Unsere Ankunft hatte ein ziemliches Durcheinander verbreitet. Immer wieder kamen die Leute aus der Nachbarschaft, um uns zu begrüßen, und alle brachten uns sehr viel Herzlichkeit entgegen. Da Raul geplant hatte, mit uns nach unserer Ankunft in Havanna zu bleiben, machten wir uns auch am Abend auf diese beschwerliche Reise. Es war ein langer umständlicher Weg erst mal bis nach Santa Clara zur Busstation zu kommen. Ein Busbahnhof gefüllt mit Menschenmengen. Es war dunkel und laut. Wir mussten eine Nummer ziehen, um irgendwann mal mit einem Bus mitkommen zu können. Das könnte noch viele Stunden dauern. Es war sehr heiß und ich merkte nun, dass mir der Schlaf fehlte. Bis auf die paar Stunden am Morgen hatte ich schon über zwei Tage nicht geschlafen. Ich war so erschöpft, dass ich während des Laufes einschlief und immer wieder sackte ich zusammen und fiel einfach hin. Raul entschied nun, dass wir einen der teuren Reisebusse nehmen würden, und so kamen wir dann endlich nach Stunden von diesem Busbahnhof weg und fuhren nach Havanna. Am nächsten Morgen kamen wir an. Sein Bruder Armando lebte mit seiner Frau allein in einem, für kubanische Verhältnisse, schönen modernen Wohnblock. Sie waren sehr herzlich zu uns und versorgten uns mit wunderbaren, kubanischen Köstlichkeiten. Ich wusste da noch nicht, dass dies eine große Seltenheit war und Hunger in der Zukunft zu unserem Alltag gehören würde. Endlich konnte ich mich ausschlafen und nach 14 Stunden Schlaf konnte ich mich nicht mehr bewegen. Ich hatte höllische Rückenschmerzen und konnte alleine nicht aufstehen. Nach einigen Stunden gingen wir dann zum Arzt. Mein erster Arztbesuch auf Kuba. Die ärztliche Versorgung auf Kuba war sehr gut organisiert. Jeder wurde behandelt ohne Bezahlung. Das war eines des Erbes nach der kubanischen Revolution. Die Krankenstation war sehr bescheiden, aber dennoch sauber und ich bekam eine Spritze, die mich glücklicherweise wieder zum Leben erweckte. Nach den zwei Wochen fuhren wir wieder nach Camajuani zurück. Ich dachte, die Zeit wäre gezählt, die wir bei seinen Eltern wohnen würden, und freute mich, schon auch bald so eine schöne Wohnung wie Armando in Havanna zu haben. Wir mussten nun erst mal zur Immigration, um uns anzumelden. Wir fuhren nach Santa Clara, dieses Mal jedoch zu dritt auf dem Motorrad. Als wir eintraten, begrüßte uns ein kubanischer, uniformierter Mann mittleren Alters. Als ich meinen Stempel für den unbefristeten Aufenthalt auf Kuba in meinen Pass bekam, war noch alles in Ordnung. Plötzlich holte er einen kubanischen Pass hervor, der auf meinen Sohn ausgestellt war, und übergab ihn meinem Mann. Ich sagte mit meinen wenigen Spanischkenntnissen: „Das brauchen wir nicht, mein Sohn steht in meinem Pass und er ist deutscher Staatsbürger, er braucht keinen kubanischen Pass.“ „Ihr Sohn ist das Kind eines Kubaners und sobald er kubanischen Boden betritt, ist er kubanischer Staatsbürger und deshalb bekommt er seinen eigenen kubanischen Pass.“ „Nein, ich will diesen Pass nicht, behalten Sie ihn, mein Sohn ist Deutscher.“ Mein Mann sah mich ganz entsetzt an, denn ihm war es sichtlich peinlich und zu meinem Erstaunen zeigte sich seine Unterwürfigkeit gegenüber kubanischen Behörden. So musste ich aussehen, wenn ich bei seinen gewalttätigen Angriffen in Angst und Panik war. Ich hatte ihn so noch nie gesehen. Er wollte mich beruhigen, aber ich begriff nur zu gut, was das für mich für Folgen haben würde. Der Beamte sagte nun: „Nehmen Sie jetzt diesen Pass, denn ohne ihn wird er Kuba nicht mehr verlassen können, so wie alle anderen Kubaner.“ Ich erstarrte vor Entsetzen und fühlte, wie ich diesem Land ausgeliefert war, auch wenn ich Deutsche war und blieb, aber mein Sohn hatte mit einem Mal alle Rechte von Deutschland verloren, einfach so von einem kubanischen Beamten entschieden. Raul banalisierte das Ganze mir gegenüber und ich merkte, wie er wütend wurde, nur zu gut konnte ich mich noch an seine Wutausbrüche erinnern. Ich versuchte, diesen Pass zu ignorieren, und verbannte die daran geknüpften Umstände vorerst aus meinem Gedächtnis. In der nächsten Zeit fing für uns der kubanische Alltag an. Raulito lernte spielend schnell spanisch mit den anderen Kindern. Bei mir dauerte es etwas länger, aber ich konnte mich nun gut verständigen. Jedes Wort schaute ich in meinen schlauen Büchern nach, um auch die Schreibweise zu lernen. Raul ging jetzt wieder arbeiten und wir wohnten nun mit seinen Eltern zusammen. „Warum hast du es denn nicht geschafft in der ganzen Zeit, die du schon hier bist, für uns eine Wohnung zu suchen. Unser Hausrat steht hier aufeinander gestapelt herum, in Deutschland hatte ich vier Jahre eine eigene Wohnung und jetzt muss ich hier mit deinen Eltern zusammenwohnen“, warf ich ihm vor. „Was hast du nur, sei doch froh, dass du nicht den ganzen Tag alleine bist, es ist erst mal besser, bei meinen Eltern zu wohnen. Wir können uns dann immer noch was Eigenes suchen.“ Ich glaubte mich verhört zu haben. Er hatte mir in Deutschland noch was ganz anderes gesagt. „Aber ich möchte doch nur meinen eigenen Haushalt und endlich wieder selber kochen.“ „Es bleibt jetzt erst mal so, wie es ist.“ Ich merkte, dass er auf jedes weitere Wort nur noch gereizter wurde und so ließ ich dieses Thema fürs Erste ruhen. Meine Vorstellung von einer Wohnung wie sein Bruder Armando war gerade geplatzt wie eine Seifenblase. Ich war nun den ganzen Tag mit seinen Eltern zusammen. Sie waren lieb zu mir, aber mir fehlte mein eigenes Zuhause so sehr. Marisol kochte und ich putzte jeden Tag und nach zehn Minuten war das Haus wieder schmutzig. Sie schmiss alles auf den Boden, sie war es von ihrem Dorfleben nicht anders gewohnt. Ihr Haus damals hatte einen Fußboden aus festgetretener Erde. Ich schämte mich jedes Mal, wenn Besuch kam und das kam oft vor. Doch Raulito war sehr glücklich. Er spielte den ganzen Tag draußen mit seinen neuen kubanischen Freunden. Täglich kam Familie zu Besuch, bei den 12 Geschwistern meines Mannes konnte das auch noch ewig so weitergehen. Ich kannte nämlich immer noch nicht alle. An das fremde Essen hatte ich mich immer noch nicht gewöhnt, obwohl es gut schmeckte, wurde ich krank. Ich behielt einfach nichts im Magen. Es ging mir zwar gut, aber nach sechs Wochen dieser Torturen machte mein Körper schlapp und ich fiel einfach um und wurde bewusstlos. Jetzt wurde es Zeit, nach sechs Wochen endlich mal zum Arzt zu gehen, und allmählich wurde es besser. Das Wasser, das ich trank, war unrein und mein Körper hatte es nicht vertragen, bis ich dann irgendwann resistent wurde. Es war immer sehr, sehr heiß. Mittags konnte ich es schon nicht mehr aushalten und ich legte mich immer wieder in Abständen auf den kalten Fußboden. Nachts war es unerträglich, die Luft stand. Wir hatten nur selten Strom und noch seltener fließend Wasser. Jeder Tropfen Wasser wurde in Regentonnen aufgefangen, um Reserven zu haben für die Wäsche, zum Duschen und zum Kochen. Die Nächte waren grauenvoll, es wimmelte nur so von Ungeziefer, hauptsächlich Kakerlaken. Nachts kamen sie hervor und breiteten sich wie ein Teppich aus. Ich konnte sie regelrecht umherschleichen hören. Alle versuchten, mich zu beruhigen, aber ich konnte mich nicht an diese Kakerlaken gewöhnen. Es war schrecklich, sie waren riesig und einige konnten sogar fliegen. Wann auch immer ich meinen Schrank öffnete, jedes Mal krabbelten mir mehrere Kakerlaken entgegen. Ich hatte nun auch eine Phobie entwickelt und stand ganz allein mit diesem Problem da.