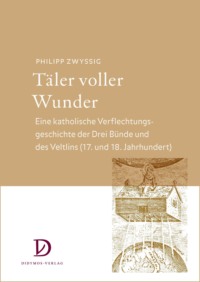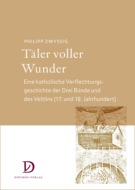Kitabı oku: «Täler voller Wunder», sayfa 13
2.3.3. Fazit: Verdichtete Kommunikationszusammenhänge
Bevor sich das nächste Kapitel konkreten Angelegenheiten zuwendet, die zwischen der päpstlichen Kurie und Akteuren im rätischen Alpenraum verhandelt wurden, gilt es hier zusammenfassend das »kommunikative Setting«510 zu beschreiben, in dem sich diese Angelegenheiten abspielten. Festzustellen ist erstens, dass die Kurienkongregation de Propaganda Fide bestrebt war, möglichst genau über die kirchlichen, religiösen, aber auch die politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten in den Drei Bünden und im Veltlin informiert zu sein. Dies hatte neben dem praktischen Nutzen, dadurch adäquate Beschlüsse für die rätische Mission fassen zu können, auch eine »symbolische Dimension«511, weil durch das zentrale Sammeln und Verwalten von Nachrichten aus der Peripherie der römische Suprematieanspruch bekräftigt werden konnte. Zweitens ist zu konstatieren, dass die Propagandakongregation hierfür auf parallel verlaufende, sich ergänzende Informationskanäle zurückgreifen konnte: Zum einen wurde sie zeitweilig von Einzelakteuren ohne expliziten Auftrag dazu mit Nachrichten aus dem rätischen Alpenraum versorgt, weil diese sich davon eine Hilfestellung vonseiten der römischen Kurie erhofften. Zum anderen waren Akteure wie der Nuntius in Luzern oder die Missionspräfekten in Brescia und Mailand aufgrund ihres Amtes verpflichtet, der Propagandakongregation periodisch Informationen über die Geschehnisse vor Ort zukommen zu lassen. Sie bedienten sich dabei entweder selbst eines Netzes an lokalen Informanten oder nahmen auf Visitationen persönlich einen Augenschein von den örtlichen Verhältnissen. In der Langzeitperspektive ist damit drittens eine Verstetigung der Informationsflüsse vom rätischen Alpenraum nach Rom und viertens eine Vervielfältigung der Kommunikationskanäle zu beobachten: Im Verlaufe des 17. Jahrhunderts trafen in Rom zusätzlich zu den sach- und situationsspezifischen Korrespondenzen regelmäßig Missions- oder Visitationsberichte ein, die detailliert das politische System und die geographischen Gegebenheiten ebenso wie die vorgefundene religiöse Kultur und Mentalität schilderten. Weil es der Propagandakongregation auch dank dieser Wissensbestände gelungen war, sich als maßgebende Instanz für lokale Angelegenheiten in Szene zusetzten, wurde sie in zunehmendem Maße auch von ortsansässigen Akteuren kontaktiert und mit (allerdings selektiven) Informationen versorgt. Im Zuge dieser kommunikativen Verdichtung etablierten sich schließlich stereotypische Sprechweisen über die kirchlich-religiöse Situation im rätischen Alpenraum. Dass das Veltlin und die Drei Bünde eine von den Konfessionen umkämpfte Grenzzone darstellten, wo es das Vordringen der protestantischen »Häresie« nach Italien zu stoppen galt, wurde zu einem eigentlichen Gemeinplatz im Briefverkehr mit Rom. Ebenso häufig wurde die Meinung geteilt, die lokalen Formen katholischer Kirchlichkeit seien »schismatisch«, die Glaubenspraxis der Katholiken »fehlerhaft« und ihre Glaubensvorstellungen »abergläubisch«. Wie wir sogleich sehen werden, verstetigten sich diese stereotypen Wahrnehmungen vor allem auch dadurch, dass die entsprechenden Sprechweisen von Akteuren in den Drei Bünden, etwa von Vertretern des Churer Hochstifts oder von einzelnen Pfarrgemeinden, übernommen wurden, weil sie sich dadurch Unterstützung von der römischen Kurie versprachen.
2.4. Segen und Fluch der Verflechtung: Neue Handlungsspielräume, neue Konflikte
Die intensivierte Verflechtung zwischen dem rätischen Alpenraum und dem katholischen Süden wirkte sich direkt auf Kirche und Gesellschaft in den katholischen Tälern aus. Zunächst ist festzustellen, dass sich die seelsorgerische Betreuung infolge der in Rom und Mailand ausgebildeten Kleriker einerseits, aufgrund der rätischen Kapuzinermission andererseits merklich veränderte und eine Qualität annahm, die sich den vom Konzil von Trient vorgegebenen Idealen annäherte.512 Damit verbunden war ein sich auch ostentativ bemerkbar machender Aufschwung des kirchlich-religiösen Lebens: Mit italienischen Almosengeldern wurden Kirchen gebaut und ausgestattet, aus Rom wurden Ablässe, Reliquien und andere Devotionalien herbeigeschafft und religiöse Laienvereinigungen wurden da und dort an römische Erzbruderschaften und Oratorien angegliedert.513 Zweitens, und dieser Aspekt soll im Folgenden besonders interessieren, trat mit der Kurienkongregation de Propaganda Fide ein neuer Akteur auf den Plan, dessen Entscheide sich unmittelbar auf die kirchlich-religiösen Verhältnisse im rätischen Alpenraum auswirken konnten. Die Verhandlungen über kirchliche Geschäfte lokalspezifischen Inhalts liefen nun auf mehreren Ebenen ab: auf der Stufe der Gemeinden, des Bistums, der Ordensprovinzen und schließlich auch auf derjenigen der päpstlichen Kurie. Dieses für die politische Kultur der Frühen Neuzeit typische »Mehrebenenspiel«514 eröffnete lokalen Akteuren neue Handlungsspielräume, sofern sie es verstanden, die unterschiedlichen Entscheidungsebenen gegeneinander auszuspielen und ihre Anliegen mit den Interessen der einen oder anderen Instanz zu verknüpfen. Besonders gut lassen sich diese Mechanismen bei den von Gemeindeseite formulierten Forderungen nach Kapuzinermissionaren nachverfolgen (2.4.1.). Hinter ihnen steckten handfeste lokale Interessen, die einerseits mit einer konfessionellen Argumentationslogik begründet und andererseits mit dem kommunalen Pfarrwahlrecht gerechtfertigt werden konnten. Freilich entbehrten diese Mehrebenenspiele nicht einer gewissen Brisanz, zumal angestammte Entscheidungsprozesse und Rechtsansprüche dadurch infrage gestellt waren. Damit setzte die intensivierte Verflechtung in der lokalen Gesellschaft bisher unbekannte Konfliktdynamiken frei, die, wie in der Talschaft Misox, bürgerkriegsähnliche Zustände annehmen konnten (2.4.2.). Als nämlich die in Rom und Mailand ausgebildeten Priester in ihre Heimat zurückkehrten, fanden sie so manche Gemeinde von Kapuzinern aus der Mailänder Ordensprovinz betreut vor. Ihren Versuch, die landesfremden Geistlichen auf politischem Wege des Tals zu verweisen, konterten die Anhänger der Kapuziner mit der Androhung von Waffengewalt, wobei sie die einheimischen Weltpriester als Hexer oder Söhne von Hexen verleumdeten. Im engsten Sinne des Wortes schlug sich hier der Segen der grenzüberscheitenden Verflechtung in ihren Fluch um.
2.4.1. Alte Freiheiten, neue Handlungsspielräume: Konfessionelle Argumentationslogiken im Dienste der gemeindekirchlichen Autonomie
Die Propagandakongregation war in den 1630er-Jahren dazu übergegangen, auch in katholisch gebliebene Täler Missionare zu entsenden. 1634 erlaubte sie den Kapuzinern der Mailänder Ordensprovinz, im ausschließlich katholischen Misox Missionshospize zu errichten.515 In der Folge mussten sich die Kongregationskardinäle mit einer ganzen Reihe von Gesuchen katholischer Gemeinden befassen, ebenfalls Missionsstationen gründen beziehungsweise Missionare aus dem Ordensklerus als Pfarreiseelsorger einsetzen zu dürfen. Den Anfang machte 1642 die Misoxer Gemeinde Cabbiolo,516 gefolgt von Lostallo, Verdabbio und Roveredo 1652517 sowie Cama mit Leggia 1654518 und Mesocco 1658519. Auch aus den Nordbündner Tälern gelangten gleichlautende Suppliken nach Rom: 1655 aus Vals,520 1680 aus Sumvitg,521 1691 aus Tujetsch,522 1721 aus Mon und Stierva,523 1746 aus Salouf524 und 1749 aus Ruis525 – quellenbedingt nicht erwähnt sind hier all jene katholischen Pfarreien, in denen die Mission ohne großes Bitten eingeführt wurde.526 Dazu kamen Gesuche von Gemeinden aus den Untertanengebieten der Drei Bünde, die in der Forschung bisher keine Beachtung gefunden haben, weil sie letztlich – im Gegensatz zu den bisher erwähnten Beispielen aus Nordbünden – erfolglos geblieben sind. Bereits 1643 forderte die Talschaft Val San Giacomo sechs Kapuzinermissionare und tat dies mit dem Verweis auf das Misox, wo ähnliche Verhältnisse herrschten und wo man bekanntlich der Mission zugestimmt habe.527 Weitere (erfolglose) Gesuche trafen 1653 aus Chiavenna,528 um 1670 aus Biolo (bei Ardenno im Veltlin),529 1672 aus Campodolcino,530 1678/1680 aus Villa di Chiavenna531 und 1689 aus Gallivaggio532 ein. Neben diesen Bitten um die Gründung von Missionsstationen bezweckte eine zweite Gruppe von Suppliken, die bereits bewilligten Kapuziner behalten zu dürfen beziehungsweise nicht, wie vom Bischof gefordert, durch einen Diözesankleriker ersetzen zu müssen. Entsprechende Schreiben sandten neben Disentis533 und Sumvitg534 auch Riom,535 Obervaz,536 Tomils,537 Tinizong538 und Alvaneu539 nach Rom.
Dieser Überblick zeigt, dass sich seit den 1640er-Jahren zahlreiche Pfarrgemeinden aus den Drei Bünden, aus Chiavenna und aus dem Veltlin direkt und ohne Umweg über die Bistumsleitung – in einigen Fällen über die Luzernern Nuntiatur – an die päpstliche Kurie wandten. Sie erachteten die Propagandakongregation als Patron, von dem Protektion und anderweitige Patronageressourcen zu erwarten waren. Was genau versprachen sich die Gemeinden von dieser Patron-Klient-Bindung? Welche Vorteile brachte ihnen die von der Propaganda Fide eingesetzte und kontrollierte Mission? Bevor wir uns der Argumentation der Gemeinden selbst zuwenden, versuchen wir diese Fragen aus der distanzierten Perspektive des Historikers zu beantworten und behelfen uns dabei einer bemerkenswert differenzierten Einschätzung des Mailänder Kapuzinerprovinzials Lino da Lezzeno von 1643. Wie so viele seiner Ordensbrüder betonte dieser zwar ebenfalls den »spirituellen« Nutzen der Mission, war sich aber gleichzeitig bewusst, dass die Beliebtheit der Kapuzinermissionare auch auf weltlichen oder »zeitlichen Interessen«540 gründete. Erstens sei eine Pfarrpfrund für einen Weltpriester teurer als der Unterhalt zweier Kapuziner. Zweitens müsse die Gemeinde nicht direkt für das leibliche Wohl (Kleider, Verpflegung) der Missionare aufkommen, da hierfür Almosen und Spenden aus den italienischen Kapuzinerprovinzen zur Verfügung stünden. Die dadurch eingesparten Gelder würden die Kapuziner für die Verschönerung und Vergrößerung der Gotteshäuser sowie zur Anschaffung von Ausstattungsgegenständen verwenden. Drittens böten die Kapuziner gratis und nur um Gottes Lohn Schulunterricht an. Und viertens würden die Kapuziner nie ihre Pfarreien verlassen, sondern seien Tag und Nacht erreichbar.541 Betrachtet man die bescheidenen finanziellen Verhältnisse der Pfarreien542 sowie die bewundernden Berichte über die im Missionsgebiet entstandene Sakralkultur543, so dürften die von Lino da Lezzeno angeführten Argumente in der Tat wichtige Motive für die Forderung nach Kapuzinern gewesen sein. Zu ergänzen wäre dieser Interessenkatalog noch um die Rolle der Ordensgeistlichen als Vermittler des Heils, ermöglicht auch durch die Einfuhr von Reliquien, Devotionalien und Ablässen aus Italien. Für die um ihr Seelenheil besorgten Menschen waren die Ordensbrüder damit Garanten nicht nur innerweltlichen, sondern auch jenseitigen Wohlergehens und als solche höchst geschätzt. Es gab also ganz handfeste Gründe, so lässt sich folgern, um von der Propagandakongregation Missionare zu verlangen. Wie aber begründeten die Gemeinden selbst ihre Forderungen? Von welcher Argumentation versprachen sie sich am meisten Erfolg?
Auffallend ist, dass in den Bittschriften die soeben genannten Motive mit keinem Wort erwähnt werden. Stattdessen wird stets mit der kirchlich-religiösen Notlage argumentiert. Die Talschaft San Giacomo begründete 1643 die Forderung nach sechs Missionaren wie folgt:
»In der Grafschaft Chiavenna befindet sich ein armes Tal, Val San Giacomo genannt, welches von allen Seiten von den häretischen Bündnern umgeben ist; es ist bewohnt von einer großen Zahl von Leuten, die von den vergangenen Kriegen arg gebeutelt sind und jetzt ein Großteil des Jahres in der Fremde verbringen und ihr Brot in protestantischen Ländern verdienen müssen. In Sachen des heiligen katholischen Glaubens sind sie [daher] wenig [unterrichtet] und so findet man viele […] Häretiker, und dies alles, weil es keine genügenden Seelsorger gibt, da die gut ausgebildeten nicht in diese[s] wilde und arme [Tal] gehen wollen. Und aus diesem Grund verschlechtert sich der Zustand des heiligen Glaubens jeden Tag.«544
Die Gemeinde Mesocco führte 1677 ganz ähnliche Argumente an:
»Wir bitten deshalb Ihre Eminenzen […], die Sie sich mit heiligem Geist des buon governo [in etwa ›gute Policey‹] der Kirche widmen, uns mit weiteren Kapuzinermissionaren zu versorgen; wir rufen Euch […] in Erinnerung, dass wir uns an der Grenze zu den gegen die katholische Kirche gerichteten Protestanten befinden, dass wir quasi aus Not mit ihnen Handel treiben, dass mit dem Eifer der Missionare das Tal vom ansteckenden Gift des ruchlosen Luthers gereinigt werden kann […], dass, wenn die Hilfe der Kapuziner ausbleibt, wir der Gefahr entgegengehen, dass der bedauernswerte Zustand wiederkehrt, in welchem der Teufel von unseren beklagenswerten Seelen Besitz ergriffen hat […].«545
Ähnliche Beispiele ließen sich noch weitere anführen. Hier soll die Beobachtung genügen, dass die Suppliken der Gemeinden offenbar ganz bewusst auf jene Diskurse und Topoi rekurrierten, mit denen auch die Kapuziner und Nuntien die kirchlich-religiöse Situation im rätischen Alpenraum zu erfassen versuchten (siehe 2.3.2.). Dazu gehörte erstens der Hinweis auf die konfessionelle Grenzlage,546 zweitens die Sorge, dass sich das »Gift der Häresie«547, einer ansteckenden Krankheit gleich, gegen Süden ausbreiten könnte, drittens der Zusammenhang zwischen karger Natur, Arbeitsmigration und konfessioneller Grenzüberschreitung und viertens der Kampf gegen Hexerei und die Macht des Teufels. Bemerkenswert ist, dass die Bittsteller mit dieser Argumentation selbst eingestanden, unter ihnen mangle es an einer kirchen- und konfessionsgebundenen Religiosität. 1674 schrieb die Gemeinde Breil/Brigels nach Rom, es brauche dringend zwei Kapuzinermissionare, sowohl zur Instandhaltung und Ausschmückung der Sakralbauten als auch zur »Korrektur unseres Volkes, das grob und ignorant, halbherzig und kalt in der Verehrung und im Dienst Gottes und auch im Wissen über Dinge des Glaubens geworden ist«548. 1677 gaben die Bewohner von Soazza zu, vor der Ankunft der Kapuziner hätten sie nicht gewusst, wie das Kreuzzeichen zu machen sei, denn die »Grundlagen des orthodoxen römischen Glaubens«549 seien ihnen unbekannt gewesen. Und noch 1722 räumte der Gemeindevorsteher von Mon ein, die Gemeindegenossen würden viele Kirchenfeste nicht feiern, die Sakramente empfingen nur wenige von ihnen regelmäßig; viele lebten in Sünden und einige würden gar offen zugeben, Calvinisten zu sein – insgesamt seien sie also fehlerhafte Katholiken.550 Wie ist diese Selbstanklage zu verstehen? Ist sie Ausdruck einer gegenüber dem 16. und frühen 17. Jahrhundert veränderten mentalen Grunddisposition, die Abweichungen vom konfessionellen Ideal als »falsch« empfindet? Ist dahinter ein Vorgang der Selbstdisziplinierung, eine aus dem lokal-kommunalen Umfeld erwachsene Konfessionalisierung zu vermuten, wie dies beispielsweise Heinrich Richard Schmidt für die Sittengerichte von Berner Landgemeinden feststellen konnte?551 Ganz auszuschließen ist dies nicht: Anzunehmen ist etwa, dass die religiöse Denk- und Vorstellungswelt zumindest eines Teils der Bergbevölkerung tatsächlich eine evidente Veränderung erfuhr552 – begünstigt auch durch den Schulunterricht der Kapuziner ebenso wie durch die von ihnen verfassten volkssprachlichen Lieder-, Gebets- und Andachtsbücher. Zu beachten ist allerdings, dass die zitierten Suppliken allesamt von der lokalen Elite verfasst wurden und die darin enthaltenen Anklagen sich wohl gerade auch gegen die sozial niedriger gestellte Dorfbevölkerung richteten. Man könnte dies als konfessionelle Disziplinierung interpretieren, betrieben von einer politischen und kulturellen Dorfelite, die sich selbst über Normen definierte, wie sie die römisch-katholische Konfessionskirche vorgab. Dennoch oder gerade deswegen darf der instrumentelle Charakter der in den Suppliken enthaltenen »Selbstanklagen« nicht unterschätzt werden. Die entsprechende Rhetorik war Mittel, um Kardinäle und Nuntien von bestimmten Forderungen zu überzeugen und in lokalen Konflikten auswärtige Unterstützung für die eigene Position zu mobilisieren. Ein Blick auf das Verhältnis zwischen den Pfarrgemeinden und den Bischöfen soll im Folgenden helfen, diese diskursive Logik besser zu verstehen.
Sowohl in den Drei Bünden als auch in den Untertanengebieten beanspruchten die meisten Pfarrgemeinden das Recht für sich, ihre Pfarrer selbst zu wählen (Nominationsrecht).553 Den Bischöfen von Chur und Como kam in diesen Fällen, wenn überhaupt, lediglich das Vorschlags- respektive Bestätigungsrecht (Präsentation) zu. Und so kam es, dass die Gemeinden seit den 1630er-Jahren zunehmend auch Kapuziner der rätischen Mission zu Pfarrern ernannten, obschon die Pastoration von Pfarreien eigentlich dem Diözesanklerus vorbehalten war. Weil folglich Widerstand vonseiten der Bistumsleitung zu erwarten war, betonten die Pfarrgemeinden umso nachdrücklicher ihr ius nominandi. So argumentierte beispielsweise die Veltliner Gemeinde Biolo, sie habe das Recht, ihre Pfarrer selbst zu wählen, und weil es an qualifizierten Priestern aus dem Weltklerus fehle, ersuche man die Propagandakongregation, Kapuziner aus der Mailänder Ordensprovinz als Pfarreiseelsorger einsetzen zu dürfen.554 Im Misox habe es sich nämlich erwiesen, dass die Kapuzinermissionare mit ihren »geistlichen Übungen« (esercitii spirituali) und dem »Spenden der Sakramente« (amministrazione dei Sacramenti) zahlreich »Früchte zum Wohle der Seelen«555 einbringen, also solle es auch in Biolo geschehen.
Für die Bischöfe waren solche Forderungen höchst ambivalent. Auf der einen Seite garantierten die Kapuziner eine intensive geistliche Betreuung des Kirchenvolkes, womit überhaupt erst an eine Neuentfachung kirchlichen Lebens auf Gemeindeebene zu denken war. Auf der anderen Seite war die bischöfliche Kontrolle über die Ordensbrüder eingeschränkt, da sie aufgrund des Missionsstatus direkt der Propaganda Fide respektive dem Missionsverantwortlichen ihres Ordens unterstellt waren. Kapuzinerseelsorger eigenmächtig abzusetzen oder zu versetzen war der Bistumsleitung so verwehrt.556 In diesem Spannungsfeld bewegten sich die Stellungnahmen der bischöflichen Ordinariate gegenüber den Forderungen nach Kapuzinern. Noch der Churer Bischof Johann VI. Flugi von Aspermont (1636–1661) besetzte freigiebig Pfarreien mit Kapuzinermissionaren. Zwar opponierte auch er gegen unliebsame Entscheide der Missionsleitung, doch die Kapuzinerseelsorger an sich schienen ihm unproblematisch.557 Interessanterweise war es einer dieser Kapuziner, der den Bischof ermahnte, man solle »die Türe [den Kapuzinern] nicht allzu weit öffnen«558, weil dies womöglich den Unmut der einheimischen Weltpriester schüren könnte. In den späteren Episkopaten wurde es dann für die Gemeinden zunehmend schwieriger, für ihren Wunsch nach Kapuzinern bei der Bistumsleitung Gehör zu finden. 1721 klagte die Gemeinde Mon gegenüber der Propagandakongregation, sie habe »in Chur und anderswo verschlossene Türen vorgefunden«, weshalb man hoffe, die Kardinäle würden diese Türen »aus Liebe zu Gott« öffnen, denn der »Zustand jeglichen Glaubens« in dieser Gemeinde sei erbärmlich.559
In Anbetracht dessen erhoffte sich so manche Gemeinde von der Kurienkongregation de Propaganda Fide Protektion, um gegen den Widerstand des Ortsbischofs die begehrten und auf den Kirchgemeindeversammlungen oftmals bereits gewählten560 Kapuziner definitiv als Pfarrer berufen zu dürfen. Um dies zu erreichen, bedienten sie sich einerseits der Argumentation, die die Repräsentanten der römischen Amtskirche zur Begründung der innerkatholischen Mission anführten. Andererseits gaben sie mittels der unterwürfigen Rhetorik eines Klienten der Propaganda Fide zu erkennen, dass sie die Kurienkongregation als maßgebende, über dem Bischof stehende Instanz anerkannten und ihr Gehorsam entgegenzubringen bereit waren.561 Dieses direkte Bitten in Rom enthielt damit eine symbolträchtige Botschaft an den Bischof: Die Gemeinden gaben so zu verstehen, dass sie zwischen sich und der römischen Kurie keine intermediäre Instanz duldeten. Sie betonten damit ihre gemeindekirchlichen Freiheiten, die sie, wenn überhaupt, nur gegenüber der römischen Kurie rechenschaftspflichtig machten. In diesem Sinne erweiterte die mit der rätischen Mission einsetzende institutionelle Verflechtung und die sich gleichzeitig etablierenden Diskurse über die Religiosität der Bündner Katholiken die Handlungsspielräume der Kirchgemeinden erheblich: Durch geschickte Übernahme bestimmter konfessioneller Argumentationslogiken und die unmittelbare Appellation an die römische Kurie ließen sich die eigenen Interessen im Idealfall auch gegen den Willen des Bischofs durchsetzen.
Um dieses komplexe Mehrebenenspiel anschaulich zu machen, werden im Folgenden zwei Konfliktkonstellationen rekonstruiert, die sich beide im Zusammenhang mit der Berufung von Kapuzinermissionaren ergaben. Zum ersten Konflikt kam es ab 1672 zwischen der im Val San Giacomo gelegenen Gemeinde Campodolcino und dem Bischof von Como, der zweite ereignete sich 1746 und betraf die Gemeinde Salouf in der Churer Diözese.
Im Frühjahr 1672 traf bei der Propagandakongregation in Rom eine Bittschrift ein, unterzeichnet vom Notar Antonio Tomella im Auftrag der Kirchenvögte von Campodolcino. Darin war zu vernehmen, die Kapuzinermission im Misox habe sich als so nützlich erwiesen, dass sich Campodolcino ebenfalls zwei Kapuziner aus der Mailänder Ordensprovinz wünsche. Diese seien notwendig, weil viele Einwohner sittlich verkommen seien und jeden Tag die Gefahr bestehe, dass sich bei ihnen viele »Fehler« und »Missbräuche« in Glaubensdingen festsetzten, wenn sie nicht durch Christenlehre, Predigten und den beispielhaften Glaubenseifer der Missionare »kultiviert« würden.562 Spirituelle Hilfe sei dringend notwendig, wie auch Nuntius Federico Borromeo bei seiner (ein paar Jahre zurückliegenden) Visitation festgestellt habe, so die Gemeinde Campodolcino weiter. In Rom beschloss man, das Geschäft an einer der nächsten Kongregationssitzungen zu behandeln, vorher aber noch die Meinungen der Bischöfe von Chur und Como sowie des Nuntius einzuholen.563
Als erster antwortete der Luzerner Nuntius Odoardo Cibo, wobei er die Kardinäle zunächst allgemein über die Gemeinde informierte. Sie bestehe aus vier verschiedenen, über die Berge verteilte »Konsulate« (consulati) von insgesamt 2000 Einwohnern, was die Seelsorge erheblich erschwere. Der Vizepfarrer (vice curato) und der Kaplan, beide von der Gemeinde gewählt, müssten bis zu drei Stunden Fußweg auf sich nehmen, um ihre pastoralen Pflichten erfüllen zu können. Noch dazu seien die Leistungen dieser beiden Geistlichen sehr dürftig. Der Vizepfarrer mische sich in »öffentliche Angelegenheiten« (affari del Publico) ein und säe so Zwietracht im Dorf.564 Mit Ausnahme des Vizepfarrers sei kaum jemand von den Pfarreigenossen gegen die Kapuziner. Er, Nuntius Cibo, erachte eine Mission der Ordensbrüder als sehr sinnvoll, zumal man so die 100 Gulden für die beiden Priester einsparen und sie stattdessen für die Kirche oder die Armen ausgeben könne. Allerdings sei mit erheblichem Widerstand vonseiten des Bischofs von Como zu rechnen.
Noch vor der Antwort aus Como traf diejenige aus Chur ein. Weil sich der Bischof auf einer Visitationsreise befand, tat am 13. und 20. Juli 1672 zuerst der Churer Dompropst Conradin Mohr seine Meinung kund.565 Die kirchlich-religiöse Lage in Campodolcino ebenso wie in Isola (am Splügenpass) sei sehr prekär, weil die Bewohner regen Handel mit den Protestanten aus Splügen betrieben. Es sei ein eigentliches Wunder, dass sich dort die »Häresie« bisher noch nicht weiter ausgebreitet habe, schrieb Mohr. Gleichzeitig gestand er ein, dass dies seine persönliche Meinung sei. Der Churer Bischof schätze die Lage ganz anders ein, vielleicht auch, weil er seinem Amtsbruder in Como nicht in den Rücken fallen wolle, so Mohr.566 In der Tat ließ Bischof Ulrich VI. von Mont (1661–1692) verlauten, in seiner Diözese habe die Mission große Unruhen verursacht, weil sich die Weltpriester durch die Kapuziner von den Pfarreistellen verdrängt sehen. Er erachte es deshalb als sinnvoller, in Campodolcino einen beispielhaften Weltpriester einzusetzen.567
Erwartungsgemäß noch etwas schärfer sprach sich der Bischof von Como gegen die Ordensgeistlichen aus. Die der Propaganda Fide zugetragenen Informationen über die kirchlich-religiösen Missstände in Campodolcino seien nichts weiter als »Flausen von zwei oder drei vernebelten Gehirnen, die danach trachteten, die Renditen und Almosen der Kirchen zu vergeuden und in den eigenen Besitz zu überführen«568. Er habe vor kurzem Campodolcino persönlich visitiert, und wäre er auf eine ungenügende geistliche Betreuung der Pfarrei gestoßen, so hätte er nicht gezögert, die Propagandakongregation davon in Kenntnis zu setzen. Der einzige entdeckte Missstand aber sei, dass das Kirchenvermögen von Laien verwaltet werde und diese damit zum Beispiel auch Bankette für weltliche Richter (Giudici secolari) bezahlten.569 Tatsächlich waren Kirchenämter und Pfarreibenefizien im rätischen Alpenraum stark eingebunden in die kommunale politische Kultur570 und damit der Kontrolle des Bischofs weitgehend entzogen. Um dem Abhilfe zu verschaffen, habe er, so Bischof Torriano, per Dekret das »Praktizieren« mit Kirchenressourcen verboten.571 Diese Aussagen des Bischofs lassen erahnen, dass der ganzen Kontroverse um die Einführung der Kapuzinermission womöglich ein Ressourcenkonflikt zugrunde lag: Unterschwellig ging es nicht so sehr um die Frage, ob die Seelsorge nachtridentinischen Ansprüchen genügte, sondern vor allem darum, wer über die knappen Ressourcen bestimmen und verfügen konnte. Bemerkenswert ist, dass der Bischof nun selbst das gemeindekirchliche Argument aufgriff, um die Interessen der Missionsbefürworter als rein weltlich, ihr Argument des religiösen Missstandes als vorgeschoben zu entlarven. Seien die Bewohner von Campodolcino mit ihrem Pfarrer, den sie ja selbst gewählt hätten, unzufrieden, so sei er jederzeit bereit, den betreffenden Geistlichen auf Ansuchen der Gemeinde abzuberufen. Um dies zu erreichen, müsse man nicht an die Propagandakongregation gelangen. Er habe genügend gut ausgebildete Priester, aus denen die Gemeinde einen Ersatz wählen könnte; unter den Kapuzinern dagegen gebe es viele unfähige Seelsorger.572
Zur Bekräftigung seiner Argumentation legte der Bischof von Como eine Denkschrift des Mailänder Kapuzinerprovinzials bei. Darin erklärte dieser in neun Punkten, weshalb eine Mission in Campodolcino nicht angemessen sei. So verfüge die Provinz nicht über genügend gut ausgebildete Ordensmitglieder. Zudem würden sich durch die Ausweitung der Mission die Klöster, insbesondere dasjenige von Chiavenna, entleeren. Und schließlich wollten die Gemeinden im Val San Giacomo »willkürlich« über die Einsetzung und Entlassung von Missionaren entscheiden, was in keiner anderen Mission üblich sei.573 Dem Nuntius versicherte er allerdings, er werde sich nicht widersetzen, falls die Propagandakongregation sich für die Ausstellung von entsprechenden Missionsfakultäten entscheiden sollte.574
Die für die Mission im rätischen Alpenraum maßgebenden kirchlichen Akteure waren sich also nicht einig, ob die Mission in Campodolcino dringend notwendig oder vielmehr mit allen Mitteln zu verhindern sei. Während die Bischöfe von Chur und Como das Vorhaben energisch bekämpften, sprach sich Nuntius Cibo klar für die Kapuzinermission aus.575 Angesichts dessen durfte Campodolcino durchaus zuversichtlich sein, in Rom Gehör zu finden. Letztlich entschieden sich die Kongregationskardinäle jedoch gegen die Mission,576 sei es aus Rücksichtnahme auf die Autorität des Bischofs von Como, sei es, weil sie hinter der konfessionellen Argumentation der Gemeinde schlicht weltliche Interessen vermuteten.
Einen anderen Ausgang nahm die Angelegenheit in Salouf, obschon auch hier der Ortsbischof gegen die (erneute)577 Einführung der Kapuziner opponierte. Begonnen hatte alles mit der Visitation des Nuntius im Oberhalbstein 1746, bei welcher die Saloufer ihre Bitte um Missionare aus dem Ordensklerus vortrugen.578 Es sei für nur einen Priester unmöglich, die Pfarrei zufriedenstellend zu betreuen, weil es in der Gemeinde vier verschiedene Kirchen gebe: die Pfarrkirche, die eine Stunde entfernte Landkirche San Rocco in Del, die Alpkapelle San Antonio und die Wallfahrtskirche von Ziteil (auf 2400 m ü. M.). Weil letztere in den Sommermonaten von unzähligen Pilgern aufgesucht werde und der Pfarrer dort deshalb nicht nur an Sonn- und Festtagen Messen lesen, Beichten hören und die Kommunion austeilen müsse, bleibe die Pfarrkirche in dieser Zeit ohne geistliche Betreuung. Dies sei bedauerlich, da sich Salouf »inmitten von Häretikern«579 befinde. Die Kirche weise nicht genügend Einkünfte auf, um einen Kaplan anzustellen, sodass man um Missionare aus der Kapuzinerprovinz Brescia bitte, so die Saloufer.
In den folgenden Monaten adressierten die Gemeindevertreter gleichlautende Bittschriften zuerst abermals an den Nuntius, später auch direkt an den Papst.580 Mit Nachdruck betonten sie nochmals, dass die Kirchen der Pfarrei an wichtigen Festtagen unbetreut seien.581 Der Churer Bischof indessen widersprach dieser Darstellung und entlarvte in seinen Schreiben an den Nuntius und an Kardinalstaatssekretär Valenti Gonzaga die von Salouf angeführten Argumente als interessengesteuert und eigennützig.582 Die Gemeinde selbst habe einst die Missionare entlassen, wie man in der von Clemente da Brescia verfassten Geschichte der rätischen Mission nachlesen könne.583 Daher seien die Saloufer an diesem Zustand nicht so unschuldig, wie sie allen glauben machen wollten.584 Führe man jetzt wieder Missionare ein, so könnten große Unruhen unter dem Clero Nazionale, den einheimischen Weltpriestern, entstehen. Schließlich sei Salouf während 97 (sic!) Jahren mit dem Diözesanklerus zufrieden gewesen, trotz all der Punkte, die man jetzt als Argumente für die Berufung von Ordensgeistlichen anführe. Zweitens sei die Behauptung, Salouf wäre von Protestanten umgeben, schlichtweg falsch: Das Oberhalbstein sei mit Ausnahme Bivios ein rein katholisches Tal. Und drittens habe er, der Bischof, erst vor einigen Jahren eine Sonderregelung für die geistliche Betreuung des Wallfahrtsortes Ziteil erlassen. Dort dürften jetzt auch andere Priester Messen lesen, die aus der Wallfahrtskasse bezahlt würden und somit keine Belastung für die Pfarrei Salouf darstellten.585 Die mangelnde Betreuung ebenso wie die konfessionelle Bedrohungslage enthüllte der Bischof damit als Vorwand, angeführt von einer Pfarrgemeinde, um in Umgehung der zuständigen kirchlichen Obrigkeit die eigenen Interessen und Prätentionen – hier die Entlassung und Ernennung der Seelsorger – durchsetzen zu können. Erfolg hatte der Bischof mit dieser Strategie aber nicht, denn spätestens ab 1750 sind wieder Kapuziner als Pfarreiseelsorger von Salouf bezeugt.586