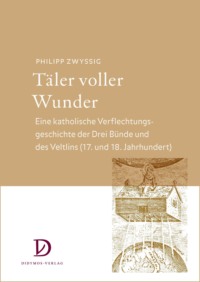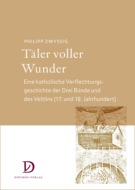Kitabı oku: «Täler voller Wunder», sayfa 12
2.3.2.3. Das Schisma der Bündner Katholiken: Semantiken lokaler katholischer Kirchlichkeit
Im Jahr 1661 erließ die Kurienkongregation de Propaganda Fide eine Vorschrift, gemäß der die Kapuziner der rätischen Mission nicht länger als ein Jahr am gleichen Ort tätig sein durften.460 Bei der Missionsleitung stieß dieser Entscheid auf Unverständnis. Im Namen aller Kapuzinermissionare gab sie zu bedenken, dass es in einem Jahr schlicht unmöglich sei, »Kenntnis über die Qualität der Menschen, ihre spirituellen Krankheiten und ihre Bedürfnisse anzueignen, um so die notwendigen Mittel anzuwenden«461. Weder die individuelle Frömmigkeit der Gläubigen noch die kirchengebundene Glaubenspraxis in der Gemeinde (culto divino) könnten so gesteigert werden, wie es das Ziel der Mission ja eigentlich sei. Die Kenntnis der lokalen Sitten und Bräuche, der religiösen Ordnungs- und Glaubensvorstellungen, der kirchlichen Institutionen, aber auch der Sprache und der politischen Kultur erachteten die Kapuziner als unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Mission. Besonders in den Anfängen der rätischen Kapuzinermission verwendete die Ordensleitung große Anstrengungen darauf, jene Eigenheiten zu erkennen und zu beschreiben, die das religiöse Weltbild der Bündner Katholiken zu konstituieren schienen. Dabei etablierten sich bestimmte Wahrnehmungsmuster, die sich in den Missionsberichten und Korrespondenzen mit der römischen Kurie als wiederkehrende Topoi festmachen lassen.
In ihren frühesten Rechenschaftsberichten entwarfen die Kapuziner ein aus römisch-katholischer Sicht besorgniserregendes Bild der kirchlich-religiösen Verhältnisse im rätischen Alpenraum. Das Engadin und das Münstertal seien zum größten Teil in die Hände der Protestanten gefallen. Die wenigen verbliebenen Katholiken seien »im Eifer und im Geist des heiligen katholischen Glaubens [dermaßen] abgekühlt, dass sie in ihrer Form so gut wie keine Katholiken, sondern vielmehr Schismatiker sind«462, schrieb der aus dem Veltlin stammende Kapuzinermissionar Bonaventura da Caspano. Seine Feststellung beruhte auf der Beobachtung, dass die meisten Katholiken die Fastenzeit nicht einhielten und die Sakramente (vor allem die Buße und die Eucharistie) »mit sehr wenig Anteilnahme und sozusagen nur pro forma«463 empfingen. Jene Bewohner des Münstertals, die sich als Katholiken ausgeben würden, seien in Wahrheit »Schismatiker«, weil sie die Autorität des Papstes nicht anerkennten, weil die meisten von ihnen nicht ans Fegefeuer glaubten und weil sie deshalb auch nicht wüssten, was es mit den Ablässen auf sich habe, hieß es in einem anderen Missionsbericht.464 Es ist sicher richtig, solche Aussagen historisch in jener Anfangszeit der rätischen Mission zu verorten, in welcher die italienischen Kapuziner mit großer Verwunderung auf lokale Formen katholischer Kirchlichkeit stießen, die ihnen fremd vorkamen und die offenbarten, dass eine von Rom ausgehende und im Papsttum verkörperte Einheit der katholischen Christenheit ein nachtridentinisches Ideal war, das wenig mit der Wirklichkeit zu tun hatte. Gleichwohl ist festzustellen, dass dieser von den Kapuzinern eingeführte Schisma-Topos eine weiter gefasste Rezeption erfuhr und auch in späterer Zeit teils unverändert, teils rhetorisch leicht abgewandelt zur Beschreibung des Bündner Katholizismus herangezogen wurde. Der Churer Dompropst Christoph Mohr gab 1639 dem von der Propagandakongregation ernannten Generalvisitator für die rätische Mission zu verstehen, die nicht zur Reformation übergetretenen Gemeinden der Drei Bünde hätten »bloß den Namen der Katholiken« bewahrt, in Wahrheit aber seien sie »schismatisch«.465 Noch abfälliger äußerte sich der uns bereits bekannte Luzerner Johannes Kriesbaumer, Apostolischer Missionar im gemischtkonfessionellen Zizers. Die Katholiken seien »noch schlimmer als die Protestanten«, beklagte er sich beim Nuntius, und bat diesen gleichzeitig darum, in die Eidgenossenschaft versetzt zu werden, »wo diejenigen, die Katholiken sind, auch wirklich katholisch sind«.466
Wie von Kriesbaumer wurde der Schisma-Vorwurf in vielen Fällen als Argument angeführt, meistens nicht zwecks eines persönlichen Anliegens wie beim Luzerner Priester, sondern um gewisse kirchenpolitische Maßnahmen zu rechtfertigen oder zu fordern. Dies galt insbesondere für die von den Weltpriestern teils heftig bekämpfte Besetzung von Pfarrstellen mit Kapuzinern. Dompropst Mohr, ein Befürworter dieser Maßnahme, betonte etwa rechtfertigend, die Schismatiker seien von den Kapuzinern »zum rechten Licht«467 geführt worden, indem die Ordensbrüder in Zusammenarbeit mit den Bischöfen den gregorianischen Kalender eingeführt, für die Anerkennung der päpstlichen Autorität gesorgt und eine Reform des gesamten Klerus angestoßen hätten. In einem Missionsbericht von 1662 hieß es: Weil die Kapuziner die Sitten der Katholiken korrigiert und die »größten Missbräuche« und »Fehler« in Glaubensdingen beseitigt hätten, die es zahlreich gegeben habe, obschon die Bevölkerung dem Namen nach eigentlich katholisch wäre, sei die Mission von Disentis ein voller Erfolg.468 Dies zu betonten war im Falle von Disentis deshalb so wichtig, weil der Abt des Benediktinerklosters die italienischen Ordensbrüder als unliebsame Konkurrenz betrachtete und auf politischem Wege gegen die Missionsstationen in und um Disentis vorging.469
Wenngleich dieser instrumentelle Gebrauch stets mitzudenken ist, lassen sich aus dem Schisma-Diskurs zwei faktische Besonderheiten des Bündner Katholizismus herausschälen, die das zeitgenössische Bild, das man sich in Brescia, Mailand, Rom und anderswo von ihm machte, konstituierten. Zum einen beobachtete man eine weitgehende institutionelle Unabhängigkeit der Kirchgemeinden. Diese schienen weder vom Bischof kontrolliert noch in das grenzübergreifende System der päpstlichen Heilsvermittlung (etwa mittels Ablässen) eingebunden zu sein.470 Zum anderen war die in den Drei Bünden einstweilen vorgefundene Glaubenspraxis der Katholiken tatsächlich nicht zu vergleichen mit der Frömmigkeitskultur mediterranen Zuschnitts, die im Zuge der katholischen Reform bekanntlich zum Vorbild erhoben wurde.471 Beide Beobachtungen fanden in den nach Rom gesandten Berichten viel Aufmerksamkeit, wobei sich hier wiederum gewisse Sprechweisen und Argumentationsmuster durchsetzten, denen es im Folgenden nachzugehen gilt.
Der als Missionar im Oberhalbstein tätige Kapuziner Stefano da Gubbio machte das »Schisma« der Bündner Katholiken vor allem am mangelnden Gehorsam gegenüber dem Apostolischen Stuhl sowie an der Eigenständigkeit in kirchenrechtlichen Angelegenheiten fest. Die Pfarrgemeinden würden weder den Bischof noch die von ihm ernannten Priester anerkennen, sondern wollten die Pfarrer selbst ernennen und entlassen, »wie es ihnen passe«472, so Pater Stefano. Er ordnete diese Feststellung ein in eine Reihe mit weiteren »Missbräuchen« (abusi), die er bei den Bündner Katholiken zu erkennen glaubte, darunter die »Usurpation von Kirchengütern«,473 »Ignoranz« beziehungsweise der Mangel an Bildung,474 Trunksucht475, Ämterpraktiken476 und das Streben nach Ruhm. In dieser ganzheitlichen Betrachtung der »Missbräuche« mochte die schismatische Haltung der Bündner Katholiken weniger als bewusst gewählte religiöse Überzeugung als vielmehr als beiläufige Konsequenz einer politischen Kultur erscheinen, die dem »gemeinen Mann«477 beziehungsweise den Gemeinden weitgehende Freiheiten und politische Rechte einräumte. Die Bündner hätten dermaßen Angst, ihre »Freiheit« (libertà) zu verlieren, so der Kapuziner Damiano da Nozza, dass sie zwar freiwillig, nie aber unter rechtlichem Zwang – etwa mittels Pfrund- oder Zehntvertrag – für den Unterhalt von Kapuzinern oder anderen Geistlichen aufkommen würden.478 Besonders bedacht seien sie auf ihre »Freiheit, die Pfarrer selbst zu wählen«479, hielt auch die eingangs erwähnte Stellungnahme der Kapuziner von 1661 fest. Weder der Bischof noch eine andere Obrigkeit könne ohne ihre Zustimmung über die seelsorgerische Betreuung der Pfarreien bestimmen. Andere Berichterstatter verwiesen auf die Möglichkeit der Gemeinden, Sanktionen gegen Priester zu erlassen, ferner auf das seit 1526 geltende Verbot landesfremder Geistlicher480. Weil alle diese Befugnisse der Pfarrgemeinden eine unmittelbare Einflussnahme der römisch-katholischen Amtskirche auf die religiösen Verhältnisse vor Ort verhinderten oder zumindest erschwerten, galten sie in den Augen der Kapuziner als abusi, als Missbräuche, und somit als Ursache des »schismatischen« Abfalls der Bündner von der »apostolischen« Kirche.
Während die Missbrauchs-Rhetorik auf das rechtlich-institutionelle Gefüge der katholischen Kirche in den Drei Bünden Bezug nahm, wurde für die zweite Seite des zeitgenössischen Schisma-Verständnisses – für die fremdartige und angeblich rudimentäre Glaubenspraxis der Bündner Katholiken – eine Semantik üblich, die sich an den klimatischen und geographischen Gegebenheiten im rätischen Alpenraum orientierte. Pater Ireneo da Casalmore, einer der ersten Kapuziner, die in katholischen Gemeinden missionierten,481 beschrieb 1629 die Katholiken der Gemeinde Rueun als »sehr kalt und ignorant in Dingen, die die Seele und den heiligen Glauben betreffen«; ihre »Zeremonien« seien »sehr derb«.482 Der Missionsvorsteher Ignazio da Casigno wiederum argumentierte, die mit »Italien« benachbarte Talschaft Oberhalbstein bedürfe nicht nur besonderer Aufmerksamkeit, weil sich dort bereits einige Protestanten niedergelassen hätten (Bivio), sondern vor allem auch »wegen der Kälte der katholischen Bevölkerung«483. Und in einem Missionsbericht von 1681 ist zu lesen, die Bewohner von Mulegns (Oberhalbstein) und Cumbel (Val Lumnezia) seien vor der Einführung der Kapuzinermission ignorant, »wild«484 und »bäuerlich«485 gewesen. Ausgehend von der Beobachtung, wie karg, kalt und wild die Lebenswelt im Alpenraum ist,486 schlossen die Kapuziner auf eine verrohte, ungehobelte mentale Grunddisposition der Bündnerinnen und Bündner, die sie ohne entsprechende Anleitung unempfänglich für Herzens- und Glaubensangelegenheiten macht und sie im Eifer für die katholische Konfession hemmt. Welche empirische Evidenz lag dieser Schlussfolgerung zugrunde?
Erstens stellten die Kapuziner mit Befremden fest, dass die Katholiken in den Drei Bünden einen ganz alltäglichen und unbeschwerten Umgang mit den Protestanten pflegten. Es gab gemischtkonfessionelle Ehen, Dienstverhältnisse zwischen Katholiken und Protestanten waren gängige Praxis487 und gelegentlich wurden Schulen und sogar Gottesdienste488 gemeinsam besucht. Wie Pater Stefano da Gubbio vermutete, war diese »konfessionelle Indifferenz«489 nicht allein dem Pragmatismus des Alltags verschuldet. Vielmehr stecke dahinter die von vielen Bündner Katholiken geteilte Überzeugung, »dass ein jeder in seinem eigenen Glauben Heil finden kann und dass folglich auch der evangelische so gut ist wie der katholische«490. Dies widerspreche, so Pater Stefano, der römisch-katholischen Lehrmeinung und sei insofern als schismatisch oder sogar als häretisch einzustufen.
Zweitens beobachteten die Missionare, dass das kirchliche Leben der Katholiken sich mehrheitlich auf die Sonn- und Festtage beschränkte, wobei selbst an diesen Tagen die Glaubenspraxis gegenüber den weltlichen Vergnügungen in den Gasthäusern, Tanzsälen und Spielstuben offenbar in den Hintergrund rückte.491 Als ungenügend erschienen den Kapuzinern außerdem die Beichtpraxis – das Bußsakrament werde oft nur einmal im Jahr empfangen und dies gleichzeitig mit vielen anderen Personen (Kollektivbeichte) – sowie die Einhaltung des Fastengebots.492 Diese Kritik an der ungenügenden Glaubenspraxis ist nichts spezifisch Bündnerisches, ja nicht einmal eine katholische Besonderheit,493 sondern gängiger Topos in einer Zeit, in der sowohl kirchliche als auch weltliche Obrigkeiten auf eine konfessionelle Disziplinierung der Bevölkerung drängten. Dennoch schien den Kapuzinern besonders ein in den Drei Bünden vorgefundener Zustand augenfällig und so befremdlich, dass sie von einem »Schisma« sprachen: die ungenügende Betonung des Sakralen sowohl von Kirchengebäuden als auch von religiösen Handlungen.494 In den Missionsberichten gingen sie deshalb ausführlich darauf ein. Ein entsprechender Eintrag zu Rueun – wo die Kapuziner, wie bereits geschildert, auf »ignorante« und im Glaubenseifer »erkaltete« Katholiken trafen – zeigt, was sie diesbezüglich anprangerten: Es habe weder Leuchter noch Tabernakel, weder Weihrauchfässer noch metallene Kerzenständer gegeben, weder eine Pyxis (Gefäß zur Aufbewahrung der Hostien) noch einen Baldachin für das Allerheiligste; letzteres sei in einer Mauer eingeschlossen gewesen. Vespern und Litaneien seien keine gesungen worden; Weihrauch habe man keinen verwendet.495 In Tomils wiederum bemängelten die Kapuziner neben dem Fehlen von Kerzen auf den Altären in erster Linie die schmutzigen, abgenutzten und zerrissenen Messtextilien.496 Alle diese Zustände waren aus Sicht der Kapuziner beklagenswert, weil sie verhinderten, dass die kirchlich-liturgische Handlung als ein sakraler Vorgang erscheinen konnte. Denn augenscheinlich offenbarte sich das Göttliche in sauberen, von Gold und Silber glänzenden, mit Kerzen erleuchteten und mit Bildern und Ornamenten geschmückten Kirchen, nicht in düsteren, dreckigen und nur allzu profanen Räumlichkeiten. In Anbetracht des konstatierten Mangels an brauchbaren liturgischen Textilien und Geräten, ja insgesamt an Gotteshäusern, die diesen Namen auch wirklich verdienten, lag für die Kapuziner der Schluss nahe, dass der Gottesdienst (Culto di Dio) im katholischen Sinne – verstanden als liturgischer Rahmen für die Spendung des Altarsakraments – überhaupt erst im Zuge der rätischen Kapuzinermission eingeführt wurde.497
Auch andere Wesenselemente des katholischen Glaubens fanden die Missionare ihrer Meinung nach bei den Bündner Katholiken nur in rudimentärer Weise vor, so etwa die Heiligenverehrung: »Warum sind die meisten Altäre der Heiligen weniger reich [ausgestattet] als eure Betten, ihre Reliquien weniger kostbar als eure Kleider«498, fragte etwa der Missionar Gabriele Maria da Brescia noch im 18. Jahrhundert in einer seiner Predigten. Zwar stehe die Verehrung Gottes über jeder anderen, doch habe Gott durch die Kirche die Heiligen als Vermittler seines Willens eingesetzt.499 Aber statt auf eine in diesem Sinne gerechtfertigte Popularität der Heiligenverehrung stießen die Kapuziner im rätischen Alpenraum auf eigentümliche Devotionsformen, die insofern Ähnlichkeiten mit dem Heiligenkult aufwiesen, als sie ebenfalls den Grundgedanken der Interzession – das heißt die Vermittlung jenseitiger Hilfe – kannten: die Fürbitten bei den Seelen verstorbener Angehöriger. Pater Stefano da Gubbio wusste zu berichten, dass die Bündner Katholiken bei Krankheiten, Viehseuchen oder anderen Unglücken Messen für die Seelen der verstorbenen Angehörigen lesen lassen und sich so Hilfe aus dem Jenseits erhoffen. Zudem beteten sie vor und nach jedem Kirchenbesuch an den Gräbern ihrer Verwandten. Eine derart große, beinahe den Heiligen gleichgestellte Verehrung der Toten kannte der Kapuziner aus Italien offenbar nicht, denn er bezeichnete sie und der ganze Kult um die Seelen der Verstorbenen als »deutsche« Eigenart.500 Überhaupt sei der Glaube an die »armen Seelen« bei den Bündner Katholiken sehr ausgeprägt. Einer frommen Katholikin aus Riom, so erzählt Pater Stefano, sei die Seele ihres kürzlich verstorbenen Mannes erschienen und habe ihr mitgeteilt, dass er, ihr Ehemann, dank der für ihn gelesenen Seelenmessen bereits einen Teil der zeitlichen Sündenstrafe verbüßt habe. Bemerkenswert war dies laut Pater Stefano deshalb, weil die Frau nicht habe wissen können, dass die Kapuziner die Seelenmesse für den Verstorbenen bereits gelesen hatten. Nach dem Dreißigsten sei ihr der verstorbene Ehemann nochmals erschienen, diesmal aber mit einem blütenweißen Gewand, und habe ihr mitgeteilt, dass er sich nun endgültig verabschieden müsse. Und in der Tat sei der Geist des Verstorbenen in der Folge nie mehr aufgetaucht. Wie Jacques Le Goff zeigen konnte, waren solche Erscheinungsgeschichten im Mittelalter weit verbreitet und existierten parallel zur neu aufkommenden Vorstellung des Fegefeuers als Ort der reinigenden Buße zwischen Himmel und Hölle.501 Damit verbunden waren vielfältige Praktiken der Fürbitte, von Seelenmessen über Gebete bis hin zu Almosen, mit denen die noch Lebenden die Aufenthaltszeit der verstorbenen Angehörigen im Fegefeuer vermindern konnten (siehe Abb. 29). Das Konzil von Trient bekräftigte sowohl diese Fürsprachepraxis – sofern sie kirchengebunden war – als auch die Existenz des Fegefeuers als im Jenseits lokalisierbarer Reinigungsort.502 Nur bedingt damit vereinbar waren die im ganzen Alpenraum omnipräsenten Vorstellungen, dass die »armen Seelen« auf der Erde büßend umherwandeln und den Lebenden unter Umständen Unglück und sogar den Tod bringen konnten.503 Ebenso lebten auch nach dem Konzil von Trient nicht-kirchenkonforme Fürsprachepraktiken fort, wie zum Beispiel das Einstreuen von Salz ins Feuer,504 mit dem man den »armen Seelen« eine Wohltat erweisen wollte. Weil solche Praktiken und Glaubensvorstellungen auf Verfechter nachtridentinischer Frömmigkeitsideale befremdlich wirkten, versuchten Akteure wie Stefano da Gubbio diese lokale Glaubenswelt mit geradezu ethnologischer Akribie zu beschreiben und zu verstehen. Denn schließlich war es für Pater Stefano und seine Missionsgefährten von ganz praktischer Relevanz zu wissen, welche religiösen Bräuche, lokalspezifischen Glaubensvorstellungen und Heilsbedürfnisse bei den Katholiken existierten. Konnten so nämlich »Missbräuche« und »Irrtümer« in Glaubensdingen aufgedeckt werden, so ließ sich damit die zunächst von der Kongregation de Propaganda Fide anfänglich nicht vorgesehene Mission in katholischen Territorien rechtfertigen.
Um aus der Beschäftigung mit den lokalen Glaubenswelten eine adäquate Missionsstrategie ableiten zu können, bedurfte es einer genauen Vorstellung von den Ursachen für die bei den Bündner Katholiken angeblich entdeckten »Missstände« oder »Irrtümer«. Als wichtigster Grund wurde vielfach die mangelnde Betreuung der Katholiken durch qualifizierte Seelsorger genannt.505 Ohne eine solche seien die Menschen »begraben in der Dunkelheit der Ignoranz, welche das lumen naturale«, das Licht der Vernunft, verdränge, sodass »die meisten nicht zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse, zwischen Glauben und Häresie zu unterscheiden wüssten«, hieß es in einem Missionsbericht von 1681.506 Die Kapuziner verstanden sich als Bringer dieses »Lichts«. Sie gedachten, die Katholiken mit Predigten und Christenlehre, mit Bruderschaften und Kirchenbau, mit Sakramentalien und Exorzismen auf den rechten Weg zu führen. Ein anderer Grund für die rudimentäre und »fehlerhafte« Glaubenspraxis der Bündner Katholiken sah Nuntius Federico Borromeo in der naturbedingten Armut der Talschaften und in der damit zusammenhängenden Arbeitsmigration. Viele Bewohner des Misox müssten sich ein Auskommen als Händler und Dienstboten in protestantischen Ländern suchen, so Borromeo. Die meiste Zeit des Jahres seien sie unter »Häretikern«, weshalb sich – mehr aus Einfalt denn aus böser Absicht – »Fehler« in Sachen des Glaubens einschleichen würden.507 Wie die Christenlehre oder der Bau von Kirchen und Kapellen gehörte somit auch der Kampf gegen die Armut zur Aufgabe der innerkatholischen Mission.508 Führten alle diese Anstrengungen der Missionare letztlich zum Erfolg? Oder präziser gefragt: Inwieweit veränderte sich die Wahrnehmung des Bündner Katholizismus im Gefolge der Mission?
Es gebe unter den Bündner Katholiken weder Fehler noch Missbräuche, antwortete der Brescianer Kapuzinerprovinzial 1745 auf die in der Missionsenquête gestellte Frage nach den »Riten, Fehlern und Missbräuchen«509. Vom 17. zum 18. Jahrhundert hatte sich die Wahrnehmung des Bündner Katholizismus damit grundlegend gewandelt. In vielen Missionsberichten seit Mitte des 17. Jahrhunderts betonte man eindringlich, dass die Kapuziner die Bündner zu frommen, eifrigen und kirchenkonformen Gläubigen erzogen hätten – von »Schismatikern« konnte aus Sicht der Kapuziner nun keine Rede mehr sein. Topoi wie »schismatische« oder »fehlerhafte« Katholiken sind folglich stets auch als Negativfolie zu deuten, vor der sich der Erfolg der Mission umso deutlicher abhob. Gleichwohl wäre es unzutreffend, ihren Gebrauch allein im Umfeld von reformorientierten Akteuren der Kirche zu verorten. Wie das nächste Kapitel (2.4.) zeigen wird, verstanden es die des »Schisma« und der »Missbräuche« bezichtigten Bündner sehr wohl, diese Vorwürfe situativ als Argumente zur Erreichung der eigenen Ziele einzusetzen. Vorher soll aber nochmals einen Überblick über die bisherigen Befunde gegeben werden.