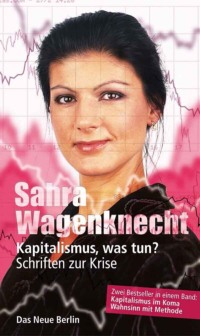Kitabı oku: «Kapitalismus, was tun?», sayfa 5
18. Januar 2003
Voodoo-Ökonomie
»Voodoo-Ökonomie« sei das, was Eichel betreibe, donnerte der wahlkampfgestresste niedersächsische Noch-Ministerpräsident Gabriel dieser Tage gegen seinen Parteikollegen im Finanzministerium. Auf Eichels Pfaden sei das Ziel, bis 2006 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, nimmer erreichbar, erläuterte er dem Tagesspiegel. Wo der Mann recht hat, hat er recht. Ob allerdings die von Gabriel angeregte Abschaffung des Branntweinmonopols – Einsparbetrag maximal 100 Millionen Euro – Eichel seinem Ziel wesentlich näher brächte, darf bezweifelt werden. Allein die Wiedereinführung der Vermögenssteuer würde das mehr als Hundertfache bringen. Aber da diese Steuer seit des Kanzlers Rüffel auch für Gabriel tabu ist, quält er in Wiederwahlnot seinen und seiner Mitarbeiter Köpfe mit dem Aufspüren von »ungenutzten sinnvollen Einsparpotenzialen« (Gabriel), die Konzernbossen und Geldadel nicht wehtun, ihm, Gabriel, aber auch nicht noch den letzten Arbeitslosen als Wähler verprellen. Der Branntwein-Vorschlag zeigt, was bei derlei Gedankenakrobatik herauskommt.
Eichel wird die Pöbelei von der halblinken Flanke mit Fassung ertragen haben, denn es kann ausgeschlossen werden, dass er selbst noch ernsthaft an die Ziellinie 2006 glaubt. Weshalb auch? Ursprünglich – formuliert im sogenannten europäischen Stabilitätspakt – hatte sich die Auflage, die öffentlichen Neuverschuldung auf Null zu senken, auf das Jahr 2002 bezogen. Als klar wurde, dass dies an der Realität der europäischen Länder vorbeiging, wurde auf 2004 verschoben.
Im Herbst 2002 sprach sich erneut bis Brüssel herum, dass Deutschland, Frankreich, Italien und Portugal unverändert tief in den Miesen stecken. Also beschloss die EU-Kommission, die Frist bis 2006 zu verlängern. Es gab ein bisschen Gezänk, aber die Entscheidung stand nie wirklich in Frage. Alles spricht dafür, dass die gleiche Kommission im Herbst 2004 wieder tagen und wieder verlängern wird – so es den Pakt bis dahin überhaupt noch gibt.
Es wäre allerdings ein Fehler, diese Taktik als Schwäche des Neoliberalismus zu werten. Bezogen auf das Konsolidierungsdogma gilt ausnahmsweise der alte Bernstein wirklich: Der Weg ist das Ziel. Es interessiert das Kapital herzlich wenig, ob die öffentlichen Haushalte dieser Welt hoch oder niedrig verschuldet sind. Der einzig interessierende Punkt ist, ob sie ihren Zins- und Tilgungspflichten nachkommen können. Ob dies bei Fortsetzung der alten Schuldenpolitik für einige europäische Länder mit Einführung des Euro (der die Möglichkeit, Zahlungen notfalls durch Ingangsetzen der nationalen Notenpresse zu leisten, ausschließt) hätte schwierig werden können, mag strittig sein. Inzwischen steht es für kein Land im Euroraum mehr infrage.
Noch mehr als die allgemeine Zahlungsfähigkeit interessierte das europäische Kapital zu Beginn der Neunziger, als die Gemeinschaftswährung ausgeheckt wurde, allerdings ein anderer Punkt: Die Verbesserung seiner Verwertungsbedingungen. Denn in seinen Augen hatten die westeuropäischen Staaten zu Kalten Kriegszeiten erheblichen Sozialspeck angesetzt – also Dinge wie Kündigungsschutzbestimmungen, Mindestlöhne, kostenlose Bildung und Gesundheitsversorgung, Zahlungen an Arbeitslose, Sozialhilfe usw. – und dieser »Speck« war nach dem Ende der Systemkonkurrenz unter Profitgesichtspunkten überflüssig geworden.
Eine Politik indes, die sich der Ausrottung all dessen verschrieb, war aus naheliegenden Gründen unpopulär und daher nicht leicht durchsetzbar. Der tiefere Sinn von Maastricht-Kriterien und Stabilitätspakt bestand also darin, den europäischen Regierungen, die ja alle immer irgendwann wiedergewählt werden wollen, die Umsetzung zu erleichtern. Dank der Verträge von Maastricht und Amsterdam konnten sie bei jeder sozialen Brutalität auf einen Buhmann in Brüssel verweisen, der sie – womöglich gegen ihren Willen – zu derartigen Missetaten zwang. Auch wenn es mit der Wiederwahl in vielen Fällen dennoch nicht geklappt hat, hinsichtlich der Missetaten war der Stabilitätspakt europaweit außerordentlich erfolgreich. Wenn er morgen aufgekündigt wird, dann, weil sein eigentliches Ziel in den meisten Ländern erreicht ist.
In einer rezessiven Lage wie der jetzigen ist die Wahl zwischen der Weiterführung prozyklischer Rotstiftpolitik, die den Unternehmen die letzten Absatzmöglichkeiten ruinieren könnte, und laxerer Handhabe des Verschuldungsdogmas, was dann allerdings auch drakonische Sozialkürzungen nicht mehr gut begründbar macht, aus Sicht der Renditejäger ohnehin eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Es ist keine Frage des sozialen Gewissens, sondern eine des Profitkalküls, auf welche Seite man sich dabei schlägt.
So hofft etwa Jürgen Michels von der Citygroup sogar (zumindest für Deutschland) auf eine Verschärfung der Wirtschaftskrise, da alles andere »die unumgänglichen Strukturreformen« nur wieder vertagen würde: »Die kommen nur, wenn es richtig weh tut«, ließ er sich im Handelsblatt zitieren. Auch der Europa-Chefvolkswirt von Morgan Stanley, Joachim Fels, plädiert ausdrücklich gegen eine konjunkturfördernde Zinssenkung der Europäischen Zentralbank, weil, wie er meint, »zur Disziplinierung der Gewerkschaften eine Rezession nötig« sei. Wenig von solcher Position hält dagegen Daval Joshi, globaler Aktienstratege von Société Générale, der feststellt, dass Absatzprobleme die Kostensenkungen in vielen Unternehmen längst überkompensiert haben. Denn: »In Kontinentaleuropa ist das Beschäftigungs- und Lohnwachstum die Haupttriebkraft für den privaten Konsum.« Aus dieser Ecke kommen offenbar auch die Berater des französischen Finanzministers Francis Mer, der den kürzlich angezeigten blauen Brief aus Brüssel mit der höflichen Bemerkung abtat, sein Land habe eben »beim Sparen einen anderen Rhythmus«. Das war die diplomatische Umschreibung dafür, dass er keineswegs – wie von Brüssel angemahnt – das Haushaltsdefizit in diesem Jahr um 0,5 Prozent zu senken beabsichtigt und auch für 2006 ein Defizit im französischen Staatshaushalt erwartet.
EU-Wirtschaftskommissar Solbes reagierte darauf, wie er es seit Jahren gelernt hat, nämlich mit Verweis auf Frankreichs nötigen Beitrag, »damit das Vertrauen in den Euro erhalten bleibt und gestärkt wird«. Das Problem ist nur: Seit der Euro unaufhaltsam aufwertet, hätte die europäische Exportindustrie gar nichts mehr dagegen, wenn das »Vertrauen« wieder ein wenig schwächer würde. Es könnte daher passieren, dass Eichels und Schröders »Vodoo-Ökonomie« bald von seinen konservativen Kollegen im Nachbarland ausgebremst wird.
1. Februar 2002
Kurzzeitgedächtnis
Wenn die Konjunktur boomt und mit ihr die Rendite, wird die ökonomische Theorie zum Tummelplatz jener besonders dumpfen Sorte von Marktapologeten, die sich durch ein wissenschaftliches Alzheimer-Syndrom, will heißen: die Abwesenheit von Erinnerungsvermögen auszeichnen. In der Krise dagegen, in die die entfesselten Marktkräfte verlässlich nach gewisser Zeit führen, erhalten wieder jene Rückenwind, die den Kapital-Gesandten im politischen Geschäft genau das vorwerfen, was ihnen zuvor abverlangt wurde: Verzicht auf die Steuerung des betriebswirtschaftlichen Profitkalküls zwecks Erhalt der gesamtwirtschaftlichen Stabilität.
Dieselbe Debatte findet derzeit in den USA auf der Ebene einer Auseinandersetzung über Ziele und Methoden von Zentralbankpolitik statt. Mit der Spekulationsblase an den Aktienbörsen ist auch jener Mythos geplatzt, der den Namen Alan Greenspan trug. Der umjubelte Held der »Goldenen Neunziger«, auf dessen »glückliche Hand« mancher Wall-Street-Yuppie nicht nur eine Flasche Champagner gelehrt haben dürfte, damals, als die Kurse stiegen und stiegen und man mit etwas Glück in Tagen, ja Stunden Millionen verdienen konnte – Greenspan sieht sich inzwischen mit dem Vorwurf attackiert, er habe die Exzesse an den Finanzmärkten zu lange hingenommen, ohne angemessen zu reagieren. Vorgetragen wird dieser Vorwurf nicht von irgendwem, sondern von namhaften amerikanischen Ökonomen, und auch nicht irgendwo, sondern in den Top-Spalten der renommierten amerikanischen Wirtschaftspresse.
Zwar wird eingeräumt, dass der amerikanische Zentralbanker immerhin bereits im Dezember 1996 vor einem »irrationalen Überschwang« gewarnt hatte; der Warnung aber – so die Kritiker – seien keine Taten gefolgt. Im Gegenteil, nach der minimalen Zinserhöhung im März 1997 habe Greenspan nur ein Jahr später, als die Aktienmärkte infolge von Asien- und Russlandkrise und nach dem Beinahezusammenbruch des amerikanischen LTCM-Hedge-Fonds das erste Mal ins Taumeln gerieten, sein Liquiditätsfüllhorn wieder generös geöffnet. So konnte die Börsenparty weitergehen und von ihr gesponsert lebte die Reichtums-Illusion der amerikanischen Mittelklasse fort, die sich unverzagt in Konsum und Schulden stürzte, was neben den börseninduzierten virtuellen auch die realen Gewinne von Unternehmen und Banken auf lichte Höhen trieb. Im Januar 2000 erreichte der Dow Jones seinen Gipfel mit einem Wert von 11 722 Punkten. Seitdem geht es abwärts: in der virtual reality der Börsen wie in der realen Wirtschaft und mit Greenspans Ansehen.
Es ist durchaus wahrscheinlich, dass eine kräftige Zinserhöhung der Fed im Sommer 1998 den ganzen Spuk bereits zwei Jahre früher beendet hätte. Unwahrscheinlich ist, dass die folgende Weltwirtschaftskrise milder ausgefallen wäre als sie jetzt droht. Und noch unwahrscheinlicher ist, dass ein Zentralbanker eine solche Entscheidung im Amt überlebt hätte. Nicht nur eine gewisse Sorte Ökonomen, der ganze Kapitalismus lebt vom Kurzzeitgedächtnis. Jeder nur etwas anhaltende Aufschwung wird zur »New Era« erklärt, die nie wieder endet, weil diesmal alles ganz anders ist. Und wehe dem, der diese Scheinwelt stört, solange sich in ihr gut Geld verdienen lässt. Jeder Crash wird folgerichtig mit dem gleichen verblüfften Entsetzen quittiert, das bald darauf in die wütende Suche nach Schuldigen umschlägt.
Die Vorwürfe gegen Greenspan gehören ebenso in diese Rubrik wie der öffentliche Pranger für frühere »Star-Analysten« großer amerikanischer Investmentbanken, der die unangenehme Bekanntschaft mit US-Staatsanwälten inzwischen einschließt. Natürlich haben diese Analysten gelogen, natürlich haben sie, in vielen Fällen wissentlich, Tausenden Kleinsparern Aktien von Beinahe-Pleite-Unternehmen als hochlukrative Anlage aufgeschwatzt. Aber das war der Job, für den sie bezahlt wurden. Die öffentlich agierende Analystenzunft an der Wall Street war nie etwas anderes als die Werbekolonne der bankinternen Investment-Abteilung, und ein Blick auf die Hierarchie der Geschäftsbereiche hätte genügt, um bereits vor drei Jahren zu wissen, dass es so war.
Aber nicht jene Analysten und nicht Greenspan haben die Amerikaner um ihre Spargelder und ihre Alterssicherung gebracht, sondern diejenigen, die die öffentlichen Sicherungssysteme auf jenes armselige Niveau herunterdrückten, das private Vorsorge unerbittlich erzwingt. Und der Keim für die jetzige Krise liegt nicht in falscher Zinspolitik, sondern in jenen Hundelöhnen, die während des gesamten angeblichen »Booms« am unteren Ende gezahlt werden konnten, weil eine nach fünf Jahren auslaufende Sozialhilfe immer mehr Menschen zwang, den Job trotzdem anzunehmen. Verwunderlich ist nicht der jetzige Zustand der US-Wirtschaft, sondern allenfalls die lange Zeitspanne, in der trotz massivster Einkommensumverteilung von unten nach oben das Desaster hinausgeschoben werden konnte.
Bush schreibt mit dem geplanten Steuersenkungspaket im Volumen von 674 Milliarden Dollar, deren Nutznießer nahezu ausschließlich der reichen Oberschicht angehören, diesen Trend fort. Außerdem bewirkt ein Wegfall öffentlicher Einnahmen in dieser Größenordnung bei gleichzeitig exorbitant steigenden Militärausgaben naturgemäß tiefrote Zahlen im öffentlichen Haushalt, also steigenden staatlichen Kapitalbedarf, der die Renditen am privaten Kapitalmarkt wieder nach oben treiben wird. Ein schwacher Dollar und ein täglich mit mehreren Milliarden zu finanzierendes Leistungsbilanzdefizit wirken ebenfalls in diese Richtung. Mögliche kriegsbedingte Inflation und ein hoher Ölpreis dürften das ihre dazu beitragen, die Fed unter Druck zu setzen, auch die offizielle Zinsschraube wieder nach oben zu drehen, was angesichts des riesigen Schuldenbergs amerikanischer Verbraucher und Unternehmen den verbliebenen Resten ziviler Wirtschaftsaktivität in den Vereinigten Staaten den Todesstoß versetzen kann. Vielleicht, um dann nicht wieder der Buhmann zu sein, hat Greenspan Bushs Pläne dieser Tage öffentlich kritisiert und auf die Folgen hingewiesen. Helfen wird es ihm wenig. Der Kapitalismus hat halt ein Kurzzeitgedächtnis.
15. Februar 2003
Wirtschaftskrieg
Die Demütigung sitzt tief; man schweigt verstimmt. Die Rating-Agentur Standard & Poor’s hat die Kreditwürdigkeit des Stahlkonzerns Thyssen-Krupp auf Junk-Bond-Niveau herabgestuft. Junk Bonds – zu deutsch: Schrott- bzw. Ramsch-Anleihen – begeben in der Regel Firmen mit zweifelhaftem Finanzgebaren, schwer durchschaubarem Geschäftsmodell und überbordenden Schulden, auf deren Fortexistenz man besser nichts verwetten sollte; auch einige Dritte-Welt-Staaten (insbesondere solche mit der sympathischen Eigenheit, Zinszahlungen auf ihre Schulden zuweilen auszusetzen) finden sich in dieser Rating-Rubrik. Gekauft werden derartige Papiere in der Regel von Hedgefonds und anderen Spekulations-Liebhabern, die versuchen, ihr Auf und Ab in schnelle Gewinne umzumünzen. Wer eher langfristige Kuponabschneiderei im Sinn hat, lässt die Finger davon; Versicherungen und Pensionsfonds ist es in vielen Ländern gesetzlich untersagt, das Geld ihrer Anleger für derlei Zeug zu verausgaben. In dieser Gesellschaft befindet sich also jetzt der vor wenigen Jahren fusionierte Traditionskonzern Thyssen-Krupp, Mitte des letzten Jahrhunderts eine der Machtbasen des deutschen Imperialismus, rühriger Hitler-Finanzier, Antreiber wie Profiteur des Weltkriegs-Kurses – und jetzt ein Schrott-Bond, welche Erniedrigung!
Sicher, Herabstufungen der Kreditwürdigkeit sind in Krisenzeiten nicht selten. Allein 2002 verloren 25 Unternehmen ihren »Investitionsstatus«, darunter elf europäische. Die Folgen für die Beschäftigten sind in der Regel fatal, denn ein Unternehmen, über das das Rating Duopol aus Moddy’s und S & P den Daumen senkt, gerät in einen Kreislauf rigider Sparprogramme, rüder Entlassungswellen und oft genug dennoch weiter wachsender Schulden. Am Ende steht nicht selten die Insolvenz. »Gefallene Engel« – so heißen die Ramsch-Unternehmen in der zartfühlenden Sprache der Börsenhaie – werden meist innerhalb eines Jahres noch einmal herabgestuft. Beispiele, in denen der ursprüngliche Status zurückerobert werden konnte, gibt es kaum. Der Grund liegt einfach darin, dass kapitalistische Märkte immer nach dem Prinzip »Wer hat, dem wird gegeben« funktionieren. Ein guter Rating-Status ist bares Geld wert; sein Verlust bedeutet steigende Zinskosten. Für Thyssen-Krupp liegt die künftige Mehrbelastung nach eigenen Angaben bei zwanzig Millionen Euro jährlich. Um sich ein Bild zu machen: Die Zinsaufschläge von Junk-Bonds mit Ratingnoten Doppel-B (dies ist der Wert, der Thyssen-Krupp jetzt verpasst wurde) lagen Ende Oktober 2002 in den USA bei gut 10,4 Prozent; Firmen am unteren Rand der sogenannten »Investitionsklasse« müssen dagegen nur 7,4 Prozent berappen; »erstklassige Schuldner«, zu denen derzeit vor allem US-Rüstungsschmieden und Ölkonzerne gehören, zahlen unter fünf Prozent.
Die Herabstufung von Thyssen-Krupp durch S & P passt freilich in einem Punkt nicht ganz ins übliche Bild. Der Stahlriese hat seine Schulden in den letzten Jahren nicht aus-, sondern abgebaut. Stand der Konzern unmittelbar nach der Fusion mit 8,3 Milliarden Euro in der Kreide, sind davon heute nur noch 4,9 Milliarden übrig. Auch die Profite können sich sehen lassen. Der letzte Quartalsgewinn lag bei 141 Millionen Euro; die interne Kapitalverzinsung beträgt sieben Prozent. Konzernchef Schulz entrüstet sich denn auch: »Angesichts der Tatsache, dass wir unsere Verschuldung innerhalb von zwei Jahren um fast vier Milliarden Euro abgebaut haben, verstehen wir den Schritt überhaupt nicht.« Aufhänger für die Herabstufung ist eine mögliche Unterdeckung bei den Pensionsverpflichtungen von Thyssen-Krupp. Anders als bei seinem letzten Rating vor zwei Jahren behandelte S & P die Pensionsverpflichtungen des Konzerns diesmal wie normales Fremdkapital. Die künftigen Rentenansprüche der Mitarbeiter in Höhe von 7,1 Milliarden Euro wurden somit den Finanzschulden einfach hinzugerechnet, was die Relation zwischen Schulden und Eigenkapital drastisch verschlechterte. Nun muss man wissen, dass ein Spezifikum des deutschen Betriebsrentensystems gegenüber dem amerikanischen gerade darin liegt, dass viele Firmen Einzahlungen ihrer Mitarbeiter bis zur Fälligkeit als billiges Quasi-Eigenkapital nutzen und die Pensionen anschließend aus den laufenden Zahlungsüberschüssen begleichen. Im Gegensatz dazu ist auch die betriebliche Altersvorsorge in den USA in Pensionsfonds ausgelagert, die das Geld in Aktien – bevorzugt natürlich des eigenen Unternehmens – investieren. In letzterem Fall schlägt es auch formal als Eigenkapital zu Buche. In beiden Fällen hängt die Alterssicherung der Mitarbeiter am Zukunfts-Profit des Konzerns; der Unterschied ist, dass die betrieblichen Zahlungsüberschüsse in der Regel weniger heftig schwanken als der Aktienkurs, das hiesige System deshalb nicht ganz so krisenanfällig (und krisenverstärkend!) ist. Die US-Pensionsfonds weisen dank Börsencrash derzeit eine Deckungslücke von zwanzig Prozent aus.
Die Entscheidung im Falle Thyssen-Krupp ist somit keineswegs nur eine Entscheidung im Fall Thyssen-Krupp. Die 24 Industrie- und Dienstleistungsunternehmen im Dax haben Pensionsverpflichtungen im Wert von insgesamt 150 Milliarden Euro. Erfasst man diese künftig einfach als Schulden, verschlechtert sich die für den Rating-Status entscheidende Relation von Netto-Schulden zu Eigenkapital im Schnitt von eins auf 1.3. Besonders stark betroffen wären RWE, Lufthansa, Deutsche Post und MAN, von denen einige in der Tat bereits auf der S & P-Beobachtungsliste stehen.
Betriebswirtschaftlich spricht für die neue Sichtweise wenig. Dass Rating-Agenturen sich allerdings durchaus nicht nur in den höheren Sphären der Wirtschaftswissenschaft bewegen, sondern zuweilen sehr irdischen Interessen folgen, zeigte schon die Rücknahme der Bonitätsbewertung einer iranischen Staatsanleihe durch Moody’s im Frühsommer letzten Jahres, nachdem das Weiße Haus gegen die Bewertung interveniert hatte. Die vor wenigen Jahren unter Linken verbreitete These, die Globalisierung schaffe ein universell vereintes und jedenfalls nicht mehr national bzw. regional spezifische Interessen verfolgendes Weltkapital wird angesichts der aktuellen Auseinandersetzungen um den Irak-Krieg wohl Anhänger verloren haben. Der alte Lenin gilt aber nicht nur am Golf: In der Krise wird Kapital besonders kriegshungrig; und auch Wirtschaftskrieg ist eine Form von Krieg.
1. März 2003
Thatcher soft
Zu einem Betrug gehören immer mindestens zwei: einer, der die Idee hat, und einer, der darauf reinfällt. Ein Betrüger wiederum, dem es gelingt, mit ein und derselben Masche ein und dieselbe Person immer wieder aufs Neue zu leimen, hat gute Aussichten, als Angeklagter in einem Strafprozess mildernde Umstände zugebilligt zu bekommen. Immerhin hat’s der Betrogene ihm dann ausgesprochen leicht gemacht. So gesehen ist Schröder ein Betrüger von der minderschweren Sorte. Die Masche ist immer wieder die gleiche, die Adressaten überwiegend auch, und sie spielen das Spiel trotzdem unverdrossen mit.
Die Zustimmung zum Einstieg in den Ausstieg aus der paritätisch beitragsfinanzierten Rente ließen sich die Gewerkschaften 2001 abkaufen: mit Riesters Versprechen eines dubiosen »Eckrentenniveaus« von 67 Prozent im Jahr 2030. Abgesehen davon, dass die Zahl von Beginn an auf einem Rechenfehler beruhte – mit Rürup hat sie sich nun ganz erledigt und kein Mensch redet mehr davon. Der leise Tod der Umlagerente aber ist eingeläutet und kaum mehr zu stoppen. Dumm gelaufen, möchte man meinen, – aber offenbar noch längst nicht dumm genug, als dass Wiederholung ausgeschlossen wäre.
Kurz nach den Wahlen 2002 passierte das Hartz-Konzept den Bundestag, gleichfalls mit dem stolzen Segen der Gewerkschaftsspitzen, diesmal erkauft mit dem Versprechen, die Arbeitslosenhilfe nicht abzusenken und die soziale Stellung der Leiharbeiter zu verbessern. Von letzterem ist längst keine Rede mehr, und inzwischen kann auch die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum sogenannten Arbeitslosengeld II als beschlossene Sache gelten. Selbiges Arbeitslosengeld II wird allenfalls noch zehn Prozent über Sozialhilfeniveau liegen und sich ausschließlich an sogenannter »Bedürftigkeit« orientieren. Für mindestens ein Drittel der heute 1,66 Millionen Arbeitslosenhilfebezieher steht in Zukunft in jedem Fall Sozialhilfe pur an. Denn wer länger als vier Jahre arbeitslos ist, hat offenbar nach Meinung führender Sozialdemokraten seine Unverwertbarkeit im kapitalistischen Reproduktionsprozess so hinreichend unter Beweis gestellt, dass er den Arbeitsämtern nicht länger auf die Nerven gehen sollte und deshalb aufs Sozialamt abgeschoben wird. Die Zahlen zur Einsparsumme, die dieser neue brachiale Schnitt ins soziale Netz bringt, schwanken. Als Schätzung am unteren Rand kursiert ein Betrag von drei Milliarden Euro jährlich. Rechnen wir durch: Eine Kürzung um drei Milliarden ergibt bei 1,66 Millionen Betroffenen nach den kalten Regeln der Mathematik ein durchschnittliches Minus je Frau oder Mann von 1807 Euro pro Jahr. Die grausamen individuellen Folgen dieser Maßnahme lassen sich ahnen, wenn man bedenkt, dass es hier um Menschen geht, die im Schnitt kaum mehr als 600 Euro im Monat erhalten. Also wieder: dumm gelaufen.
Und es läuft immer dümmer. Inzwischen plant Schröder, die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld auf 18 oder gar 12 Monate zu reduzieren. Dies würde den Kreis der Menschen, die künftig auf besagtes Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe angewiesen sind, auf einen Schlag drastisch erhöhen und zugleich den sozialen Abstieg bei jener enorm beschleunigen, die als sogenannte »Nichtbedürftige« – weil beispielsweise der Ehepartner noch eine mittelmäßig bezahlte Arbeit hat – fürs erste überhaupt nichts mehr bekämen. Dass all diese Menschen sich dann noch viel verzweifelter als heute schon um neue Jobs bemühen werden, selbst um schlechtbezahlte und unsichere, ist nicht ein Nebeneffekt, sondern der eigentliche Sinn des Ganzen. Hans-Werner Sinn, der unermüdliche Lobbyist der Profithaie und in dieser Eigenschaft Präsident des Ifo-Instituts, nahm kein Blatt vor den Mund, als er Schröder vorab das Gerüst zur gestrigen Regierungserklärung lieferte: »Ich erwarte Vorschläge für Reformen, die den Marktkräften zum Durchbruch verhelfen. Am wichtigsten ist die Reform von Arbeitslosen- und Sozialhilfe … Die effektive Lohnuntergrenze, die in diesen Hilfen angelegt ist, muss fallen.«
Dass die Konzernlobby immer tiefere und brutalere soziale Einschnitte mit derartigem Nachdruck fordert, rührt also mitnichten aus ihrer Sorge um die Staatsfinanzen, zu denen sie als Steuerzahler eh kaum noch beiträgt. Es rührt zum einen aus ihrem Interesse, die Beitragssätze zur Sozialversicherung, die wie die Nettolöhne auf der Sollseite der Unternehmensbilanz zu Buche schlagen, nach unten zu drücken. Vor allem aber rühren die Forderungen aus ihrem Wunsch nach genereller Absenkung des Lohnniveaus und Etablierung billigster Hire-and-Fire-Jobs in beliebiger Zahl. Tarifverträge muss man dann nicht mehr infrage stellen. Sie erledigen sich.
Schröders diesbezügliche Pläne, verbunden mit der Aufweichung des Kündigungsschutzes und der geplanten Privatisierung von Leistungen im Gesundheitssystem, stellen einen derart rigiden Schnitt in das bisherige Gefüge des bundesdeutschen Sozialsystems dar, das sämtliche Kürzungen der Ära Kohl daneben als Marginalie verblassen. Gewerkschaften, die ihren Sinn und Anspruch ernst nähmen, müssten zur größtmöglichen Gegenwehr mobilisieren, ehe ihnen der Boden ganz unter den Füßen weggezogen wird. Doch was passiert?
Guido Westerwelle hat wiedermal nichts begriffen. Die bundesdeutsche Kapitallobby braucht keine Lady Thatcher. Schröder und Sommer im Verbund tun’s auch.
15. März 2003
Deflationsgefahren
Wer gerade seine Wochenendeinkäufe erledigt, eine Tankstelle aufgesucht oder in einem Restaurant die DM-kompatible Preisliste studiert hat, mag Ökonomen, die – und zwar zunehmend lauter – vor Deflationsgefahren warnen, einfach nur für weltfremde Idioten halten. Aber so berechtigt dieses Verdikt für viele Bereiche der Mainstream-Ökonomie sein mag, in dieser Frage stimmt es nicht.
Tatsächlich galt Deflation jahrzehntelang als für die Entwicklung kapitalistischer Wirtschaften obsolet gewordenes Phänomen. Während vor dem Zweiten Weltkrieg nahezu jede Krise von fallenden Preise begleitet wurde, die sie ihrerseits verstärkten – eine Rückkopplung, die in der Weltwirtschaftskrise nach 1929 ihre bisher zerstörerischste, aber auch für lange Zeit letztmalige Dynamik entfaltete, stiegen die Preise in den Krisen der Nachkriegszeit in der Regel unverdrossen weiter, am krassesten in den siebziger Jahren. Damals wurde der Begriff der Stagflation geboren. Theoretische Erklärungen dieser neuen Erscheinung wurden gesucht und von unterschiedlicher ökonomischer Warte aus angeboten. Tatsächlich gab es Gründe für die Annahme, dass das Preisniveau im Spätkapitalismus nur noch eine Richtung – die nach oben – kennt. Dafür sprach vor allem die enorme wirtschaftliche Konzentration in den Kernbereichen der westlichen Ökonomien. Konzerne, die über hinreichende Marktmacht verfügen, um auf Nachfragerückgänge statt durch Preisnachlässe durch Verknappung des Angebots reagieren zu können, werden vermutlich diesen Weg wählen. Seit Aufhebung des Goldstandards gibt es zudem keinen im Wertgesetz verankerten Zusammenhang zwischen volkswirtschaftlicher Produktivität und Preisniveau mehr.
All das gilt heute wie vor dreißig Jahren. Die sogenannte Globalisierung – die ja in erster Linie darin bestand, Konzerne über Megafusionen in riesige Global Player zu verwandeln, fit zur Ausbeutung aller ausbeutbaren Ressourcen dieser Welt – hat die Macht über Märkte und Staaten eher noch verstärkt. Wenn der Chef des weltgrößten Stahlproduzenten Arcelor, Guy Dollé, dem Handelsblatt die Strategie seines Konzerns mit den Worten erläutert: »Was mir aber Sorge macht, sind die schwache Nachfrage und die starke Aufwertung des Euros … Deshalb fahren wir schon jetzt unsere Produktion um fünf Prozent im Flachstahl zurück, mit dem Ziel, die Preise besser zu kontrollieren«, spricht er für viele und erübrigt einen Kommentar.
Dass Deflation dennoch alles andere als ein Gespenst aus alten Tagen ist, zeigt das Beispiel Japan. Seitdem Ende der Achtziger jene gewaltige Spekulationsblase, die sich in den Jahren des japanischen »Wirtschaftswunders« auf dem Aktien- wie Immobilienmarkt aufgeblasen hatte, geplatzt ist, lebt das Land im Würgegriff einer Dauerdepression, die durch anhaltende Preisniveausenkungen verstärkt und verschlimmert wird. Die Arbeitslosigkeit, die Japans Wirtschaft vorher kaum kannte, ist erheblich angestiegen, die Einkommen sinken – und zwar überwiegend schneller als die Preise. Die Banken wälzen Abermilliarden fauler Kredite vor sich her; ohne Sozialisierung eines erheblichen Teils der Verluste wäre das japanische Finanzsystem längst kollabiert.
Marktmacht und Preisverfall schließen sich offenkundig doch nicht aus. Ein Grund dürfte sein: Marktbeherrschende Konzerne besitzen nicht nur als Anbieter, sondern auch als Nachfrager gegenüber ihren Zulieferern erhebliches Druckpotenzial, und letzteres wächst noch in der Krise. Hinzu kommt: In den USA und Europa haben zwei Jahrzehnte gewerkschaftsfeindlicher Deregulierungs- und Umverteilungspolitik dazu geführt, dass die von den Neoliberalen wortreich beklagte »Lohnrigidität nach unten« – gemeint ist, dass Nominallöhne normalerweise schwer zu senken sind – in weiten Bereichen nicht mehr existiert. Billigjobs, Outsourcing und Überstunden machen’s möglich. All das befähigt insbesondere Großunternehmen, ihre Kosten erheblich zu reduzieren, was ohne Profiteinbuße Spielräume für Preissenkungen eröffnet. Diese Situation, bei gleichzeitig extrem hoher Verschuldung von Unternehmen und Verbrauchern, enthält alle Potenziale einer Deflationsspirale.
Das Spezielle an der heutigen Lage besteht darin, dass fallenden Preisen in einigen Branchen steigende in anderen gegenüberstehen, weshalb die offizielle Inflationsrate weder das eine noch das andere ausweist. In Bereichen, in denen die Nachfrage relativ unelastisch reagiert, etwa bei Nahrungsmitteln, können unverändert hohe Preise durchgesetzt werden. Auch Öl wird zumindest solange teuer bleiben, wie der Irak den Aggressoren Widerstand entgegenzusetzen vermag. All das (wie auch die steigenden Kriegskosten, die überwiegend der US-Steuerzahler trägt) beschleunigt den Wegbruch der Nachfrage in anderen Bereichen. Auch in Europa ist zusätzlich zu allen sonstigen Problemen mit einer Aufrüstungswelle – Stichwort: Gemeinsame Europäische Außen- und Sicherheitspolitik – zu rechnen, die irgendwer bezahlen muss.
In der ökonomischen Debatte gelten Deflationen in der Regel als schwerer beherrschbar denn Inflationen. Während sich Preissteigungen durch Hochzinspolitik und Sparprogramme in der Regel erfolgreich abwürgen lassen – wenn auch um den Preis Millionen Arbeitsloser und wachsender Armut –, kann Deflationsbekämpfung mittels einer Politik des billigen Geldes leicht verpuffen, wenn die Banken sie zur Sanierung ihrer Margen nutzen und zugleich Kredite knapp und teuer halten. Sinkende Preise erhöhen den Realzins wie auch die Last der Schulden zusätzlich – der privaten wie der öffentlichen – und schränken damit fiskalpolitische Spielräume weiter ein. Dennoch: Kaum ein anderes ökonomisches Phänomen zeigt den Irrwitz der kapitalistischen Verwertungsmaschinerie und das Klasseninteresse, das die herrschende Politik lenkt, so deutlich wie deren Machtlosigkeit gegenüber Deflationen. Ein einziges zinsfrei notenbankfinanziertes Milliardenprogramm, eingesetzt zur drastischen Erhöhung von Kindergeld, Arbeitslosenunterstützung und Renten – und schon wäre jede Deflationsgefahr gebannt. Schröder freilich versucht sich lieber mit dem Gegenteil. Das Ergebnis wird nicht auf sich warten lassen.