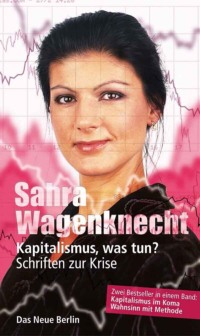Kitabı oku: «Kapitalismus, was tun?», sayfa 6
29. März 2003
Produktivitätslegenden
»Sozialdemokraten verraten ihre Ideale« grollte vor kurzem eine Tageszeitung in ihrer Titelzeile. Nun ist dieser Sachverhalt nicht ganz neu und hat sich auch leidlich herumgesprochen – seit Schröders letzter Kanzlerrede offenbar sogar bis in die Spitzen der Gewerkschaften. Auch ist der Ausspruch eigentlich ein wenig beschönigend, denn von jemandem, der bereits vor Jahrzehnten seine Großmutter erschlagen hat, in der Folgezeit seine Eltern, Onkel, Tanten und Cousins und kürzlich seine schwangere Ehefrau, würde man vermutlich auch nicht nur sagen, er pflege seine familiären Beziehungen schlecht.
Aber der vermeintliche Beistand kommt ohnehin aus ungewohnter Ecke. Unter besagter Headline – Unterüberschrift: »Niedriglohn« – veröffentlichte nämlich ausgerechnet das Handelsblatt einen langen Artikel, der die wohlbetuchte Leserklientel mit folgender Erkenntnis erschütterte: »Sie [die SPD] verraten … ihre eigene Geschichte. Die Arbeiterbewegung entstand, weil in der industriellen Revolution breite Bevölkerungskreise verarmten. Heute verarmen ebenfalls weite Bevölkerungskreise.« Was auf diese Einsicht in die kapitalistische Verteilungsproblematik folgt, ist allerdings kein Spendenaufruf nach dem Muster: »Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, seien sie großherzig, drücken Sie ihren Billiglöhnern und Leiharbeitern ab und an einen Euro extra in die Hand, sie brauchen es!«, sondern eine kurz und knappe Begründung für besagte Verarmung »weiter Bevölkerungskreise«, und diese Begründung lautet: »Weil ein schlecht gemanagter Sozialstaat den Geringqualifizierten das Recht auf Arbeit raubt.«
Wenn Zynismus eine zivilisatorische Errungenschaft ist, dann sind die Sieger des Kalten Krieges tatsächlich zivilisierter als der östliche Sozialismus es je sein konnte. Der Kapitalismus kämpft für die Freiheit der Unfreien, indem er sie mit Streubomben zerfetzt, und er kämpft für den Wohlstand der Armen, indem er ihnen noch das Letzte nimmt. Wer in dieser Gesellschaft ankommen will, muss begreifen: Wenn BDA-Chef Hundt verlangt, das Arbeitslosengeld am besten ganz zu streichen, betreibt er nicht profitmaximierende Interessenpolitik, sondern engagiert sich für das Recht auf Arbeit. Und Schröders Verantwortung für wachsende Armut rührt nicht daher, dass er soziale Leistungen mit Verve zerschlägt, sondern daher, dass er immer noch nicht alle zerschlagen hat.
Zur Begründung dieser Art von Argumenten haben Ökonomen eine eigene Theorie kreiert, die sogenannte »Grenzproduktivitätstheorie« der Verteilung. Sie wird normalerweise in hochmathematischer Verbrämung vorgetragen und basiert auf einer Reihe seltsamer Annahmen. Eine davon ist, dass bei steigender Beschäftigung die Produktivität je Beschäftigten sinkt. In der Realität einer Industriegesellschaft verhält es sich zwar in der Regel gerade umgekehrt, aber was tut‘s. Eine andere These ist, dass Unternehmen Arbeiter so lange einstellen, bis das Grenzprodukt des zuletzt Eingestellten seinem Lohn entspricht. Zusammen mit der Annahme sinkender Grenzerträge lässt sich daraus der beliebte Schluss ableiten, dass bei niedrigen Löhnen insgesamt mehr Leute Beschäftigung finden als bei hohen.
Die überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit gerade bei weniger Qualifizierten wiederum wird damit begründet, dass die »Produktivität« dieser Menschen generell niedrig sei und der durch gewerkschaftliche Tarifkämpfe festgeschriebene bzw. über das Sozialhilfeniveau faktisch gesetzte Mindestlohn oberhalb dieser »Produktivität« liege. Die heutige Form der Sozialhilfe, schimpft etwa der Handelsblättler in dem zitierten Artikel, zerstöre »den Arbeitsmarkt für Geringqualifizierte«; denn: »Ein Sozialhilfe-Empfänger wäre dumm, wenn er einen Job annähme, bei dem er weniger oder genauso viel verdient, wie ihm das Sozialamt überweist … Und ein Unternehmer wäre dumm, wenn er einem Sozialhilfeempfänger so viel bezahlen würde, dass sich für diesen das Arbeiten lohnt. Wegen dessen niedriger Produktivität würde er mehr kosten als erwirtschaften.« Auf den ersten Blick klingt das sogar schlüssig. Angenommen, ein Beschäftigter in einem Landwirtschaftsbetrieb erntet einen Monat lang Erdbeeren, die sich für insgesamt 1500 Euro verkaufen lassen; ein Softwareingenieur könnte in der gleichen Zeit ein neues Antivirenprogramm entwickeln, das 200 000 Euro Umsatz verspricht. Dann lohnt sich des Informatikers Beschäftigung selbst bei 10 000 Euro Monatseinkommen, während der Erdbeerpflücker schon bei 1500 Euro brutto nicht mehr eingestellt wird. Kann der Lohn nicht tiefer gedrückt werden, bleiben die Erdbeeren nach betriebswirtschaftlicher Logik eben ungepflanzt und ungeerntet. Für die Gesamtwirtschaft lässt sich daraus folgern: Löhne, die ein bestimmtes Limit nicht unterschreiten können, verhindern Produktion und verursachen Arbeitslosigkeit.
Tatsächlich beruht dieser Schluss auf der Suggestion, monetäre Werte würden unmittelbar und ungebrochen physische Mengenverhältnisse zum Ausdruck bringen. In Bereichen höherer Produktivität würde eben real mehr produziert als in solchen, in denen die Statistik geringere Produktivität ausweist. Aber physisch sind Erdbeeren mit Antivirenprogrammen oder auch Autos mit Telefonminuten überhaupt nicht vergleichbar. Es gibt kein einheitliches Maß und also auch kein Mehr. Was in dem angeführten Fall gemessen und verglichen wird, ist der Umsatz pro Beschäftigten. Der aber ist abhängig vom Preis des Produktes, und der Preis wiederum wird entscheidend durch die Kosten bestimmt. Hier beißt sich die Katze in den berühmten Schwanz, denn ein Teil der Kosten sind just die Löhne. Will heißen: Die statistisch gemessene Produktivität pro Beschäftigten ist in bestimmten Bereichen gerade deshalb niedrig, weil die Löhne es sind. Wird die geringe Produktivität dann wieder zum Vorwand, um den Druck auf die Löhne zu verstärken, entsteht eine Abwärtsspirale, die die Verteilungsrelation zwischen Gewinnen und Arbeitseinkommen immer stärker zugunsten der ersteren verschiebt.
Ganz nebenbei sei noch bemerkt: Auch mangelnde Qualifikation ist alles andere als das Ergebnis von Lernfaulheit oder Blödheit. Im Herbst diesen Jahres wird die Ausbildungsmisere mit voraussichtlich 100 000 fehlenden Lehrstellen einen neuen Rekord erreichen. Auch diese 100 000 jungen Menschen werden sich wohl anschließend wieder von jenen, die ihnen ihre Ausbildung vorenthalten, anhören müssen, sie seien Löhne, von denen sie halbwegs leben könnten, nicht wert.
12. April 2003
Schuldturm
Dass sich auch in der Krise glänzend Geld verdienen lässt, belegen die US-Banken, die dieser Tage ihre Quartalszahlen präsentieren. Der weltweit größte Finanzkonzern Citigroup meldet fürs erste Quartal 2003 einen Rekordprofit von 4,1 Milliarden Dollar, ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem bereits üppigen Ergebnis des gleichen Vorjahresquartals. Citigroup zählt damit zu den drei profitabelsten Unternehmen der Welt, nach dem Ölkonzern Exxon und in etwa gleichauf mit Royal Dutch / Shell. Auch die Bank of America verweist stolz auf ein Gewinnplus von elf Prozent und liegt damit im Branchentrend. Aktiencrash, Rezession, Megapleiten – anders als in der Arbeitsmarkt- oder in der Selbstmordstatistik scheinen die Unbilden des kapitalistischen Krisenzyklus in den Bilanzen US-amerikanischer Finanzhäuser kaum Spuren zu hinterlassen.
Dies sollte nicht zu dem Schluss verleiten, dass die Wirtschaftslage vielleicht doch besser ist als ihr derzeitiger Ruf. Der wahre Grund liegt vielmehr darin, dass eine schon zu Zeiten guter Konjunktur profitabel ausbeutbare Melkkuh in der Krise besonders viel Milch gibt: der verschuldete Verbraucher. Tatsächlich sind es in erster Linie seine Zahlungen, die alle sonstigen Verluste der US-Banken mehr als ausgleichen. Bereits 2002 konnte als Faustregel gelten: Je stärker eine US-Bank im Privatkundengeschäft mit Hypothekendarlehen und Kreditkarten engagiert war, desto bessere Zahlen meldete sie. Citigroup etwa verdiente im letzten Jahr 98 Prozent ihres Nettogewinns im sogenannten »globalen Massengeschäft«. Auch das Gewinnwachstum im ersten Quartal 2003 hat nahezu ausschließlich hier seine Quelle.
Kein Wunder: Bei Refinanzierungszinsen der Banken von 1,25 Prozent und einem durchschnittlichen Sollzinssatz von 14,71 Prozent für Kreditkarten ist die Gewinnmarge stattlich. Die Nachfrage ist dennoch ungebrochen, gerade weil der Durchschnittshaushalt heute in der Regel weniger Geld und daher finanzielle Sorgen hat. Aggressive Werbekampagnen, die einfaches schnelles Geld zur Sicherung des gewohnten Lebensstandards versprechen und die Kosten im Kleingedruckten verstecken, tun das ihre. Überdies nähren die Kredite mit Zins und Zinseszins ihr eigenes Wachstum: Wer die monatliche Rate nicht mehr zahlen kann, streckt, schuldet um – und zahlt am Ende noch mehr. Der Schuldendienst eines Durchschnittsamerikaners liegt heute bei 15 Prozent seines verfügbaren Einkommens, die durchschnittliche Schuldensumme übersteigt ein Jahresgehalt. Die Ausfälle infolge Überschuldung halten sich dennoch in Grenzen, weil die Kreditnehmer überwiegend der Mittelschicht entstammen, bei der selbst im Pleitefall immer noch irgendwas zu holen ist, woran die Banken sich schadlos halten können. Die menschlichen Tragödien, die dem folgen, sind der finstere Schatten jener goldgeränderten Kredit-Bilanzen, der freilich bei ihrer stolzen Präsentation keine Erwähnung fand.
Wer glaubt, diese Zustände seien eine amerikanische Spezialität, irrt. Wie der jüngste Wochenbericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung belegt, wird auch in Deutschland zunehmend auf Pump gelebt. Fast jeder vierte Privathaushalt ist heute verschuldet, vor fünf Jahren waren es erst 17 Prozent. Überproportional häufig sind Familien mit Kindern betroffen. Die gesamten Verbindlichkeiten privater Haushalte summieren sich auf mittlerweile 112 Prozent des Haushaltseinkommens und liegen damit sogar knapp über US-Niveau. Ärmere verschuldete Haushalte bringen laut DIW-Bericht heute durchschnittlich 23 Prozent ihres Einkommens für Zins und Tilgung auf.
Der Gewinn der amerikanischen Bankkonzerne rührt denn auch keineswegs nur aus dem heimischen Markt. Die Citibank etwa hat ihr Ratenkreditvolumen in Deutschland 2002 um gut zehn Prozent auf rund acht Milliarden Euro gesteigert. 1,3 Millionen Kunden löhnen dafür mit einem Zins zwischen 13 und 14 Prozent.
Der Kontrast zwischen der Geldschwemme der US-Finanzhäuser und dem Gejammer und Geächz, das derzeit aus deutschen Banktürmen dringt, könnte kaum größer sein. Eine Eigenkapitalrendite nahe Null, wenn nicht handfeste Verluste, ein jährlich um dreißig Prozent wachsender Berg fauler Kredite, 28 Milliarden Euro Rückstellungen für Risikovorsorge, Debatten über eine Bad Bank und japanische Verhältnisse … – als man vor zehn Jahren zum ganz großen Sprung in die Elite der weltweit mächtigsten Global Player des Finanzbusiness ansetzte, hatte man sich die Zukunft anders vorgestellt. Spottbillig ist die Deutsche Bank derzeit zu haben, und es findet sich noch nicht mal ein Übernahmepirat. Auch die Privatisierungsuntat des Berliner Senats scheiterte bekanntlich mangels Nachfrage.
Was ist faul? Tatsächlich bieten die deutschen Banken ein schönes Lehrbeispiel, dass Profitgier und Profitabsahnen immer noch zwei unterschiedliche Dinge sind. In dem Gefühl, zu Höherem berufen zu sein, hatten sich die großen deutschen Geldhäuser seit Mitte der Neunziger zunehmend aus dem »Massengeschäft« verabschiedet und damit genau jene Henne geschlachtet, die derzeit goldene Eier legt. Stattdessen investierten sie aberwitzige Summen in ihre internationale Expansionsstrategie und den Ausbau ihrer Investmentsparte. Statt namenlose Mittelbetriebe zu kreditieren, verpulverten sie ihr Geld bei Enron, Worldcom, Kirch und Co oder in der Spekulation mit Aktien und Derivaten. Entsprechend hoch sind heute die Verluste, die durch kaum eine profitable Sparte ausgeglichen werden.
Graue Haare dürften den verantwortlichen Managern dennoch nicht wachsen, denn die Folgen baden andere aus. Keiner weiß, wie viele der 37 700 im letzten Jahr zusammengebrochenen Firmen noch bestehen und wie viele der dort vernichteten Arbeitsplätze noch existieren könnten, wenn irgendeine Bank bereit gewesen wäre, jenen Überbrückungskredit zu gewähren, an dem oft die Existenz hing. Und lange bevor Ex-Deutsche-Bank-Chef Breuer in die Verlegenheit kommen könnte, seine Zweit- oder Drittvilla zu veräußern, wird Eichel dem noblen Finanzhaus noch jeden faulen Kredit mit Steuergeld abkaufen. Die beabsichtigte Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau zur Verbriefung vergebener Kredite dürfte – trotz gegenteiliger Beteuerungen – der erste Schritt in diese Richtung sein.
26. April 2003
Hilfstruppen
Auf die Opposition ist Verlass. Passend in die Vorbereitungsphase des SPD-Sonderparteitages hinein offerierten die Präsidien von CDU und CSU am letzten Wochenende ein gemeinsames Sozialreformpapier. Der Maßnahmekatalog, den es enthält, ist weder aufregend noch neu und lohnt die Lektüre kaum. Der tiefere Sinn des Papiers liegt ohnehin nicht in den Greueltaten, die es vorschlägt, sondern in der Generalnachricht an Schröders innerparteiliche Kritiker und an die Gewerkschaften: Leute, habt acht, es geht auch noch schlimmer!
Den Reiz dieser Strategie kannte bereits Ex-BDI-Chef Henkel, der sie einst Schröders Vorgänger angeboten hatte. Freimütig berichtet er in seiner Autobiographie über seinen Antrittsbesuch bei Helmut Kohl folgendes: »Ich wollte ihm [Kohl] erklären, dass ich immer dann, wenn er ›hundert‹ liefern könne, ›hundertfünfzig‹ fordern würde, damit er bei jenen, die nur ›fünfzig‹ anbieten, sagen könne: ›Ich habe mich ins Mittel gelegt, dies ist der Kanzlerkompromiss.‹ Damit wollte ich ihm helfen, seine Spielräume zu erweitern, und hoffte auf einen konstruktiven Gedankenaustausch.« Allerdings habe, wie Henkel bekennt, das Zusammenspiel in dieser Frage mit Kohl nicht gut funktioniert. Schröder dagegen habe den Wert solcher Kooperation sofort begriffen.
Die freundliche Morgengabe Stoiberscher Provenienz dürfte dem Kanzler überaus gelegen kommen. Immerhin hat selbst DGB-Chef Sommer bisher keine Neigung gezeigt, mit Blick auf den »Agenda 2010« genannten finalen Enthauptungsschlag gegen jegliche Sozialität im kapitalistischen Deutschland ähnlich zu Kreuze zu kriechen wie die Gewerkschaftsspitzen es im Falle Rentenreform und Hartz-Konzept getan hatten. Irgendwo scheint es doch noch Grenzen zu geben, und ob soziales Gewissen oder purer Selbsterhaltungstrieb diese diktieren, ist nicht entscheidend. Einheitlich freilich agiert der DGB in dieser Frage schon nicht mehr; IG BCE Chef Schmoldt attackiert in bewährter Rollenverteilung die noch kampfbereiten Einzelgewerkschaften Verdi und IG Metall. Auch innerhalb der SPD ist die Rettet-unsern-Kanzler-Kampagne erfolgreich angelaufen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich auf diesem Wege der Umfall auf ganzer Linie vorbereitet.
Während Henkels Motivlage leicht durchschaubar war, mag es einem naiven Beobachter seltsam erscheinen, weshalb die Union sich derart rührig um die Stabilisierung der Schröderschen Kanzlerschaft bemüht. Genau besehen erweist sie sich dadurch jedoch nur einmal mehr als guter Seismograph der Wünsche der herrschenden Klasse, die deutlich signalisiert hat, dass sie ausschließlich die SPD zur Umsetzung des von ihr geforderten Brachialkurses als machtpolitisch befähigt erachtet. Mag sein, mancher Konzernboss würde die asoziale Talfahrt gern noch ein wenig mehr beschleunigen, aber in der Richtung ist man sich einig, und spätestens seit dem 14. März nimmt man Schröder auch wieder ab, dass er diesen Kurs kompromisslos gegen die dem Profitkalkül weniger zugeneigten Genossen seiner Partei durchzusetzen gewillt ist. Das Handelsblatt registriert folgerichtig seit knapp zwei Monaten wieder abrupt steigende Sympathiewerte Schröders bei Deutschlands Managerelite, was möglicherweise dazu beiträgt, dass ihn die nicht minder abrupt fallenden SPD-Umfragewerte beim Normalvolk nur begrenzt beunruhigen.
Weil Sozialdemokraten indes traditionell schlimme Untaten nur dann mit gutem Gewissen billigen, wenn man ihnen einredet, sie hätten dadurch noch schlimmere verhindert, besteht die Tagesaufgabe darin, Schröders asozialen Super-Gau mit dem Nimbus des »kleineren Übels« zu versehen. Also wird seit einigen Wochen die Mannschaft der 150-Prozent-Forderer in Stellung gebracht: Zu ihr zählen die Verbände-Vertreter von BDA und BDI (Rogowski etwa mit seiner Forderung, das deutsche Mitbestimmungsmodell zu beseitigen), außerdem der Sachverständigenrat, der in seinem Frühjahrsgutachten die Schröder-Agenda zwar lobt, aber als unzureichend kritisiert, und jetzt eben auch CDU/CSU. Nutzbar (und daher in der Wirtschaftspresse weidlich publiziert) ist auch ein neueres Dossier des IWF, in dem Ökonomen ihren Namen für die These hergeben, das US-Modell würde Europa ein um etwa fünf Prozent höheres Wachstum bringen; entscheidend wäre dabei, den Kündigungsschutz auf US-Level zurückzuschneiden und gleiches mit dem Arbeitslosengeld zu tun.
Das Perfide an dem Schmierentheater ist, dass im Grunde jeder weiß, dass die Argumente verlogen sind, aber selbst viele der Kritiker nur von »falschen Ansätzen« statt von Interessenpolitik reden. Ein von Sommer jetzt vorgestelltes Alternativpapier zur Agenda 2010 wärmt – neben vernünftigen Forderungen – auch die Debatte um eine Mehrwertsteuererhöhung zur Senkung der Sozialabgaben wieder auf. Diese Forderung ist zum einen kaum weniger unsozial als Schröders Streichorgien, denn gerade Verbrauchssteuern treffen diejenigen am härtesten, die wenig verdienen. Zum anderen wird damit eine der Kernlügen der Kapitallobby – steigende Sozialabgaben verursachten Arbeitslosigkeit (während es sich tatsächlich gerade anders herum verhält) – indirekt akzeptiert. Dass trotz Krise und steigender »Lohnnebenkosten« immerhin zwölf Dax-Unternehmen 2003 gegenüber 2002 ihre Dividenden erhöhen konnten – nicht wenige unter ihnen, die für dieses Jahr eine neue Welle von Stellenstreichungen angekündigt haben –, wird in solchen Diskursen eher selten erwähnt. Auf die Opposition ist Verlass? Richtig, es gab eine solche bisher auch links von der SPD, eine, die sich immerhin noch traute, Umverteilung von oben nach unten zu fordern (auch wenn sie regierend oft genug das Gegenteil praktiziert), eine, die eine sozialistische Alternative zur Barbarei kapitalistischer Profitmaximierung zumindest noch in ihrem gültigen Programm fordert (auch wenn wohl gerade deshalb mancher seit Jahren »programmatische Erneuerung« verlangt). Auch diese Opposition geht Schröder derzeit bestens zur Hand, indem sie sich von jenem Flügel selbst- und medienernannter Reformer, der bereits den Verlust ihrer parlamentarischen Bundespräsenz hauptsächlich zu verantworten hat, einen selbstzerstörerischen Chaos-Kurs nebst Rückwendung hinter Gera aufzwingen lässt, der sie zuverlässig in den kommenden Wochen – wenn nicht endgültig! – zur Handlungsunfähigkeit und Selbstaufgabe als linke Oppositionspartei verdammt.
10. Mai 2003
Überraschungen
Das einzig wirklich erstaunliche an dem Vorgang ist das immer wieder ehrlich scheinende Erstaunen der Hauptdarsteller. »Das hat mich sehr überrascht.« – kommentierte Wolfgang Wiegard, Ökonomieprofessor und staatlich gekürter »Wirtschaftsweiser«, den erneuten Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal 2003. Die Wirtschaftsleistung befindet sich jetzt erneut zwei Quartale in Folge auf Schrumpfkurs, 0,5 Prozent liegt sie unter dem Vorjahreswert, eine halbe Millionen Menschen zusätzlich haben sich ins Heer der registrierten Arbeitslosen eingereiht. Und das, obwohl Schröder den Vorschlägen des weisen Professor Wiegard zur »Verbesserung der Angebotsbedingungen« treu gefolgt war: Das soziale Netz wurde kräftig ausgedünnt, die »Lohnkosten« dank Hartz erneut gesenkt, das Großkapital mit Steuerforderungen nahezu nicht mehr belästigt und die Lebensbedingungen Arbeitsloser weiter verschlechtert.
»Das hat mich sehr überrascht« stand auch Zauberlehrling Eichel aufs Gesicht geschrieben, als die Steuerschätzer vor wenigen Tagen in gewohntem Ritual ihre vorangegangene Prognose dem Altpapierrecycling überantworteten: Um mindestens 8,7 Milliarden Euro niedriger als noch im November 2002 vorhergesagt werden die Steuereinnahmen in diesem Jahr ausfallen – wenn die Wirtschaft um 0,75 Prozent wächst, woran außer Eichel und Clement keiner mehr glaubt. Es wird also voraussichtlich noch ärger kommen, und als wollte er sicherstellen, dass auch die von den meisten Wirtschaftsinstituten derzeit noch prognostizierten 0,5 Prozent Wachstum unterboten werden, hat Eichel bereits ein »Leistungsmoratorium« angekündigt und gefordert, »alle Ausgaben« auf den Prüfstand zu stellen. Fast alle zumindest, denn 8,3 Milliarden Euro zur Anschaffung von 60 Militärtransportern A 400 M hat der Haushaltsausschuss gerade durchgewunken. Thyssen-Krupp, BMW und Telekom werden also nicht die einzigen Konzerne bleiben, die Gewinnsprünge nach oben melden. Der Einzelhandel indessen hat seine ursprüngliche Umsatzprognose für dieses Jahr, die auf minus 1,5 Prozent lautete, als »zu optimistisch« zurückgenommen.
Wer freilich die Interessen der Kapitallobby so sehr verinnerlicht hat, dass er Profitrekorde weniger Wirtschaftsriesen mit volkswirtschaftlichem Aufschwung verwechselt, muss den fortgesetzten Niedergang tatsächlich mit immer neuem Erstaunen quittieren. »Volkswirte stochern im Nebel« beschreibt das Handelsblatt mit verständnisvoller Nachsicht die Konjunkturanalyse und prognostische Aktivität der wirtschaftswissenschaftlichen Community und liefert auch gleich die Erklärung nach: Es handele sich eben nicht um einen »klassischen Konjunkturzyklus«, sondern um eine Folge »äußerer Schocks« – angefangen vom 11. September, über den Aktien-Crash bis zum Irak-Krieg. Und Schocks hätten es leider an sich, dass sie niemand prognostizieren könne. Sie falsifizieren selbstredend auch nicht die Annahmen, auf denen die wirtschaftspolitischen Vorschläge beruhten. Also werden der bekannte Psalm noch ein wenig lauter gebetet: Privatisieren, Kürzen, Sparen, Sparen, Kürzen, Privatisieren …
Selbst das Statistische Bundesamt freilich weiß: Wer um die 1200 Euro netto monatlich nach Hause trägt, gibt nahezu sein gesamtes Einkommen für Konsum aus; wer 5000 Euro verdient, legt dagegen gut ein Fünftel auf die hohe Kante; weit geringer noch sind die anteiligen Konsumausgaben dort, wo im Monat sechsstellige Beträge eingehen. Schröders Einkommenssteuerreform indes entlastet Normalverdiener mit weniger als drei Prozent, Einkommensmillionäre dagegen mit mehr als zehn Prozent. Steigende Verbrauchssteuern und Abgaben sowie Hartz tun das ihre, damit immer mehr Leute immer weniger auszugeben haben. Und da soll der Einzelhandel etwas anderes tun als schrumpfen? Selbst ein ökonomischer Laie kann leicht begreifen, dass eine Volkswirtschaft sich von einem Betrieb unter anderem dadurch unterscheidet, dass Kosten und Kunden überwiegend identisch sind. Wenn das Kapital sich Ersterer entledigt, wird es irgendwann auch Letztere missen. Außer einem Wirtschaftsweisen dürfte kaum ein Mensch schockiert sein, wenn er in einem Pool, aus dem zuvor das Wasser abgelassen wurde, nicht mehr vergnügt baden kann. Nach der Weltwirtschaftskrise und konfrontiert mit einer expandierenden Systemalternative hatte das Kapital diese Lektion vorübergehend gelernt. Es ließ seine politischen Belange für die folgenden Jahrzehnte durch Anhänger der keynesianischen Schule verwalten, die immerhin begriffen hatten, dass Mehrwert nicht nur produziert, sondern auch realisiert werden muss, damit die Ausbeutung sich lohnt. Als Nachfragefaktor genoss der Lohnabhängige fortan eine gewisse Aufmerksamkeit, selbst sofern das Kapital keine Verwendung als Arbeiter für ihn hatte. Und wenn es dennoch nicht reichte, sorgte der Staat durch antizyklische Ausgabenpolitik selbst für Absatzmöglichkeiten.
Vertreter dieser Richtung – und darum handelt es sich überwiegend bei Schröders innerparteilichen Kritikern – heißen heute im Handelsblatt »ökonomische Geisterfahrer«. Ob es die, die sie so nennen, nicht besser wissen oder nicht besser wissen wollen, sei dahingestellt. Bezogen aufs Ausland immerhin vermögen sie Strategie und Ungeschick ganz gut zu unterscheiden. »Zum Programm der Republikaner« – schreibt selbiges Handelsblatt über das US-Modell, in dieser Frage durchaus nicht im Nebel stochernd – »gehört es seit Jahren, mit Hilfe von Steuerkürzungen eine weitere Schrumpfung der Bundes-Sozialprogramme zu erzwingen.«
1994 lebten in den USA fünf Millionen Familien von Sozialhilfe; heute sind es noch zwei Millionen. Den »verschwundenen« drei Millionen dürfte es, ob mit zwei oder drei Jobs, ob auf der Straße, als Mitglied einer kriminellen Gang oder bereits im Gefängnis, jedenfalls dreckiger gehen als je zuvor. Ähnliche Ergebnisse scheint Schröder anzupeilen. 1930 war dann wohl auch so mancher Ökonomieprofessor »sehr überrascht«. Nur, zwei Mal sind endgültig genug.
24. Mai 2003
Zinsen und Margen
Die Leitzinssenkung um 0.5 Prozentpunkte, zu der sich die Europäische Zentralbank am Donnerstag endlich durchrang, war überfällig. Europaweit herrscht Ödnis. Die Wirtschaften stagnieren oder befinden sich wie Deutschland (– 0.2 Prozent), die Niederlande (– 0.3 Prozent) und Italien (– 0.1 Prozent) auf Schrumpfkurs. Die einzige Zahl in den europäischen Statistiken, die kräftige Steigerungsraten ausweist, ist die Arbeitslosenquote. Im EU-Durchschnitt liegt sie derzeit bei 8,8 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit drei Jahren. Die Europäische Zentralbank selbst hat ihre Wachstumsprognose für den Euro-Raum mehrfach nach unten revidiert.
Das alles ist allerdings nicht neu und galt im Grunde auch schon, als der EZB-Rat das letzte Mal tagte und die Zinsen unverändert ließ. 53 Prozent der deutschen Topmanager befürworteten diese Entscheidung, nur 46 Prozent – überwiegend aus mittleren Betrieben – sprachen sich damals für eine Senkung aus.
Diese Relation mag erstaunen, sollten Unternehmen – folgt man neoklassischer Lehrbuchweisheit – doch stets Interesse an möglichst niedrigen Zinsen haben. In Wahrheit gilt das aber nur für jene, deren Schulden ihre Finanzpolster übersteigen, was bei einem beträchtlichen Teil der Dax-Konzerne schon lange nicht mehr (und auch nach drei Jahren Börsencrash und Krise noch lange nicht wieder) der Fall ist. Wer dagegen auf einem großen Geldberg sitzt – und hier mögen die befragten Manager nicht allein das Interesse ihres Unternehmens artikulieren, sondern den Instinkt ihrer Klasse insgesamt –, den treibt im Zeitalter einer durch kein Metall mehr gedeckten Währung Inflationsangst um, die nicht selten ins Paranoide und Hysterische umschlägt. Diese Paranoia ist der Baustoff, aus dem die geldpolitische Strategie der Europäischen Zentralbank – wie einst der Bundesbank – gemacht ist.
Natürlich geht es letztlich nie um die Inflationsrate als solche, sondern immer um das Verhältnis von Nominalzins und Inflation. Mit acht Prozent Inflation und einem Zinsfuß von 13 Prozent können Geldvermögensbesitzer allemal besser leben als mit zwei Prozent Zinsen ohne Inflation. Aber in der für sie besten aller möglichen Welten vereinigen sich Geldwertstabilität und ein ordentlicher Zins. So erschienen selbst kurz vor dem jüngsten EZB-Entscheid im Handelsblatt noch Artikel, die für eine Beibehaltung des Niveaus von 2,5 Prozent warben. »Eine Erhöhung der Inflation«, wurde argumentiert, »würde Kosten in Form von Vermögensumverteilungen nach sich ziehen.« Sehen wir davon ab, dass von einer Erhöhung der Inflation gegenwärtig keine Rede sein kann – Umverteilungen finden mit sinkenden Zinsen tatsächlich statt, allerdings stehen den »Kosten« (lies: geringeren Einnahmen) der Vermögensbesitzer gleich hohe Zugewinne bei den Schuldnern (etwa den öffentlichen Haushalten) gegenüber. Ein zweites Argument gegen Zinssenkungen bestand denn auch just darin, dass niedrigere Zinsen den Druck auf die öffentliche Hand verringern würden und damit Schröders Sozialkahlschlag verlangsamen könnten. Denn je schmaler der Zinsaufschlag, desto billiger werden neue Schulden. Jedes noch so kleine Zinsprozent ist also über die Jahre Milliarden öffentlicher Gelder wert, die auf die Konten privater Anleger geschaufelt werden müssen.
Aber all diesen schönen Argumenten zum Trotz hat sich der Mehrheitstrend in den letzten Wochen spürbar gewandelt. Immer mehr Wirtschaftsbosse befürworten nunmehr einen EZB-Zinsschritt nach unten. Herbeigeführt wurde dieser Stimmungswechsel mitnichten durch die tausenden Arbeitslosen, die es seither zusätzlich gibt, sondern in erster Linie durch den hartnäckigen Höhenflug des Euro, der auf die Erträge der europäischen Exportwirtschaft drückt. Deutsche Konzerne sind dabei besonders betroffen, denn in kaum einem Land ist der Binnenmarkt in einem traurigeren Zustand als nach fünf Jahren rosa-grüner Kapital-Hörigkeit hier in der Bundesrepublik. Schon im letzten Jahr hat allein die erneute Steigerung des Exports die deutsche Wirtschaft vor dem Einbruch gerettet. Das lässt sich aber nur wiederholen, wenn die Einnahmen außerhalb des Euro-Raums, in heimischer Währung berechnet, nicht immer weiter an Wert verlieren.
Allein gegenüber dem Dollar hat der Euro in den vergangenen zwölf Monaten um fast ein Drittel aufgewertet. Zudem tobt, seit US-Finanzminister Snow die eigene Währung zwecks Ankurbelung der Konjunktur zur Abwertung freigegeben hat, ein regelrechter Abwertungswettlauf zwischen ersterer und den Währungen Südostasiens, das gleichfalls um seine Exporte fürchtet. Bricht beispielsweise der krisen- und deflationsgeschüttelten japanischen Wirtschaft noch dieser letzte Anker weg, sieht es rabenschwarz aus. Um den Dollar zu stützen und die eigene Währung zu schwächen, kaufen asiatische Notenbanken seither massiv US-Staatsanleihen. Für die USA hat das den Vorteil, dass die Finanzierung ihres ausufernden Leistungsbilanzdefizits selbst bei abwertendem Dollar ohne Probleme möglich bleibt und die Zinsen auf dem Markt für langfristige Anleihen nicht steigen. Letzteres kann Greenspan durch niedrige Leitzinsen allein nämlich nicht gewährleisten. Der Nachteil der asiatisch-amerikanischen Währungsschlacht für die Euro-Länder allerdings ist, dass europäische Exporte eben nicht nur in Übersee, sondern auch in der pazifischen Region immer teurer werden, was selbst für den verbissensten Hartwährungs-Fetischisten denn doch zuviel des Guten sein mag.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.