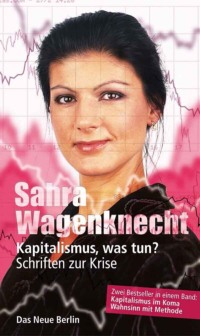Kitabı oku: «Kapitalismus, was tun?», sayfa 4
Schröder kann diese Milieus nicht frontal brüskieren, da die Durchsetzungskraft seiner Politik – und damit seine Überlegenheit gegenüber der CDU in den Augen von Hundt & Co – gerade darauf beruht, dass sie seinen Kurs, mit dem für Akzeptanz nötigen Stallgeruch versehen, nach unten übermitteln. Aber Schröder muss zugleich darauf achten, dass sie seine Vorhaben nicht durch Transmissionsversuche in umgekehrter Richtung stören.
Zur Beseitigung dieses Störfaktors hat er ein Rezept entwickelt, das seinem Ahnen Brüning – bei aller sonstigen Ähnlichkeit – mangels moderner Medien noch nicht zur Verfügung stand. Es besteht in folgendem Dreischritt: 1. Suche einen Sachverständigen, der vor allem von einer Sache – den Interessen und Wünschen der Konzernlobby – etwas verstehen muss und setzte dem zuständigen SPD-Minister eine Kommission vor die Nase, die dieser Fachlobbyist leitet; 2. beauftrage ihn, ein Exzerpt aus BDI-Papieren und der persönlichen Wunschliste honoriger Dax-Vorstände anzufertigen, lass ihn drei, vier spezielle Grausamkeiten hinzufügen, die nach allgemeiner Aufregung wieder zurückgenommen werden können; 3. sorge dafür, dass die Medien die Vorschläge als Ausdruck höchster Kompetenz, als kreativ und unsagbar neu abfeiern, und organisiere dadurch einen Druck, der die Umsetzung zu einer Frage des öffentlichen Ansehens der Partei und des Kanzlers höchstpersönlich macht: Wir können dahinter nicht zurück, Genossen, das müsst Ihr doch einsehen!
Dieses Rezept hatte seine erste Bewährungsprobe, als Riester nach Abschuss der gesetzlichen Rente keine Neigung zeigte, auch noch als Wegbereiter eines amerikanisierten Arbeitsmarktes in die Geschichte einzugehen. Der Sachverständige hieß damals Hartz, und das vielbelobte Ergebnis ist eine Arbeitsmarktreform, die Hire-and-Fire bei Niedrigstlöhnen auch hierzulande zum Alltag machen wird. Der nächste Delinquent, den es mundtot zu machen gilt, heißt Ulla Schmidt. Auch Frau Schmidt gehört zweifelsfrei nicht zur Parteilinken. Aber immerhin hat sie eine Absage an Zwei-Klassen-Medizin sowie das Wörtchen Solidarität gleich mehrfach in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben und, was schwerer wiegt, sie neigt dazu, die Pharmabranche von Zeit zu Zeit mit profitschädigenden Einfällen wie der Positivliste oder Preisabschlägen zu verstören. Auch ihre Idee, künftig Selbständige wie Beamte für die gesetzliche Rente löhnen zu lassen und womöglich alle Einkommensarten zur Berechnung heranzuziehen, kam nicht gut an.
Spätestens an diesem Punkt war die Gründung einer neuen Kommission überfällig. Offiziell hat sie unter anderem den Auftrag, zu prüfen, ob die soziale Sicherung durch eine Verbreiterung der Finanzierungsbasis im genannten Sinn verbessert werden könnte. Aber Bert Rürup, der von Schröder bestellte Vorsitzende, wäre nicht der Wirtschaftsweise, der er sich nennen darf, würde er sich mit derlei abartigen Fragestellungen befassen. Schmidts Ideen führten nur zu einer »Ausdehnung der demographieanfälligen Umlagefinanzierung«, beschied er knapp und erläuterte anschließend das von ihm präferierte Modell: Die Krankheitskosten sollten von den Löhnen abgekoppelt werden, und jeder Versicherte soll künftig eine einheitliche Kopfprämie von 200 Euro zahlen. Die »Arbeitgeber« seien von der Zumutung, die Krankenversicherung ihrer Angestellten mitfinanzieren zu müssen, ganz zu befreien. Tusch bei den Verbänden!
Man muss keine hohe Mathematik betreiben, um zu wissen: Von 200 Euro pro Frau bzw. Mann lässt sich ein einigermaßen zureichendes Niveau gesundheitlicher Versorgung nicht finanzieren. Auch bei den privaten Versicherern liegt der Schnitt – durch alle Altersgruppen – deutlich höher. Und denen steht immerhin frei, was die gesetzlichen Kassen wohl auch nach dem Geschmack des Herrn Rürup nicht dürfen sollten: potentiell teure, weil nicht kerngesunde Leute erst gar nicht aufzunehmen. Wie sich der Rürupsche Amoklauf gegen das Solidarsystem mit Wahlversprechen und Koalitionsvertrag vereinbaren lässt? Frau Schmidt hüllt sich in Schweigen und überlässt den Kommentar einer Sprecherin des Sozialministeriums: »Wir haben große Hochachtung vor der Kompetenz des Herrn Rürup.« Punkt. Aus.
23. November 2002
Rentenklau
»Es geht nicht um den Prozentwert eines aus dem fernen Dunst des Jahres 2030 herausscheinenden Rentenniveaus, es geht um einen tiefen Schnitt in das gewohnte Paradigma der Sozialpolitik …«, höhnte die FAZ im Herbst 2000, als Riester sich gerade anschickte, die Gewerkschaften mit dem Versprechen eines Rentenniveaus von 67 Prozent zu ködern und diese – Schröder-treu, wie sie leider immer wieder sind – dem fatalen Renten-Deal am Ende tatsächlich zustimmten. Dabei verbargen sich hinter den 67 Prozent bei korrekter Berechnung 64 Prozent, und auch diese hätte nur der statistische »Eckrentner« nach 45 vollbeschäftigten Beitragsjahren erhalten – also niemand. Aber nicht allein das wird die FAZ beruhigt haben. Sie wusste vor allem, dass Riester den Scheinkompromiss mit den Gewerkschaften umso leichter schließen konnte, weil er Gewissheit hatte, dass ihn dafür in zehn, geschweige denn dreißig Jahren keine Menschenseele mehr haftbar machen würde. »Nach der Rentenreform wird mit Sicherheit vor der Rentenreform sein«, bekundete damals auch Ludwig Georg Braun, Präsident des Deutschen Industrie und Handelstages, seine Zuversicht. Dass Riesters Versprechen allerdings noch nicht einmal zwei Jahre halten würde, hätten vermutlich weder Braun noch die FAZ zu hoffen gewagt.
Zwar hat SPD-Fraktionsvize Stiegler den allzu rührigen Herrn Rürup inzwischen mit einiger Grobheit zurückgepfiffen und Schröder, kaum freundlicher, die unbekümmert in FDP-Gefilden wildernden Grünen getadelt; immerhin stehen im ersten Quartal 2003 wichtige Landtagswahlen an, und die SPD-Umfragewerte geben Anlass zur Sorge. Dennoch kann man sich getrost darauf einstellen: Die nächste Rentenreform kommt noch vor 2006, und das von Rürup zu präsentierende Konzept dafür wird nicht allzu weit von jenen Ideen entfernt sein, mit denen er derzeit die Öffentlichkeit beglückt. Zudem gehört die SPD-Entrüstung über selbige weitgehend in die Rubrik Volksveralberung, denn als man sich Rürup ins Nest setzte, waren dessen Ansichten nicht unbekannt.
Also wird wohl das Rentenalter weiter angehoben, die gesetzliche Rente noch weiter abgesenkt und die Vorruhestandsregelungen werden drastisch verschlechtert; wer im Alter noch halbwegs menschenwürdig leben will, muss tüchtig privat ansparen – so er es kann und sich außerdem nicht den falschen Fonds von seiner Bank aufschwatzen lässt.
Selbstverständlich wird sich diese wie jede Untat mit guten Gründen wappnen: Nicht politischer Wille, ausschließlich die desaströse Einnahmesituation der Rentenkassen erzwinge solche Änderungen, wird es heißen. Schuld ist, wir wissen es seit Blüm, die demographische Entwicklung. Lothar Späth hat das Einmaleins des Rentenklaus vor wenigen Tagen im Handelsblatt erneut durchbuchstabiert: Die Leute fingen halt immer später an zu arbeiten, gingen immer früher in den Ruhestand und lebten dann zu allem Überfluss auch noch immer länger. Unter solchen Bedingungen könne »die jetzige kollektive Rentensystematik für die nächste Generation nicht aufrechterhalten werden«.
Leider funktioniert es immer wieder, dass ein absurder Fehlschluss nur oft genug wiederholt werden muss, bis er allgemein für logisch zwingend gilt. In Wahrheit besteht das Fundament der demographischen Renten-Lüge aus einer Ansammlung falscher Annahmen. Beispielsweise gibt es durchaus keinen Grund, weshalb in einem System, wo jeder privat vorsorgt, am Ende insgesamt mehr Geld zur Verfügung stehen sollte als in einem umlagefinanzierten. Die Rentner jeder Generation leben von dem, was die zu dieser Zeit Erwerbstätigen erwirtschaften; wenn das nicht ausreicht, wird die schönste Rendite privater Dividendenpapiere in dem Augenblick inflationär entwertet, in dem ihre Eigner sie ausgeben möchten. Wer ohne Umlage am Ende mehr hat, sind nicht alle, sondern einige: diejenigen nämlich, die dank hoher Einkommen viel ansparen können. Je breiter die private Säule, desto niedriger die Umverteilungskomponente, d. h. desto weniger müssen sie an jene abgeben, die wegen Niedriglöhnen, Arbeitslosigkeit, Kindererziehung, Krankheit oder was auch immer keine ausreichende Vorsorge betreiben können und dann eben ins Leere gucken. Kräftig profitieren natürlich auch die Unternehmen, denn zur privaten Vorsorge gibt es keinen »Arbeitgeberanteil«.
Bewusst ausgeblendet in der »Uns-gehen-die-Jungen-aus«-Debatte wird außerdem, dass wir schon sehr viel weiter wären, wenn wenigstens jeder, der erwerbsfähig ist, auch erwerbstätig sein könnte und dies nicht als Billigjobber, sondern in sozialversicherter Beschäftigung mit ordentlichem Einkommen. Weit über sechs Millionen Menschen in diesem Land wären vermutlich heilfroh, wenn sie Gelegenheit erhielten, auf diese Weise die Renten der Rentner mitzuerarbeiten. Der Verband deutscher Rentenversicherer hat mit Recht auf die zusätzlichen Gefahren hingewiesen, die der Rentenversicherung durch Umsetzung des Hartz-Konzepts drohen. Denn Niedriglohn und Leiharbeit bedeuten eben auch weiter sinkende Beitragszahlungen. Ignoriert wird schließlich, dass die von den Erwerbstätigen geleistete Arbeit von Jahr zu Jahr produktiver wird. In den Neunzigern ist die Produktivität in der Bundesrepublik um durchschnittlich 2 bis 2,5 Prozent pro Jahr angestiegen. Die Zahl der Rentner wird zwischen 2000 und 2040 um etwa 0,75 Prozent jährlich zunehmen. Selbst wenn das Produktivitätswachstum sich halbieren würde, wäre somit die demographische Veränderung durch die Produktivitätsentwicklung mehr als ausgeglichen.
Wie bei im Grunde allem, was sich heutzutage Reform schimpft, geht es also auch bei Riester-Rürup II nicht um die Lösung realer Probleme, sondern um Interessenpolitik. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kann sich über ein Drittel der Bevölkerung wegen zu geringer Einkommen ohnehin keine private Altersvorsorge leisten. Diese Zahl einer Bundesbehörde dürfte auch Schröder kennen. Ohne Skrupel werden also Verarmung und soziale Not in Kauf genommen, mit Folgen, die man längst auf den Straßen von Los Angeles oder London besichtigen kann.
7. Dezember 2002
Weihnachtsgabe
Niedersachsens und NRWs Regierungschefs Gabriel und Steinbrück gäben sich »ganz unideologisch«, befand dieser Tage das Handelsblatt. »Unideologisch« ist natürlich im Sprachgebrauch dieser Zeitung – wie in gewissen linken Kreisen – positiv besetzt und lobend gemeint. Während unter Linken mit diesem Attribut zumeist einer bezeichnet wird, in dessen Weltsicht die klassen- und interessenlose Gesellschaft bereits existiert (und der sich seltsamerweise meist dennoch in der realen klassengeteilten ganz gut einzurichten weiß), begreift das Handelsblatt unter »unideologisch« offenbar eine noch eigentümlichere Verzerrung des Gesichtsfeldes: Denn hier ist die Rede von Leuten, die zwischen Einnahme und Ausgabe, zwischen Steuererhöhung und Steuersenkung nicht zu unterscheiden wissen.
Immerhin hatten unter anderem besagte zwei Landeschefs Schröder in den letzten Wochen durch Anheizen der Debatte über die Wiedererhebung der Vermögenssteuer auf Trab gehalten und auf diese Weise für Verstimmung gesorgt. Mancher meint auch, die Verstimmung sei nur gespielt gewesen und die Kakophonie zu weiten Teilen inszeniert, da Schröder die Wahl hinter sich, Gabriel sie aber noch vor sich hat. Das mag stimmen oder nicht, in jedem Fall ist die Forderung nach Reaktivierung dieser Steuer in SPD-Kreisen nicht neu – sie stand noch 1998 im SPD-Wahlprogramm –, und es gab und gibt eine Reihe von Gründen, die selbst aus SPD-Sicht dafür sprechen könnten, ihr nachzugeben.
Einer dieser Gründe ist, dass die Vermögenssteuer nur relativ wenige Leute wirklich träfe und zudem in erster Linie solche, die die SPD ohnehin nicht wählen. Das zeigen die Einnahmestatistiken aus der Zeit, in der es die Vermögenssteuer noch gab, also der Jahre vor 1997. Ein Drittel des damaligen Vermögenssteueraufkommens wurde von den dreißig reichsten Familien dieses Landes gezahlt, den Albrechts, Quants und Klattens, den Ottos, Mohns, Flicks und wie die Damen und Herren mit den überwiegend gut- und altbekannten Namen alle heißen. Allein diese noble Gesellschaft der dreißig reichsten Clans verfügt offiziell über ein Vermögen von 180 Milliarden Euro. Der tatsächliche Wert ihrer Besitztümer mag noch weit darüber liegen. Nun hätten diese Leute zwar vielleicht manchen Grund, Schröder zu wählen – jedenfalls mehr als abhängig Beschäftigte oder Arbeitslose –, aber Fakt ist, dass sie es zum überwiegenden Teil nicht tun.
Die Steuer würde die SPD also kaum Stimmen kosten, eröffnete aber die Chance, welche einzubringen. Denn angesichts der brachialen Einschnitte bei Arbeitslosen, der unerträglichen Zusatzbelastungen für sozial Schwache und des Totschlags tariflicher Standards, die Schröder gerade verbricht, bräuchte die SPD dringend wenigstens ein populäres Projekt, das sich als Gerechtigkeits-Nummer verkaufen ließe. Die geplante Steuer auf Aktienkursgewinne, die de facto eine Steuerentlastung für Spekulanten darstellt und allzu offensichtlich den Verwaltungsaufwand nicht einspielen wird, den sie kostet, sollte zwar genau diesem Zweck auch schon dienen, wurde und wird aber mit Recht von niemandem ernst genommen. Die Wiedereinführung der Vermögenssteuer ließe sich verärgerten Ex-Wählen weit eher als revolutionäre Tat vermitteln – was sie nicht wäre. Denn ähnliche Steuern gibt es in den meisten OECD-Ländern, einschließlich USA, Japan und Großbritannien. Sie sorgen dafür, dass die öffentlichen Haushalte wenigstens einige Milliarden auch von denen bekommen, die genug von ihnen haben, was sehr für diese Art Steuern spricht. Aber selbstverständlich unterminieren sie nirgends die Kapitalakkumulation, und es gäbe sie nicht, wenn sie es täten.
Ohnehin: Ob und wie viel Geld eine Vermögenssteuer tatsächlich einspielt, hängt von ihrer Ausgestaltung ab. Die Memorandum-Gruppe hat für die Bundesrepublik vorgerechnet, dass diese Steuer bei einem Satz von nur einem Prozent und der Freistellung von 350 000 Euro pro Haushalt (zuzüglich 75 000 Euro pro Kind) gut 16 Milliarden jährlich in die öffentlichen Kassen spülen könnte. Das DIW kalkuliert mit etwas höheren Freibeträgen, aber ähnlichen Aufkommenswerten. Die Gewerkschaft Verdi errechnet für einen Satz von 1,5 Prozent mit hohen Freibeträgen ein mögliches Aufkommen von 23 Mrd. Euro im Jahr. Von SPD-Seite dagegen war in der Regel nur von 9 Milliarden die Rede. Tatsächlich hat die Steuer, als es sie noch gab, nie mehr als 4,5 Milliarden Euro jährlich eingebracht. Einer der Gründe lag in einer massiven Unterbewertung von Immobilien- und Produktiveigentum. Diese Ungleichbehandlung war letztlich auch der Grund, den das Bundesverfassungsgericht rügte und der zur Aussetzung der Steuer führte. Selbst bei Wiedererhebung bestünde also die Gefahr, dass die Sätze hinreichend niedrig, die Freibeträge hinreichend hoch und die wohlwollend geduldete Steuervermeidung so umfassend wäre, dass das Projekt im Nichts verpufft. Dass die SPD es dennoch nicht wagt, trotz der offenbaren wahltaktischen Vorteile und des scheinbar nur geringfügigen Schadens einiger hundert vergrätzter Multimillionäre, zeigt einmal mehr, wer in dieser bundesdeutschen Parlamentsdemokratie die Zügel in der Hand hält.
Denn dass sie im Handelsblatt als »Unideologen« firmieren durften, haben die zwei SPD-Ministerpräsidenten just durch ihre Ankündigung erreicht, anstelle des Ärgernisses Vermögenssteuer künftig das Alternativprojekt »Zinsabgeltungssteuer« betreiben zu wollen. »Sehe die Bilanz im Vergleich beider Steuern positiv für die neue Abgeltungssteuer aus, wollen sie ihren Vorschlag [den, die Vermögenssteuer wiedereinzuführen] zurückziehen«, ließen sich beide in selbiger Zeitung zitieren.
Tatsächlich spricht alles für eine »positive Bilanz«. Die Abgeltungssteuer träfe zum überwiegenden Teil den gleichen Personenkreis wie die Vermögenssteuer, nämlich die reiche Oberschicht, sie hätte aber den immensen Vorteil, dass alle bekannten Lobbyclubs dafür sind: die CDU, der BDI, die Verbände der Kreditwirtschaft, auch Bundesbankpräsident Weltecke hat sich positiv geäußert. Das Projekt Zinsabgeltungssteuer hat gegenüber einer Wiedererhebung der Vermögenssteuer eigentlich nur einen einzigen kleinen Nachteil: Es handelt sich um eine Steuersenkung, nicht um eine Erhöhung. Während Zinseinkünfte oberhalb der Freibeträge bisher zum individuellen Einkommenssteuersatz versteuert werden mussten, in der Spitze also derzeit zu 48,5 Prozent, würde der Fiskus künftig generell nur noch 25 Prozent mitverdienen. Die Steuerschätzer vom Institut für Wirtschaftsforschung rechnen, vorsichtig kalkuliert, mit Mindereinnahmen von etwa drei Milliarden Euro. Aber welches politische Projekt hat schon keinen Haken? Immerhin erspart die neue Idee viel Ärger. Und die drei Milliarden kann man sich im Notfall ja auch wieder bei den Arbeitslosen holen.
21. Dezember 2002
Kampf ums Öl
Unsicher war nicht, ob die Bundesregierung umfallen würde. Unsicher war, wann und mit welcher Begründung sie dies tut. Fischers unfriedliche Weihnachts-Botschaft, eine deutsche Zustimmung im UN-Sicherheitsrat zum Krieg gegen den Irak zu erwägen, kam insofern nicht wirklich überraschend. Allenfalls, dass der grüne Kriegsfreund es nicht einmal der Mühe wert erachtete, eine Lüge zur Begründung der hundertachtzig-Grad-Wendung mitzuliefern, mag verblüffen. Aber auch das liegt im Trend, denn selbst die US-Propagandamaschine ist faul geworden. Kein CIA-Kollege, der den im afghanischen Bergland seltsam abgetauchten Erzfeind in Bagdad sichtet, kein unvermutet gefundenes Video, das bin Laden in trautem Gespräch mit Saddam zeigt … Wenn Bush seinen Landsleuten erzählt, ein irakischer Überfall bedrohe die Vereinigten Staaten, ist das so elend dumm gelogen, dass der Schluss naheliegt: Es ist ihm egal, ob ihm noch irgend jemand glaubt. »Es geht im Grunde nur noch darum, eine Art UNO-Legitimation für einen Angriff zum schaffen«, ließ sich ein »hochrangiger Mitarbeiter« des Pentagon im Handelsblatt zitieren. Nicht erst jetzt, sondern bereits am 16. September 2002.
Einen knappen Monat später folgte die von Washington diktierte UNO-Resolution 1441, die den Irak für jedes Versäumnis und jede Falschangabe mit Krieg bedroht. Seither versendet Saddam Berge von Akten und führt Inspektoren durch jeden rattenbewohnten Abwasserkanal, während die USA, demonstrativ uninteressiert an den Ergebnissen solcher Nachforschung, Kriegsschiff auf Kriegsschiff in die Golfregion verlegen. Analysten, Ökonomen und Leitartikler streiten in den Spalten der internationalen Wirtschaftspresse und – ehrlicher – in internen Papieren diverser Research-Abteilungen und Strategie-Klüngelrunden über den Zeitpunkt des Kriegsbeginns, über mögliche Verlaufszenarien sowie über Kosten und Rendite des Projekts. Über das Ob streitet kaum noch einer.
Eine überzeugende Rentabilitäts-Rechnung lieferte der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses Lawrence Lindsey. Zwar setzt er die Kriegskosten bei 100 bis 200 Mrd. Dollar an, also deutlich höher als das Pentagon, das offiziell mit 61 Milliarden kalkuliert. Aber die Investition lohne, so Lindsey, denn: »Bei einem Regimewechsel im Irak können wir mit einer Erhöhung der Weltversorgung [mit Öl] um drei bis fünf Millionen Barrel rechnen.«
Zur Zeit produziert der Irak 2,4 Millionen Barrel pro Tag, in besseren Zeiten waren es 3,5 Millionen, die Reserven liegen bei 112,5 Milliarden. Nach Saudi-Arabien, das über ein Viertel der globalen Ölreserven verfügt, ist der Irak die Nummer zwei in Mittelost. Die Förderkosten am Golf liegen niedriger als in jeder anderen Region, nämlich bei ein bis fünf Dollar pro Barrel; verkauft wird die schwarze Brühe gegenwärtig für über dreißig Dollar. Allein mit einer Machtübernahme in Bagdad würden amerikanische und britische Ölkonzerne, die gegenwärtig am Golf nicht wunschgemäß zum Zuge kommen, elf Prozent der globalen Erdölkapazitäten direkt kontrollieren – zusätzlich zu ihrem bisherigen Reservoire.
Außerdem böte die Besetzung Iraks den Vereinigten Staaten eine militärische und politische Basis, von der aus US-hörige Regimes ebenfalls in Iran, Syrien und Jordanien installiert werden könnten. Profitieren würde davon nicht nur die US-Ölindustrie; Folgeaufträge und Extraprofite durch billigeres Öl winkten dem amerikanischen Großkapital fast aller Branchen. In einer Zeit, in der Wirtschaft und Gewinne stagnieren, ein Riesenloch in der US-Leistungsbilanz klafft und neuerdings auch noch der Dollar schwächelt, ist das ein Ausblick, für den ein von der Öl- und Rüstungsmafia an die Macht geputschter Präsident gern den Weltfrieden riskiert. »Eine erfolgreiche Kriegsführung«, schließt Lindsey, »wäre gut für die Wirtschaft.« Auch der Chairman der Beratungsgesellschaft Cambridge Energy Research Associates, Daniel Yergin, schwärmt: »Ein anderes Regime im Irak würde das Kräfteverhältnis in der ganzen Region verändern.«
Das amerikanische Interesse daran ist umso dringender, seit der alte Verbündete Saudi-Arabien, den Kissinger einst selbstsicher zum 52. Bundesstaat der USA gekürt hatte, bedingungslose Folgsamkeit aufgekündigt hat. Eine Reaktion auf wachsende Reibungen am Golf war bereits Cheneys »Neues Energieprogramm« vom Sommer 2001, das die Öl- und Gasreserven des Kaspischen Meeres ins Zentrum rückte. Am Hindukusch hat Bush seine Hausaufgaben zwar noch nicht ganz erledigt, aber immerhin: Amerikanische Soldaten stehen mit deutscher Unterstützung im Land, militärische Airbasen wurden errichtet. Mit dieser Bastion im Rücken lässt sich jetzt auch das Problem Golf neu angehen. Die hohe Kostenschätzung begründet Lindsey übrigens damit, dass die US-Truppen – anders als beim letzten Mal – nach dem Sieg stationiert bleiben müssten, damit die »Demokratisierung« des Irak sich auch wirklich für die Richtigen auszahlt.
Immerhin gibt es noch andere Interessenten. Schon 1997 hatte die russische Firma Lukoil einen Vertrag über die Exploration des größten Ölfeldes im Irak, West Querna 2 im Südirak, abgeschlossen und bereits vier Milliarden Dollar investiert. Die mittelgroße Firma Tatneft aus der russischen Teilrepublik Tatarstan hat 33 irakische Ölquellen unter Vertrag und schon über eine Milliarde Dollar verausgabt. Verträge mit russischen Ölgesellschaften über weitere 60 Quellen sollen unterschriftsreif sein. Der französische Konzern TotalFinaElf will 3,5 Milliarden Dollar in das Ölfeld Maynoon an der iranischen Grenze stecken und hat sich den Zugriff vertraglich gesichert. Gut vertreten sind außerdem die nationale chinesische Ölgesellschaft und die italienische Agip. Sobald die UNO ihre Sanktionen aufhebt, soll hier das große Geschäft beginnen.
Auch außerhalb des Ölsektors ist die Konkurrenz rührig. Der deutsche Export in den Irak stieg allein in den ersten drei Monaten 2002 um 46,6 Prozent. Frankreich ist nicht weniger aktiv. Russland bestätigte im August Informationen über ein fast unterschriftsreifes Kooperationsabkommen im Volumen von 40 Milliarden Dollar.
Ohne Krieg droht den USA nachhaltiger Einflussverlust in der Region. Daher Bushs forciertes Engagement und die europäische Unlust. Wer den Fuß bereits in der Tür hat, der freut sich nicht, wenn ein anderer Kanonen in Stellung bringt, um das Schloss zu zerschießen. Speziell für deutsche Konzerne gibt es zudem im Ölsektor wenig zu holen. Eon und RWE haben ihr Ölgeschäft in den letzten Jahren an BP und Shell abgegeben und sich stattdessen auf Strom, Gas und Wasser konzentriert. Nicht Pazifismus, sondern schlichtes Profitkalkül wird Schröder davon abhalten, deutsche Truppen vom Hindukusch weg an den Golf zu verlegen. Aber Einfluss in der strategisch hochwichtigen Golf-Region einfach aufgeben mag wiederum auch nicht, wer Weltmacht-Ambitionen hegt. Denn klar ist: Die USA werden die Beute teilen müssen, wollen sie den Krieg ohne allzu großen Krach mit den Europäern oder gar mit UNO-Mandat führen. Aber sie werden nur mit denen teilen, die mitziehen. Fischer hält sich bereit.
4. Januar 2003
Flaute überall
Ein Umsatzwachstum von 5,5 Prozent hatte Metro-Chef Körber seinem Unternehmen für 2002 vorausgesagt. Erreicht allerdings wurden, wie der Handelskonzern jetzt bekanntgab, nur vier Prozent, und auch die nur dank des Auslandsgeschäfts. Jenseits deutscher Grenzen konnte die Metro ihren Verkauf um immerhin acht Prozent auf 23,8 Milliarden Euro steigern; bundesdeutsche Verbraucher dagegen schoben mit Waren im Wert von 27 Milliarden Euro gerade so viel in ihren Wagen an die Metro-Kasse wie ein Jahr zuvor. Ähnlich erging es dem Hagener Douglas-Konzern. Der Kosmetikanbieter für den »gehobenen Bedarf« konnte seinen Umsatz im letzten Jahr um zwei Prozent erhöhen, auch das aber nur dank Aquisitionen und Neueröffnungen im Ausland. Auf dem bundesdeutschen Markt schrumpfte der Erlös um 0,7 Prozent.
Die Analysten waren enttäuscht, die Aktien beider Unternehmen wurden in den Keller geschickt. Und dabei stehen Metro AG – als Konsummeile der Selbständigen, die im Schnitt immer noch mehr verdienen als der Rest des Volks – und Douglas Holding – deren Kundschaft ebenfalls kaum dem Milieu der Arbeitslosen und Billigjobber entstammt – im Vergleich des deutschen Einzelhandels noch recht gut da. Denn dieser kämpfte schon zu Zeiten mit stagnierenden Umsatzzahlen, als Metro und Douglas sich noch in goldenen Bilanzen sonnten. Inzwischen ist aus der Stagnation eine tiefe Krise geworden.
Im ersten Halbjahr 2002 – als die SPD gerade ihr schönes Plakat »Der Aufschwung kommt« präsentierte (das aus Pietätsgründen dann aber doch nicht geklebt, sondern in voller Auflage einer Firma für Altpapier-Recycling übergeben wurde, der es vielleicht zu einem kleinen Aufschwung verhalf) – lag das Minus im deutschen Einzelhandel bei fünf Prozent. Für das gesamte Jahr soll der Rückgang mindestens drei Prozent betragen. Die einzigen, die ihren Absatz vergrößern konnten, sind Billig-Discounter wie Aldi und Lidl – und zwar dank jener Kunden, die ihr Frühstücksei im Vorjahr noch bei Kaiser’s und Rewe gekauft hatten. Wenig von der Krise spüren außerdem bisher nur die teuersten Luxus-Marken und Nobelanbieter, deren Kundenkreis über die Oberen Zehntausend kaum hinausreicht.
Ansonsten herrscht Katzenjammer über Konsumunlust und über »zurückhaltende« Verbraucher, die nicht mal vor Weihnachten ordentlich ihre Geldbeutel zücken und so den Aktionären die Dividende vermiesen. Dass die Leere in ersteren etwas mit der Höhe der letzteren während der vergangenen Jahre zu tun haben könnte, bleibt tunlichst unerwähnt. (Dabei ließe sich Interessantes über den Kausalzusammenhang zwischen wachsender Mehrwertrate und wachsenden Schwierigkeiten der Mehrwertrealisierung bei einem Ökonomen namens Karl Marx nachlesen. Selbiger Wissenschaftler hat auch das scheinbare Paradox erörtert, dass forcierte Ausbeutung sich unter Umständen gar nicht auszahlt und auch deren Antreiber und Nutznießer am Ende weniger haben. Obwohl mittlerweile fast 150 Jahre alt, wirken seine Schriften irgendwie aktueller als die vor drei/vier Jahren modernen Elaborate der New-Economy-Propheten, die – nicht zum ersten Mal – die Umwertung aller Werte und die Aufhebung aller bis dato geltenden kapitalistischen Entwicklungsgesetze beschworen und auch im linken Spektrum emsige Nachbeter fanden. Aber das nur nebenbei.)
Inzwischen haben sämtliche Wirtschaftsinstitute ihre Prognose für 2003 nach unten revidiert. Selbst die Bundesregierung erwartet – nach einem kabarettauglichen Streit zwischen Eichel und Clement, in dem letzterer mit dem Argument »Wir müssen Optimismus verbreiten« an der irrealen Wachstumsprognose von 1,5 Prozent für 2003 festzuhalten verlangte – jetzt nur noch ein »Wachstum« von einem Prozent. Offiziell. Im Ernst glaubt wohl auch daran keiner mehr. Denn woher soll’s kommen? Die inländische Nachfrage nach Konsum und Investitionen ist 2002 um insgesamt 1,3 Prozent geschrumpft. Ausschließlich dem um 2,9 Prozent gestiegenen Export ist zu verdanken, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einem Plus von insgesamt 0,2 Prozent ausgewiesen werden konnte. Diese Zahl macht übrigens auch die Mühe begreiflich, die die Statistiker darauf verwandten, die Inflationsrate trotz spürbarer Teuerung bei Grundnahrungsmitteln und Dienstleistungen in Höhe von 1,3 Prozent einzufrieren. Denn da das reale BIP aus dem nominalen abzüglich Inflationsrate errechnet wird, vermindert jeder zusätzliche Prozentpunkt Inflation die dokumentierte Wirtschaftsleistung. Im Klartext: Bei einer Inflationsrate oberhalb 1,5 Prozent hätte zugestanden werden müssen, was aller Schönwetter-Propaganda zum Trotz ohnehin jeder spürt: dass eine Rezession der deutschen Wirtschaft nicht nur droht, sondern seit einem Jahr Realität ist.
Und nichts spricht für baldige Erholung. Der private Verbrauch wird 2003 dank Schröders neuer Runde an Sozialkürzungen und sonstigen Zusatzbelastungen, außerdem durch steigende Arbeitslosigkeit, dürre Tarifabschlüsse und be-Hartztes Lohndumping voraussichtlich noch tiefer gedrückt. Die öffentlichen Ausgaben werden zusammengestrichen, wo keine starke Lobby Beibehaltung erzwingt. Das alles stimuliert keine neuen Investitionen, zumal mittlere Unternehmen mit geringer Eigenkapitaldecke immer größere Probleme haben, überhaupt noch Kredit zu bekommen. Und das Ausland? Die Beschäftigten anderer europäischer Länder haben zwar, sofern mit kämpferischeren Gewerkschaften gewappnet, in den vergangenen Jahren höhere Lohnabschlüsse durchgesetzt als hierzulande üblich. Inzwischen aber rollt auch da die Entlassungswelle. Der durchschnittliche US-Verbraucher ist hochverschuldet und bangt ebenfalls um seinen Job. Ein einziges Szenario fällt dem Handelsblatt ein, das Aufschwung verheißen könnte: »Wenn die USA einen Krieg rasch für sich entscheiden, könnte der Ölpreis wie ein Stein zu Boden fallen und die Börsen boomen. Die Weltwirtschaft würde durchstarten, selbst Deutschland könnte sich dann einer Erholung nicht mehr entziehen.« Nun ja, bis zur nächsten Krise und zum nächsten Krieg?