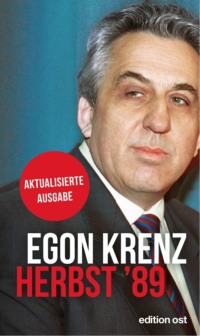Kitabı oku: «Herbst '89», sayfa 8
»Wieso«, fragte Honecker rhetorisch, »sollten wir die Gegner von Brandt noch durch Opferung unserer eigenen Leute belohnen?«
Mielke und Wolf blieben im Amt.
Das liegt inzwischen fünfzehn Jahr zurück. Honecker sitzt immer noch tief in den Knochen, dass seinerzeit Breshnew ihn persönlich für den Sturz von Brandt verantwortlich gemacht hatte. Als ich Honecker im Januar 1989 vorschlage, die im Ministerium für Staatssicherheit nur für interne Zwecke herausgegebene Autobiographie von Günter Guillaume in der Tageszeitung Junge Welt zu publizieren, erhalte ich eine barsche Ablehnung. Handschriftlich vermerkte Honecker auf meine Hausmitteilung: »Nein. Es war politisch falsch, das Buch herauszugeben.«112
Als ich Wolf empfange, weiß ich natürlich, dass es seit Jahren über ihn viele Gerüchte gibt. Er sei aus dem Dienst ausgeschieden, weil er für Gorbatschow Sympathien hege und die DDR nicht mehr für reformierbar halte, sagen die einen. Andere meinen, er sei »1986 als Stellvertretender Minister de facto abserviert und aufs Altenteil geschickt worden«.113
Es gehört zur Strategie des Westens, DDR-Politiker gegeneinander auszuspielen: Die einen sind »Hoffnungsträger«, die anderen »Hardliner«, obwohl alle dieselbe Politik vertreten. Mich hat dieses Gerede interessiert, aber nicht betroffen gemacht. So ist eben Politik.
Soweit ich weiß, wurde Wolf zu keinem Zeitpunkt vom Politbüro auf »Eis gelegt«. Sein Ausscheiden aus dem Dienst des Ministeriums für Staatssicherheit hatte keine politischen Gründe. Es handelte sich um ein Zusammentreffen verschiedener persönlicher und familiärer Umstände.
Die Geschichte begann 1982. Mischas Bruder Konrad, ein herausragender Filmregisseur, Präsident der Akademie der Künste, ein kluger, konsequenter und ausgleichender Mann, starb mit 57 Jahren. Er hatte es nicht mehr geschafft, sein großes Lebensthema114 künstlerisch zu gestalten. Kurz vor seinem Tod bat er seinen Bruder Mischa, sich dieses Themas anzunehmen. Dieser versprach es.
1983 wurde Wolf sechzig Jahre alt. Er begann, sein Ausscheiden aus der Funktion im MfS und seine Tätigkeit als Schriftsteller vorzubereiten. Damals war an einen Generalsekretär Gorbatschow noch nicht zu denken. Die Reformierbarkeit der DDR war auch noch kein Streitthema. Wolf bat damals Minister Mielke, in Rente gehen zu dürfen, um sich ausschließlich dem literarischen Erbe des Vaters und des Bruders zu widmen.
Mielke aber wollte auf seinen besten Mann der Aufklärung nicht verzichten. Wolf blieb im Amt, konnte sich aber schrittweise aus der operativen Arbeit zurückziehen. Er erhielt durch Mielkes Entscheidung ausgezeichnete Arbeitsbedingungen für seine schriftstellerische Tätigkeit. Als Wolf sich von seiner zweiten Frau scheiden ließ, schlug in seinem Umfeld die Stimmung um. Scheidungen waren zwar kein Grund mehr für einen Funktionsverlust. Für die Scheidung des Aufklärungschefs interessierten sich aber auch ausländische Geheimdienste. Dem wollte Mielke entgegenwirken. Deshalb stimmte er der Verabschiedung von Generaloberst Wolf aus dem aktiven Dienst zu.
Der Minister hatte aber seine Rechnung ohne Erich Honecker gemacht. Dem passte nicht, dass Wolf »in so jungen Jahren in Rente geht«. Für Honecker war das Maß der Pensionierung sein eigenes Alter.
Und die Marke »75« hatte Wolf noch nicht erreicht. Honecker entschied: Wolf bleibt. Mielke aber stand Wolf gegenüber im Wort. Er redete jetzt auf mich ein, Honecker zu beeinflussen, der Entlassung seines Stellvertreters zuzustimmen. Schließlich ließ Honecker im Politbüro entscheiden: »Das Politbüro bestätigt die Entlassung des Genossen Markus Wolf aus dem aktiven Dienst aus gesundheitlichen Gründen und spricht ihm Dank für seine aktive politische Arbeit aus.«115
Mir gelang es, bei Honecker die Auszeichnung von Wolf mit dem Karl-Marx-Orden116 durchzusetzen. Honecker verlangte von mir den Entwurf einer Pressemitteilung über die Auszeichnung. Zu meiner Überraschung änderte er sie persönlich ab. Er strich »aus gesundheitlichen Gründen« und fügte handschriftlich ein: »auf eigenen Wunsch«. »Gesundheitliche Gründe« haben immer den Beigeschmack einer Ablösung. Honecker wollte den Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit signalisieren, dass Markus Wolf auf eigenen Wunsch geht, aber mit allen Ehren aus dem Dienst ausscheidet.
Am 26. Juni 1989 hatte Wolf als Autor des Buches »Die Troika« einen Brief an Honecker geschrieben. Er bedankte sich darin, dass Honecker sich zu einem Fürsprecher für eine schnelle zweite Auflage des Buches gemacht hatte. Er wollte »dem vom Westen gehegten Wunsch entgegenwirken«, ihn »in eine Ecke zu manövrieren, in die ich nicht hingehöre«117. Wolf bat daher, in Medien der DDR und des Westens Interviews geben zu dürfen.
Weil Honecker im Urlaub ist, kommt Wolf mit diesem Anliegen nun zu mir. Er versichert, immer und überall »als Kommunist aufzutreten«. Ich zweifle nicht daran und sage zu, Honeckers Zustimmung einzuholen.118
Wolf dankt und möchte sich verabschieden.
»Moment«, sage ich. »Wenn du schon hier bist, würde ich gern erfahren, wie du die gegenwärtige Situation der DDR siehst?«
»Darauf bin ich eigentlich nicht vorbereitet«, antwortet Wolf.
»Mischa, du bist mit deinem Buch auf Lesetour, hast mit vielen Menschen Kontakt. Bitte schildere mir deine Eindrücke. Sie interessieren mich.«
Wolf beginnt zu erzählen. »Mir macht die Negativberichterstattung in unseren Medien über die Sowjetunion Sorge. Wir demontieren unser Bild vom Sozialismus selbst. Wir haben die Sympathiewelle für die Sowjetunion, die durch Gorbatschow ausgelöst wurde, für uns nicht genutzt.
Ein großes Übel in der kommunistischen Weltbewegung ist der Subjektivismus. Das Zentralkomitee und nicht sein Apparat muss bestimmen. Es ist wichtig, dass Alternativen angeboten werden. Die Rolle der Blockparteien und der Gewerkschaften muss bei uns erhöht werden. In Fragen der Kulturpolitik darf die Partei kein Krisenmanager sein. Die Ausreise aus der DDR muss exakt untersucht werden. Wir müssen genau wissen, warum die Leute uns verlassen.«
Seine Einschätzung wird von mir geteilt. Das sage ich ihm auch. Dann verabschiedet er sich. Für Wolfgang Herger und mich war es ein wertvolles, vertrauensvolles Gespräch.
Erst 1991 sollte ich erfahren, dass Wolf mir Entscheidendes verschwiegen hat. In seinem Buch »In eigenem Auftrag« berichtet er über eine Reise nach Moskau. Nur wenige Tage vor unserem Gespräch war er aus der Sowjetunion zurückgekehrt. Zu mir hatte er darüber kein Wort verloren. In Moskau, so beschreibt Wolf nachträglich, habe er seinen sowjetischen Kollegen vom KGB ungeschminkt gesagt, dass von der SED-Führung keine Erneuerung zu erwarten sei. Seine sowjetischen Freunde hätten ihm gut zugehört und am Schluss die Frage gestellt, wie er »die Perspektive der westdeutschen Konzeption einer Wiedervereinigung und des Abbaus der Mauer« sehe.
So weit, so gut.
Doch wo blieb »Glasnost« in unserem Gespräch?
Kein Wort verlor er über diesen Dialog in Moskau. Es wäre 1989 für mich wichtig gewesen, diese Gedanken zu kennen.
Auch 1991 berichtete er in seinem Buch nichts darüber, was er den Deutschlandexperten des KGB geantwortet hat. Einem Mann seines Formats hätte doch auffallen müssen, dass die Frage der KGB-Leute nach der Wiedervereinigung und der Mauer damals zumindest verbal noch der offiziellen Politik Gorbatschows widersprach.
Wolf war in Moskau auf hoher politischer Ebene empfangen worden; für einen Schriftsteller nicht gerade typisch. Falin, Portugalow und Koptelzew hätten mit ihm über die »Einheit der Nation« gesprochen. Hätte Wolf nicht hellhörig werden müssen, wenn ausgerechnet sowjetische Deutschlandpolitiker sagten, die SED habe leichtfertig auf die Einheit der Nation verzichtet? Hingegen leuchteten ihm die Gedanken Falins ein, dass sich die DDR-Führung vom in der ersten Verfassung verankerten Ziel der deutschen Einheit losgesagt und so das Einbringen einer sozialistischen Alternative preisgegeben habe. Nach dieser Lesart hat die SED auch die Chance der Annäherung der beiden Arbeiterparteien Deutschlands vergeben.
Da reden Funktionäre des Apparats des ZK der KPdSU und namentlich nicht genannte KGB-Leute hinter dem Rücken Gorbatschows mit Wolf über die Mauer und die deutsche Einheit, statt gemeinsam mit der SED-Führung Wege zu suchen, aus der politischen Krise, die ja auch Moskaus Krise ist, herauszukommen.
Ich hatte aus politischer Überzeugung die sowjetische Deutschlandpolitik stets verteidigt. Viele Jahre besaßen wir eine linke Option für die Vereinigung. Sie stand selbst in der 1968 beschlossenen Verfassung der DDR. Sie wurde durch Moskauer Vorgaben verändert.
Nun, da alles den Bach hinunter zu gehen drohte, koppelten sich ausgerechnet sowjetische Deutschlandexperten ab. Sie stellten die Geschichte auf den Kopf. Was in Moskau ersonnen und nicht aufgegangen war, schob man nun der SED als deren Fehler die Schuhe.
Noch bevor sich die DDR von ihrer Verfassung aus dem Jahre 1949 verabschieden konnte, wurde der Entwurf ihrer neuen Verfassung 1967 im Politbüro der KPdSU erörtert. Alle Empfehlungen der sowjetischen Verbündeten flossen in die Verfassung ein. Kurz danach, 1969, wurde Brandt Bundeskanzler. Unmittelbar nach dessen Regierungserklärung rief Walter Ulbricht in seinem Gästehaus am Döllnsee bei Berlin das Politbüro zusammen. Honecker vertrat den sowjetischen Standpunkt, in Westdeutschland habe es zwar einen Regierungs-, jedoch keinen Machtwechsel gegeben. Mit der Wahl Brandts würde sich nichts Grundlegendes ändern.
Ulbricht widersprach ihm. Westdeutschland sei zwar weiterhin ein monopolkapitalistischer Staat, jedoch nun mit einer Regierung, in der die SPD die Richtlinien der Politik bestimme. Das sei etwas Neues in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Der Stoß der DDR dürfe nicht gegen Brandt geführt werden. Er müsse Strauß und Thadden gelten119.
Ulbricht ließ keinen Zweifel, dass er die deutsche Frage für eine linke Option offen halten wollte. Er strebte »die Überwindung der vom Imperialismus der deutschen Nation aufgezwungenen Spaltung der deutschen Nation, die schrittweise Annäherung der beiden deutschen Staaten bis zu ihrer Vereinigung auf der Grundlage der Demokratie und des Sozialismus«120 an.
Es folgten die Treffen zwischen Willy Brandt und Willi Stoph am 19. März 1970 in Erfurt und am 21. Mai 1970 in Kassel. Der sowjetischen Führung waren die Gespräche suspekt. Hinter dessen Rücken tadelte Breshnew Ulbrichts Deutschlandpolitik. Er wandte sich mit den Worten an Honecker. »Sagen wir es offen. Aus Erfurt und Kassel kam nichts Günstiges raus. Brandt hat in Bezug auf die DDR andere Ziele als wir.«121
Honecker – damals noch nicht Parteichef – ließ nach Absprache mit Breshnew ein Dokument ausarbeiten. Sein Titel: »Die Entwicklung der nationalen Frage in der deutschen Geschichte.«
Den Entwurf übergab er noch vor der Absetzung Ulbrichts der sowjetischen Führung. Das Politbüro der KPdSU setzte eine Kommission unter Leitung des früheren Hohen Kommissars der UdSSR in Deutschland, Wladimir S. Semjonow, ein. Diese Kommission diskutierte das Dokument im Februar 1971 mit einer SED-Delegation. Semjonow empfahl im Namen der sowjetischen Führung, »theoretisch zu begründen, dass sich in der DDR die sozialistische deutsche Nation entwickelt« habe. Es müsse der Kampf geführt werden »gegen den Mythos von einer angeblich nationalen Einheit der Deutschen und ihrer Gemeinsamkeit«. Es gelte den Nachweis zu bringen, dass die nationale Frage ihrem Wesen nach eine Klassenfrage sei. Die deutsche Nation sei durch die Schuld des Imperialismus zerrissen worden. Die vielfachen Bande zwischen den Deutschen seien dadurch zerstört worden.122
So wurde auf Initiative sowjetischer Deutschlandpolitiker die Theorie von den »zwei deutschen Nationen« ausgearbeitet. Das war die Konzeption der Abgrenzung. Sie hat die Politik der DDR gegenüber der Bundesrepublik von 1971 bis 1989 bestimmt. Noch 1987 haben die Moskauer Deutschlandexperten der KPdSU die Gemeinsame Erklärung »Der Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit« zwischen SED und SDP scharf kritisiert. 1989 taten die gleichen sowjetischen Politiker so, als hätten sie uns 40 Jahre nur die deutsche Einheit gelehrt und die Regeln für eine deutsche Konföderation beigebracht.
Die Öffentlichkeit drängt auf Erklärung, doch das Politbüro schweigt weiter
Freitag, 11. August: Erich Honecker beendet seinen Jahresurlaub. Er kommt für einige Stunden in das ZK. Am Vortag erfuhr ich von meinem jüngeren Sohn, dass Honecker voraussichtlich nächste Woche operiert werden würde. Mein Sohn wusste das wiederum von Honeckers Enkel.
Seit fünf Jahren mache ich Ferien, wenn Honecker aus dem Urlaub zurück ist. Jetzt, da ich von der bevorstehenden Operation weiß, schicke ich meine Familie allein an die Ostsee. Ich streiche den Urlaub. Mein Platz ist in Berlin. Ich rechne damit, dass Honecker die Sitzung des Politbüros am Dienstag noch leiten werde. Herger hat mit der Abteilung für Sicherheitsfragen eine Vorlage ausgearbeitet. Sie enthält eine Analyse der Gründe, warum so viele Bürger die DDR verlassen haben bzw. verlassen wollen. In der Analyse werden Sofortmaßnahmen für die politisch-ideologische Arbeit der Kreis- und Bezirksleitungen der SED vorgeschlagen.
Die Sache ist so wichtig, dass sie unbedingt in Anwesenheit des Generalsekretärs behandelt werden sollte.
Ich gehe mit der Analyse zu Honecker. Er betrachtet das Titelblatt, liest und fragt: »Was willst du damit erreichen?«
Ich erkläre ihm, dass die Partei auf eine Reaktion des Politbüros warte. Kreis- und Bezirksleitungen brauchten Argumente, um politisch und praktisch handeln zu können.
Honecker interessiert sich nicht dafür, was ich sage. Er will nur wissen: »Wer hat euch gestattet, die Zahl der Ausreisenden zusammenzustellen? Was soll das?«
Ich antworte, dass im Westen Zahlen veröffentlicht würden, die fünf- bis zehnmal höher sind als die wirklichen. Das mache die Leute unsicher. Sie müssten von uns die tatsächlichen Zahlen erfahren.
Honecker reagiert gereizt. »Vor dem Mauerbau sind uns viel mehr Menschen weggelaufen. Daran war Nikita Chruschtschow schuld. Sein Gerede von einer Freien Stadt Berlin und von einem Friedensvertrag mit der DDR hat die Leute in Panik versetzt.«
Ich überhöre Honeckers Ausflug in die Geschichte. Mir geht es um hier und heute. Die Verantwortung dafür tragen wir. Ich bitte Honecker, die Vorlage auf die Tagesordnung des Politbüros zu setzen. Er steht auf, greift sich die Vorlage, geht wortlos zu seinem Panzerschrank und schließt sie weg. Dann dreht er sich wieder um und sagt zu mir: »Du kannst in Urlaub gehen. Ich wünsche dir gute Erholung!«
Ich bin entsetzt. Überall im Land kriselt es. In den BRD-Botschaften in Berlin, Budapest, Prag und Warschau warten DDR-Bürger auf ihre Ausreise in den Westen. Die Genossen an der Basis erwarten eine Erklärung ihrer Führung. Und ich soll in Urlaub gehen? »Ich kann jetzt keinen Urlaub machen, Erich, zumal du ins Krankenhaus gehst. Ich bleibe in Berlin.«
Honecker scheint überrascht, dass ich von seiner bevorstehenden Operation weiß. Nachdrücklich, als wolle er mich zurechtweisen, sagt er: »Nimm dich nicht so wichtig. Ich war auch im Urlaub. Du bist hier nicht unentbehrlich.«
So kann man die beste Absicht in Misskredit bringen. Niemand ist unentbehrlich. Auch ich nicht. Das weiß ich wohl. Was kann ich da noch antworten, wenn der Mann, der die Richtlinien der Politik bestimmt, nicht bereit ist, den Ernst der Lage wenigstens zur Kenntnis zu nehmen? Und wenn er meine Sorge mit Wichtigtuerei verwechselt?
Die Audienz ist beendet, ich verlasse Honeckers Büro.
Am 15. August nehme ich an der Sitzung des Politbüros teil. Ich hoffe auf Honeckers Vernunft. Vielleicht bringt er die Analyse doch noch ein – als seine Vorlage.
Doch er verliert kein Wort über den Tiefpunkt der Stimmung in der Bevölkerung. Er entzieht mir vor dem Politbüro sein Vertrauen und verabschiedet mich in den Urlaub. Er lässt beschließen, dass Günter Mittag ihn vertreten werde. Damit setzt er außer Kraft, was seit 1984/85 gilt: Wenn er nicht im Amt ist, vertrete ich ihn. Sein Vertrauter ist jetzt Mittag.
Ich fahre nach Dierhagen in die Ferien. Abschalten kann ich nicht. Warum lasse ich mich in Urlaub schicken? Warum bleibe ich nicht wenigstens in Berlin? Warum habe ich die Analyse nicht im Politbüro zur Diskussion gestellt? Was hätte mir passieren können? Ich hätte keinen Schaden an Körper und Seele genommen. Ich wäre auch nicht aus meinen Funktionen geflogen. Es ist auch nicht Angst, die ich vor jemandem haben könnte. Ich verwechsle einfach Parteidisziplin mit Unterordnung unter den Willen des Generalsekretärs. Ich fühle, dass ich in dieser entscheidenden Situation versagt habe.
Darüber ärgere ich mich enorm.
Während des Urlaubs jogge ich jeden Morgen. Vom Gästehaus der Regierung in Neuhaus bis zum Leuchtturm nach Wustrow und zurück. Das sind etwa 13 Kilometer. So baue ich meinen Frust ab. Wenn ich Leuten begegne, habe ich ein mulmiges Gefühl. Mir ist, als würden mir die Menschen hinterher rufen: Was willst du hier? Dein Platz ist in Berlin. Sag dem Politbüro lieber: wir wollen wissen, wie es weitergehen soll.
Doch niemand ruft hinter mir etwas nach. Die Menschen schweigen. Das ist weitaus schlimmer.
Wolfgang Herger nimmt an meiner Stelle an den Sitzungen des Politbüros und des Sekretariats teil. Fast täglich informiert er mich über die Lage in Berlin. Ich erfahre von ihm, dass Ungarns Außenminister Horn am 31. August zu Gesprächen mit Günter Mittag nach Berlin kommen werde. Die ungarische Führung wolle wissen, ob die DDR die Ausreiseanträge der in Ungarn befindlichen DDR-Bürger positiv entschieden habe. Falls nicht, wolle Budapest die Vereinbarungen mit der DDR über den Reiseverkehr aussetzen. DDR-Bürger könnten dann nach Österreich ausreisen. Als Termin wurde der 11. September genannt. Das klingt nach Ultimatum.
Mittag lässt sich von Horn nicht unter Druck setzen. Er lehnt dessen Ansinnen ab. Mittags Haltung entspricht unserer Rechtsauffassung. Kein Bürger soll Vorteile für sich erpressen können. Hinzu kommt, dass die DDR inzwischen mit der Bundesrepublik vereinbart hat, »dass die Zuflucht in diplomatische Vertretungen der BRD nicht geeignet ist, um die Ausreise aus der DDR zu erreichen. Die BRD werde die betroffenen DDR-Bürger auf die Zuständigkeit der DDR verweisen und ihnen raten, die Vertretungen zu verlassen«.123
Diese Regelung, so argumentiert Mittag, gelte auch für DDR-Bürger, die in Ungarn in westliche Botschaften flüchten.
Horn ist mit dieser Haltung der DDR nicht zufrieden. Er fordert, dass wir die Schwierigkeiten der DDR nicht auf dem Rücken der Ungarn austrügen.
Kurze Zeit danach informiert mich Alexander Schalck124 telefonisch über das Gespräch zwischen Mittag und Horn.
Nun rufe ich Günter Mittag an und erkundige mich, wie es denn gelaufen sei.
Ich höre ihn an und sage: »Wir, und nicht die Ungarn, sitzen im Glaskasten. Wäre es nicht besser, der Staatsrat klärt durch Erlass, dass wir als Ausnahme die von Ungarn geforderte Zusage für die positive Entscheidung der Ausreiseanträge geben?«
Ich weiß, dass dies unserer Rechtsposition widerspricht. Dennoch rede ich weiter: »Es ist immer noch besser, die DDR entscheidet über die Ausreise ihrer Bürger und nicht Ungarn. Nur zwischen diesen beiden Möglichkeiten können wir noch wählen.« Mittag will sich das überlegen.
Am 1. September fahre ich von meinem Urlaubsort nach Berlin, nehme an der Veranstaltung der DDR zum 50. Jahrestag des Überfalls Nazi-Deutschlands auf Polen teil. Ich treffe auch Mittag. Er teilt mir mit: »Dein Vorschlag ist abgelehnt worden.«
Wie nebenbei sagt er noch: »Die Sache ist verfahren. Die Ungarn haben sich längst gegen uns entschieden. Der Besuch von Horn war nur ein Feigenblatt. Aus zuverlässiger Quelle wissen wir, dass Nemeth und Horn vor einer Woche in Bonn zu geheimen Gesprächen bei Kohl und Genscher waren. Nemeth soll das Gespräch mit den Worten eröffnet haben: ›Herr Bundeskanzler, Ungarn hat sich entschlossen, den DDR-Bürgern die freie Ausreise zu erlauben.‹ Kohl hat das honoriert.«125
Das traue ich den ungarischen Genossen einfach nicht zu. Ich täusche mich. Später wird es in Publikationen bestätigt. Die Bundesregierung soll Ungarn für die Ausreise der DDR-Bürger einen Kredit von über 500 Millionen DM gewährt haben. Zugleich habe der Kanzler versprochen, jene ungarischen Nachteile auszugleichen, die durch eventuelle »Vergeltungsmaßnahmen der DDR« entstehen könnten.
Mittags Mitteilung über das Verhalten der Ungarn trifft mich hart. Ich hatte nicht geglaubt, dass sie so weit gehen würden. Dennoch war das für mich nicht das Wichtigste. Die Hauptfrage lautete: Wir brauchen eine Regelung für Reisen von DDR-Bürgern ins Ausland. So lange wir keine gesetzliche Regelung für alle haben, so lange spielen wir immer wieder Feuerwehr. Wir springen von einer Botschaft zur anderen.
»Dein Vorschlag wurde abgelehnt«, hatte mir Mittag gesagt. Also nehme ich an, dass er sich mit Honecker darüber abgestimmt hat. Doch es geht um noch größere Zusammenhänge. UdSSR-Außenminister Schewardnadse hatte einen Brief an Oskar Fischer geschrieben. Darin geht der sowjetische Politiker von »Exzessen der letzten Zeit« aus, »die durch Versuche einer nicht geringen Zahl von DDR-Bürgern, illegal in die BRD zu gelangen, hervorgerufen wurden«. Die UdSSR teile die Einschätzungen der DDR zu diesem Problem. Die Quelle der entstandenen Schwierigkeiten sei der Anspruch der BRD auf das »Obhutsrecht für alle Deutschen«. Dieser Anspruch könne zu jedem Zeitpunkt, abhängig von den politischen Interessen der Machthaber, »Spannungen und Konflikte in den zwischenstaatlichen Beziehungen« erzeugen. Die entscheidende Frage sei deshalb die Anerkennung der Staatsbürgerschaft der DDR durch Bonn. »Wie die westdeutschen Vertreter selbst bezeugen, würden sich die Bewohner der DDR in einem solchen Fall in der Lage der üblichen Ausländer befinden, die um politisches Asyl oder Arbeit in der BRD ersuchen, und das würde sofort den Hang zum Ortswechsel bei denjenigen verringern, die darauf bedacht sind, einen hohen Wohlstand nicht durch viel Arbeit, sondern mittels der Ausreise zu erlangen.«
Schewardnadse hebt hervor, dass das Verhalten der BRD »anrüchig ist und der Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Normen des zwischenstaatlichen Verkehrs nicht standhält«.
Der sowjetische Außenminister empfiehlt, das Problem der »Nichtanerkennung der Staatsbürgerschaft der DDR seitens der BRD« in internationale Foren zu tragen. »Man kann sicher auch darauf verweisen, dass die Beschlüsse der KSZE über Freizügigkeit kaum auf die Beziehungen zwischen der DDR und der BRD anwendbar sind, da wegen der Haltung letzterer zur Staatsbürgerschaft die völkerrechtlichen Voraussetzungen für die Zusammenarbeit beider Länder in dieser Frage fehlen.« Schewardnadse schlägt vor: »Wenn man […] dem Kanzler vertraulich mitteilen würde, dass im Fall der Fortsetzung der entfachten Anti-DDR-Kampagne und der Aufnahme von Flüchtlingen durch die Botschaften der BRD die Behörden der DDR gezwungen sein würden, die Zahl der Übersiedler in diesem und im nächsten Jahr spürbar zu verringern, würde eine solche Warnung vor den Bundestagswahlen […] Bonn zumindest zum Überlegen zwingen.«126
Ich fahre am Abend dieses 1. September zurück an die Ostsee. Das Politbüro ist weiter sprachlos.
Honecker und ich
12. September: Ich bin immer noch in Dierhagen an der Ostsee. Eberhard Aurich, 1. Sekretär des Zentralrats der FDJ, und Gerd Schulz, Leiter der Abteilung Jugend des ZK der SED, besuchen mich. Gestern hat die ungarische Führung ihre Ankündigung wahr gemacht, die Grenze zu Österreich für Bürger der DDR zu öffnen. Innerhalb kurzer Zeit verlassen 15.000 über Ungarn die DDR.
Das Politbüro sucht »Schuldige«. Dass so viele Jugendliche die Republik verlassen, sei ein Beweis dafür, dass der Jugendverband in seiner politisch-ideologischen Arbeit versagt habe. So jedenfalls hat sich Mittag auf einer Sitzung des Politbüros geäußert. Ich nehme an, Aurich und Schulz wollen sich darüber bei mir beschweren.
Sie kommen aber aus einem anderen Grund. »Gestern hat es einen tiefen Einschnitt im Leben unseres Landes gegeben. Ich bin empört, wie das Politbüro damit umgeht«, beginnt Aurich das Gespräch. Und er fährt erregt fort: »Das Politbüro verdrängt die Tatsachen, handelt in kurzschlussartiger Hektik. Das Wort der Partei wird nicht mehr ernst genommen. Noch vor einem Jahr hätte man auf die Autorität Erich Honeckers bauen können. Die hat er inzwischen selbst verspielt.« Aurich macht eine Pause, schaut mich an. Dann sagt er: »Egon, komm’ zurück nach Berlin! Mit Honecker geht da nichts mehr.«
Ich versuche, gelassen zu bleiben. Die Meinung der beiden überrascht mich nicht. Auch ich sehe, dass Honecker mit seiner Kraft am Ende ist. Er ist mit seinen Funktionen überfordert. Mir ist klar: Es muss dringend gehandelt werden. Und dennoch habe ich Skrupel, den kranken Mann so kurz vor dem 40. Jahrestag der DDR zu stürzen. Er stand mit an der Wiege der DDR. Er ist nicht nur dafür verantwortlich, was uns misslungen ist.
Mein politisches Leben ist seit meiner Kindheit eng mit dem Wirken Honeckers verbunden. 1951 begegnete ich ihm zum ersten Mal auf einer Konferenz der Jungen Pioniere in Rostock. Honecker sprach als FDJ-Vorsitzender. Ich war 14 Jahre alt. Die Stimmung im Saal begeisterte mich. Als die Veranstaltung zu Ende war, ging ich mit meinem Pionierausweis nach vorn und bat Honecker um ein Autogramm. Er unterschrieb, schaute mich an und fragte: »Wirst du ein guter FDJler?« Ich versprach es, und ich wurde es. Auf dem Weg über verschiedene Funktionen leitete ich von 1974 bis 1983 die FDJ, die er 1946 mitgegründet hatte. Auf dem FDJ-Parlament 1981 schrieb er mir in seine gerade veröffentlichte Autobiografie: »Meinem Freund und Kampfgenossen Egon in fester Verbundenheit. 4. 6. 1981. Erich Honecker.« Mich erfreute diese Geste. Nicht nur, weil er mein Chef war und ich meine Anleitung für die Arbeit im Jugendverband direkt von ihm bekam. Viele seiner politischen und menschlichen Eigenschaften schätzte ich. Es wäre billig zu denken, Honecker wäre mit dem Vorsatz angetreten, ganz auf Risiko zu gehen: Entweder ein blühender Sozialismus eigener Handschrift oder ein Scherbenhaufen des antifaschistischen und linken Erbes, falls der Entwurf misslingt. Ich bin zutiefst von der Lauterkeit der persönlichen Ambitionen Erich Honeckers bis zu jenem Zeitpunkt überzeugt gewesen, bis er wider besseres Wissen, wider die Warnungen von Mitgliedern des Politbüros, von Parteifunktionären aus den Grundorganisationen, Kreis- und Bezirksleitungen, von Wissenschaftlern und Künstlern, wider die Erfahrungen der Sowjetunion und anderer sozialistischer Staaten an starren Dogmen des politischen, ökonomischen und sozialen Lebens in der DDR festhielt.
Ausgerechnet ich, der viele Jahre lang von ihm gefördert wurde, werde nun von verschiedenen Seiten gedrängt, Honecker abzulösen. Und das nicht erst jetzt, im Jahr 1989. Schon vor fünf Jahren. Es war am 12. Juni 1984. Honecker hatte im November 1983 an die Adresse der USA und der UdSSR erklärt: Eure Raketen sind Teufelszeug. Sie müssen weg von deutschem Boden!127
Kein deutscher Politiker hatte in dieser Frage so viel Zivilcourage bewiesen wie er. Unsere sowjetischen Bündnispartner waren über diese Haltung besorgt. Sie meinten, Honecker habe die sowjetischen und amerikanischen Raketen auf eine Stufe gestellt. Diese Gleichschaltung verletze die Blockdisziplin, hieß es. Honecker war der sowjetischen Führung zwischen zu selbstbewusst und zu eigenständig, vielleicht auch zu »deutsch« geworden. Er hatte das Vakuum genutzt, das mit der Krankheit Breshnews und dem in kurzer Zeit aufeinander folgenden Tod von drei KPdSU-Generalsekretären in der sowjetischen Führung entstanden war.
Er kämpfte seit 1982 darum, in die Bundesrepublik reisen zu dürfen. Immer wieder war Moskau dagegen und warf ihm vor, er betreibe eine Doppelstrategie. An dem Tag, an dem Honecker 1983 zu Gesprächen mit Andropow nach Moskau reiste, schickte er seinen persönlichen Beauftragten, Staatssekretär Schalck, zu Gesprächen mit Strauß nach Mündchen. Obwohl Schalck in geheimer Mission unterwegs war, blieb Moskau dies nicht verborgen. Im Ergebnis der Gespräche in der BRD erhielt die DDR noch 1983 einen Milliardenkredit, eingefädelt von Franz Josef Strauß. Ein »Schalk«, wer glaubte, dass mit diesem Kredit die Volkswirtschaft der DDR »vor dem Ruin« bewahrt werden sollte. Das Geld wurde bei uns auf die hohe Kante gelegt. Der Kredit war aber eine vertrauensbildende Maßnahme. Er galt den internationalen Banken als Signal, dass die DDR kreditwürdig war.
Das Politbüro der KPdSU dagegen fürchtete, dass die Bundesrepublik die DDR wegen ihrer Verschuldung politisch erpressen würde. Unsere Verbindlichkeiten bei westlichen Banken lagen knapp unter 30 Milliarden Valutamark128.
Die sowjetischen Militärs waren zudem entsetzt, dass Honecker mit Strauß, der zu jener Zeit in den sozialistischen Ländern als Personifizierung des Kalten Krieges galt, auch über das Grenzregime zwischen den Militärblöcken sprach. Es gab zwar keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Kredit und dem Abbau der Minen an der Außengrenze des Warschauer Vertragsstaaten zur Bundesrepublik. Die Sowjetunion glaubte dies aber nicht. Sie widersetzte sich lange dem Vorhaben der DDR, die Staatsgrenze von Minen zu räumen. Es kam zu einer offenen Krise in den Beziehungen zwischen der KPdSU und der SED, wie ich sie bis dahin nicht erlebt hatte.
Im Juni 1984 tagten in Moskau die Spitzen aller RGW-Staaten. Honecker hatte mich in seine Begleitung aufgenommen. In einer Sitzungspause des Gipfels kam Marschall der Sowjetunion Ustinow, Politbüromitglied und Verteidigungsminister, auf mich zu. Er lud mich zu einem Glas Tee ein. »Also, Genosse Krenz«, begann der Marschall das Gespräch, »Sie sind in Ihrem Politbüro der Jüngste. Sie müssen einmal das Erbe übernehmen. Sehen Sie nicht, dass Ihr Chef alles verspielt?«
Ich war konsterniert. Worauf wollte er hinaus? Wenn es eine Prüfung meiner Loyalität zu Honecker sein sollte, war sie unnötig. Ich war ihm verbunden. Wollten mich die Freunde vielleicht ganz besonders in Vertrauen ziehen? Ich hatte in Moskau studiert, sprach russisch, die Sowjetunion war meine zweite Heimat. Seit ich Sekretär des Zentralkomitees war, hatte mir Honecker die Routinekontakte mit dem sowjetischen Botschafter in Berlin übertragen. Fast jeden Sonnabend kam Kotschemassow zu mir in die Wohnung. Ich informierte ihn über jede Sitzung des Politbüros. Die Situation in unserer Parteiführung war in Moskau also bestens bekannt.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.