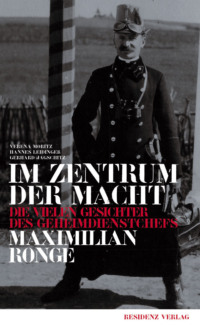Kitabı oku: «Im Zentrum der Macht», sayfa 6
Es kann nicht eindeutig gesagt werden, ob die Ronges von ihrem Personal ausspioniert wurden. Fest steht lediglich, dass es zu Unannehmlichkeiten kam. Diese begannen damit, dass das erste Dienstmädchen, Maria Weps, schon ein halbes Jahr nach Dienstantritt die Familie Ronge verließ.143 Die Nachfolgerin, Anna Mohelnicka, machte sich ein Jahr später Verfehlungen schuldig, die sogar die Polizei auf den Plan riefen. Von einer Bestrafung, so Ronge in seinem Tagebuch, wurde aber abgesehen.144 Kurze Zeit danach ließ er seinen Offiziersdiener verhaften.145 Was immer der Mann getan hatte, Ronge muss triftige Gründe für diesen Schritt gehabt haben.
Kriegsspiele
Die hatte auch der Chef des Evidenzbüros, als er seine Mitarbeiter vor dem Hintergrund der so genannten „Annexionskrise“ in höchste Alarmbereitschaft versetzte. Gefragt war vor allem der Einsatz der „Balkangruppe“. Immerhin stieß in Serbien die Einverleibung Bosniens und der Herzegowina durch das Habsburgerreich erwartungsgemäß auf Protest. Auch Russland war infolge eines diplomatischen Fauxpas seitens Österreich-Ungarns im Vorfeld der Annexion verstimmt. Die Angelegenheit zog immer weitere Kreise und hielt ganz Europa in Atem. Dass der endgültige Anschluss eines Gebietes, das bereits 1878 mit Billigung der Großmächte dem Habsburgerimperium überantwortet worden war, nun, 30 Jahre später, so viel Aufsehen erregte, ging nach Meinung von Aehrenthals Kritikern nicht zuletzt auf dessen Konto. In der Tat war viel diplomatisches Porzellan zerbrochen worden. Nicht genug allerdings, um deswegen Krieg zu führen. Conrad von Hötzendorf hingegen sah die Gelegenheit gekommen, Serbien und eventuell Italien niederzuringen. Wie in den folgenden Jahren auch musste er sich aber mit den virtuellen Schlachten der Manöver zufrieden geben. Seine Reformen hatten immerhin bewirkt, dass diese von sehr viel größerem Nutzen waren als die nach strengem Plan abgespulten Übungen von früher. Mit lieb gewordenen Traditionen wurde gebrochen, die große Kavallerieattacke und die Parade am Ende der Kaisermanöver zum Bedauern Franz Josephs einfach abgeschafft. Kein Schauspiel sollte vorgeführt werden, sondern ein möglichst wirklichkeitsnahes Training stattfinden. Doch trotz allen Bemühens stellte sich der angestrebte Realismus höchstens dann ein, wenn Soldaten ohne Rücksicht auf deren physische Belastbarkeit zu Gewaltmärschen angetrieben wurden und starben. Dennoch hielt Conrad an seinem Manöverprogramm fest, predigte Härte und Durchhaltevermögen und lebte seine „Offensivwut“ aus. Insofern war es leicht für seine Offiziere, sich Lorbeeren zu verdienen. Jeder wusste, dass der General wenig von Verteidigungsstrategien hielt. Wer Initiative zeigte, hatte die Sympathien des Generalstabschefs eher auf seiner Seite als einer, der zur Defensive riet. Taktierte so auch der ambitionierte Hauptmann Ronge? Als er 1908 im Rahmen des Kaisermanövers im ungarischen Veszprém als Schiedsrichter fungierte, hätte er die Gelegenheit dazu gehabt. Auch er musste wissen, dass der Chef des Generalstabs jenen Unparteiischen den Vorrang gab, die nichts an viel zu schnellen Angriffen auszusetzen hatten, obwohl sie auf einem realen Schlachtfeld aufgrund zu hoher Verluste sofort zusammengebrochen wären.146
Conrad erwartete von seinen Offizieren hundertprozentigen Einsatz. Risikobereit und durchtrainiert sollten sie sein, schneidig und zäh. Die Manöver, Kriegsspiele und Generalstabsreisen verlangten ihnen mehr ab als noch zu Zeiten des Generals Beck. Tagelange, beschwerliche Ritte in unwegsamem Terrain und bei schlechtem Wetter wurden üblich, bequeme Unterkünfte gegen notdürftige Unterstände ausgetauscht. Ronge vermerkte in seinem Tagebuch daher auch, dass er im Zuge der Manöver in Ungarn in einem Stall übernachten musste.147
Die ersten Sporen
Unannehmlichkeiten blieben dem aufstrebenden Offizier auch in Wien nicht erspart. Das Evidenzbüro bekam vor dem Hintergrund der Annexionskrise einmal mehr Schelte vom Außenministerium. Die Kompromittierung des k.u.k. Militärattachés in Belgrad in Zusammenhang mit der Verhaftung eines für die Monarchie tätigen Spions bereitete den Diplomaten in Wien keine Freude. „Da hatte man also wieder einmal eine der vom Ministerium so sehr gefürchteten Bloßstellungen“, schrieb Ronge Jahre später. Seiner Meinung nach konnte es sich die Monarchie nicht leisten, nobel im Abseits zu stehen, während die Geheimdienste anderer Staaten alle Register zogen, um an brisantes Material heranzukommen. Die Entrüstung des Außenministeriums wollte er ganz und gar nicht verstehen. Der Militärattaché, der dem Evidenzbüro so emsig zugearbeitet hatte, wurde trotzdem abgezogen.148
So oder so waren die Informationen über die Stärke der serbischen Armee, die während der Annexionskrise im Evidenzbüro eingingen, überaus wertvoll. Im Auge behalten musste man aber auch das, was sich im Osten des Reiches ereignete. In Galizien beispielsweise tauchten auffallend viele russische Scherenschleifer auf, die offenbar nicht nur ihrem Gewerbe nachgingen, sondern unter anderem ungewöhnliches Interesse an Geländeformen und diversen geographischen Details an den Tag legten.149 Einige dieser einschlägig interessierten „Handwerker“ wurden aufgegriffen und nach Russland abgeschoben. Solchen kleinen Erfolgen der Spionageabwehr stand aber eine eher dürftige Bilanz des offensiven Kundschaftsdiensts gegenüber. Was sich hinter der Grenze, im Zarenreich, abspielte, blieb dem österreichischen Geheimdienst verborgen. Nicht zuletzt aufgrund fehlender Kontaktmänner. Die im Zarenreich noch vorhandenen Konfidenten konnte man an den Fingern einer Hand abzählen.150
Ansonsten aber schien das Evidenzbüro die Lage unter Kontrolle zu haben. Sabotageakte ausländischer Agenten an den Rüstungsbetrieben in der Monarchie wurden durch verstärkte Überwachung der betreffenden Objekte verhindert. Außerdem brachten derlei Maßnahmen Ronge auf die Idee, sich die Methoden der Gegner zu eigen zu machen. Sabotage gehörte von nun an auch ins Repertoire des österreichischen Kundschaftsdiensts.151
Soviel Initiativgeist blieb nicht unbelohnt. Ronge hatte sich seine ersten Sporen verdient. Für seine Arbeit vor dem Hintergrund der Annexionskrise wurde er mit einem Orden ausgezeichnet. Der Generalstabschef sprach ihm seinen „wärmsten Dank“ aus.152 Wenige Monate später wurde er dann per Dekret des Kriegsministers „zum Tragen der Militärverdienstmedaille am roten Band berechtigt“.153
Dennoch blieb in Ronges Erinnerungen an diese Zeit auch Negatives zurück. Unerfreulich war seiner Meinung nach die „unpatriotische Haltung“ der Presse in Österreich und Ungarn gewesen. Dutzende Blätter hatten ausführlich über militärische Maßnahmen geschrieben, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, dass derartige Berichte von großem Nutzen für das feindliche Ausland sein konnten. Viele Zeitungen wurden daraufhin beschlagnahmt. „Noch peinlicher“, so Ronge, waren disziplinäre „Unbotmäßigkeiten“ von k.u.k. Soldaten in Böhmen gewesen.154 Sie verhießen nichts Gutes für den Fall, dass eines Tages Krisen in Kriege münden würden.
„…ein widerwärtiges, gefährliches Geschäft…“
Ein Heer, das den Wünschen des Generalstabschefs gemäß bald scharf schießen sollte, benötigte freilich jede Menge Informationen über den künftigen militärischen Gegner. Die Nachrichtenbeschaffung seitens des Evidenzbüros gewann daher zunehmend an Bedeutung.
Doch bei allem Respekt, den Conrad der Arbeit der Geheimdienstoffiziere zollte, war der Generalstabschef nicht frei von Vorurteilen gegenüber dem Metier der Spionage als solches. Mit ihm assoziierte man gemeinhin eine Schattenwelt, wo sich Verräter und Verbrecher, zwielichtige Gestalten in jedem Fall, tummelten. Ehre und Spionage schienen sich gegenseitig völlig auszuschließen. Für einen dem Ehrenkodex verpflichteten Offizier ergab sich daraus ein Dilemma. Umgang mit zweifelhaften Figuren pflegen zu müssen, kam so gesehen einer Bestrafung gleich. Der Spionagebetrieb aber „erforderte nicht nur Kontakte mit Menschen, die den Standesbegriffen des Militärs nicht entsprachen, sondern spielte sich überhaupt in einer Grauzone zwischen Illegalität und Patriotismus ab.“155 Conrad war zwar von der Wichtigkeit des Geheimdienstes überzeugt und stellte sich stets, so gut es ging, schützend vor die Offiziere des Evidenzbüros, wenn es Angriffe von anderer Stelle hagelte. Persönlich zu tun haben wollte er aber mit dem Metier nichts.156 Dieses beschrieb einer, der im Ersten Weltkrieg dem militärischen Nachrichtendienst der k.u.k. Monarchie als Mitarbeiter der „Chiffrengruppe“ angehörte, als „widerwärtiges, gefährliches Geschäft“, das den Charakter verderbe.157
Max Ronge war sich ungeachtet seiner Hingabe an den Beruf bewusst, wie abschätzig über seinen Tätigkeitsbereich geurteilt wurde. Das Naserümpfen mancher Kollegen wird ihm nicht entgangen sein. Er selbst konnte jedenfalls dem persönlichen Kontakt mit Spionen nicht ausweichen. Immer wieder kam es zu geheimen Treffen mit Agenten. Ronge begegnete Wichtigtuern, Schwindlern und Betrügern, solchen, die ihm „minderwertige Dinge“ andrehen wollten und anderen, die sich lediglich als „geschwätzig“ erwiesen. Mal traf er sich mit ihnen in irgendwelchen Wiener Cafés, mal in Privatwohnungen oder überhaupt weit weg von Wien, in fremden Städten oder abgelegenen Dörfern.158
Die angesprochene Geringschätzung der Geheimdienstmänner seitens ihrer Offizierskollegen wurzelte nicht zuletzt in der Annahme, diese könnten sich auf Dauer dem negativen Einfluss eines letztlich bedrü-ckenden Klimas von Verrat, Tücke und Hinterhältigkeit nicht entziehen – ganz so wie dies die zitierten Aussagen des ehemaligen Nachrichtendienstmitarbeiters zu bestätigen scheinen. Galt dies nun wirklich alles auch für Max Ronge? Traut man den Äußerungen des Generalstabsoffiziers Edmund Glaise von Horstenau, wäre die Frage zumindest teilweise zu bejahen. Allerdings sind dessen Wahrnehmungen auch im Lichte einer – vorsichtig formuliert – nicht störungsfreien Beziehung zwischen den beiden Männern zu betrachten. Glaise jedenfalls schilderte Ronge als einen infolge seiner Arbeit beschädigten Charakter, dessen berufsbedingtes Misstrauen Offenheit im zwischenmenschlichen Kontakt völlig ausschloss. Er sprach ihm deshalb auch ab, überhaupt zur Freundschaft fähig gewesen zu sein. Außerdem wollte er eine latente Unsicherheit bemerkt haben, die den Geheimdienstler zu unaufgeforderten Klarstellungen veranlasste. Max Ronge, so Glaise, fühlte sich bezeichnenderweise „bei jedem Zusammentreffen mit einem neuen Menschen schon in der zweiten Minute“ bemüßigt, seine „hohe persönliche Anständigkeit zu betonen, an der ohnehin niemand zweifelte.“159
Polnische Angelegenheiten
Der als „impulsiv“160 beschriebene k.u.k. Hauptmann Ronge hatte eine andere Auffassung von seinem Beruf als viele seiner Kollegen. Die „Evidenthaltung“ militärischer, aber auch politischer und wirtschaftlicher Informationen über fremde Staaten war alles andere als eine aufregende Arbeit. Nicht wenige von Ronges Kollegen im Evidenzbüro beschäftigten sich vor allem mit der unspektakulären Auswertung so genannter „offener Quellen“. Das bedeutete nichts anderes, als dass sie die Berichte der Militärattachés, dutzende in- und vor allem ausländische Zeitungen, militärische Fachzeitschriften sowie amtliche Verlautbarungen studierten und auf ihren für den Generalstab verwertbaren Informationsgehalt untersuchten. Zeitungsartikel über den Bau einer neuen Bahnlinie konnten ebenso von Bedeutung sein wie Nachrichten über die Rohstoff-Förderung eines bestimmten Landes, die wiederum in Zusammenhang mit der Rüstungsindustrie gebracht wurde. Jahre später lernte auch Ronge diese vor allem vom Schreibtisch aus und mit verhältnismäßig wenig Aufwand zu bewerkstelligende Form der Nachrichtenbeschaffung schätzen.161 In seinen ersten Jahren aber, als Leiter der Kundschaftsgruppe, bediente er sich bisweilen weit weniger „gemütlicher“ Methoden. Zur Anwendung kamen sie vor allem im Bereich des offensiven Kundschaftsdiensts. Spionageabwehr, also die Konzentration auf den defensiven Kundschaftsdienst alleine, erschien Ronge zu wenig. Er forderte mehr Initiative und eine Abkehr von bisher gültigen Verhaltensmustern.162 Nicht Reaktion, sondern Aktion sollte die Devise sein. Ronge machte sich dementsprechend für den offensiven Kundschaftsdienst stark. Dass er damit beim Außenministerium sowie bei anderen Ämtern anecken würde, nahm er in Kauf.
Probleme waren regelrecht vorprogrammiert, als Ronge und seine Leute in Galizien aktiv zu werden begannen. Das Kronland im Osten war ein regelrechtes Aufmarschgebiet der russischen Spionage und vom innenpolitischen Standpunkt her ein geradezu hoffnungsloses Krisengebiet. Der Konflikt zwischen Polen und Ruthenen schien unlösbar. Als im April 1908 der galizische Statthalter Andrzej Potocki, ein Pole, von einem ruthenischen Studenten ermordet wurde, zeigte sich einmal mehr, wie tief der Hass saß.163
Hass charakterisierte aber auch die Haltung der meisten Polen im Zarenreich gegenüber ihren russischen „Besatzern“. Schon 1906, als sich Russland noch kaum von den Folgen der Revolution erholt hatte, bot der spätere Staatschef Polens, Josef Pilsudski, im Namen der Kampforganisation der „polnischen-sozialistischen Partei Russlands“, der PPS, den Österreichern seine Dienste an.164 Offeriert wurden „Kundschaftsnachrichten jeder Art über Rußland“ gegen „gewisse Gegenleistungen“.165 Diese Gegenleistungen waren allerdings ziemlich konkret: Erleichterung der Waffenbeschaffung und Duldung von geheimen Waffendepots und Parteiagenten in Galizien – das waren nur zwei von mehreren Forderungen. Problematisch waren sie in jedem Fall. Das wiederum lag an den Zielen der polnischen Sozialisten.
Die PPS versuchte sich politisch und militärisch auf jenen Tag X vorzubereiten, an dem ein schwaches Russland einem „allgemeinen nationalen Aufstand in Polen zur Wiederherstellung der polnischen Unabhängigkeit“ nichts mehr entgegensetzen würde können. Andrzej Potocki war von einer Zusammenarbeit mit den „polnischen Brüdern“ in Russland keineswegs begeistert gewesen. Einerseits, weil er ein politischer Gegner der Sozialisten war, und andererseits, weil er, so behaupteten seine Widersacher, Güter in Russisch-Polen besaß und daher wenig Sympathie für eine sozialistische und antirussische Politik aufbrachte. So oder so waren die Polen in Galizien an einer Änderung des status quo nicht sonderlich interessiert. Die gemeinsame Feindschaft gegen Russland reichte auch nach Meinung des Generalstabschefs, damals noch Friedrich von Beck, nicht aus, um die PPS zu unterstützen. Man entschied, die Finger von der Angelegenheit zu lassen.166
Ganz offensichtlich aber hatte die PPS bereits geheime Waffendepots in Galizien angelegt. Darüber hinaus gab es Hinweise auf die Existenz einer „Terroristenschule“ in Krakau, wo die Partei ihre Mitglieder militärisch ausbildete und auf einen Kampf gegen die Russen vorbereitete. Ausführliche Mitteilungen über diese Entwicklungen kamen peinlicherweise vom russischen Botschafter in Wien, der die österreichischen Behörden aufforderte, der „kriminellen Aktivität“ der PPS ein Ende zu bereiten.167 Das Außenministerium in Wien ersuchte daraufhin die zuständigen Instanzen in Krakau um Aufklärung. Trotz vorhandener Anhaltspunkte stellte die Polizei vor Ort gegenüber den Wiener Zentralstellen die Existenz der Terroristenschule in Abrede. Sie handelte dabei durchaus im Interesse des Generalstabs. Nicht alles, was sich in Galizien mit quasi stillschweigendem Einverständnis militärischer Stellen abspielte, sollte gleich am Schreibtisch der Diplomaten des Habsburgerreichs landen.
Hauptmann Ronge erschien es trotz der Querschüsse aus dem Zarenreich allzu verlockend, mit der PPS zusammenzuarbeiten. Da diese Kooperation patriotischen Zwecken diente, kostete es ihn auch keine Überwindung, mit Sozialisten ins Geschäft zu kommen. Die Bedenken seiner Vorgesetzten teilte er nicht. Conrad scheute davor zurück, sich mit Pilsudski und seinen Leuten einzulassen. Doch schließlich ließ er Ronge gewähren und wartete ab, wie sich die Angelegenheit entwickeln würde. Der Geheimdienstmann konnte auf diese Weise dem Kundschaftsdienst seinen Stempel aufdrücken. Das galt auch für die „polnischen Angelegenheiten“.
Waffenlieferungen
Der ehrgeizige Hauptmann fand in Gustaw Iszkowski, Chef der Kundschaftsgruppe des 11. Korps in Lemberg, einen Verbündeten. Auch dieser hatte dazu geraten, die PPS in den Spionagedienst einzubeziehen. Ein Treffen mit Iszkowski, das im April 1909 in Wien stattfand, hatte in diesem Zusammenhang wohl Bedeutung. Ronge hob den Namen Iszkowskis in seinem Tagebuch mit mehreren dicken Strichen hervor. Zu diesem Zeitpunkt war bereits die Grundlage für die Zusammenarbeit mit der PPS geschaffen.
Schon im Februar hatte Ronge den Generalstabsoffizier Josef Rybak beauftragt, in Krakau mit der PPS Kontakt aufzunehmen, eventuell auch mit anderen auf dem Gebiet Russisch-Polens tätigen Organisationen, um dort ein Spionagenetz zu organisieren, für den Fall eines Krieges sogar „Diversion und Sabotage“.168 Rybak fuhr daraufhin nach Krakau und traf sich plangemäß mit Pilsudski und dessen Vertrauten Walery Slawek. Kollegen Rybaks bemühten sich in der Zwischenzeit ganz besonders um die paramilitärischen Einheiten der Polen, deren Legalisierung Pilsudski und Slawek als Lohn für ihre Dienste gefordert hatten. Die ganze Angelegenheit war überaus heikel, strengste Geheimhaltung geboten. Die Verbindung von Generalstab und PPS sollte unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit kommen. Dass vor allem die russische Spionage nichts von den polnisch-österreichischen Arrangements erfahren durfte, lag auf der Hand. Sollte die Aktion dennoch aufliegen, so Ronge, musste das Evidenzbüro und damit der Generalstab tunlichst aus der Sache herausgehalten werden. In diesem Fall hatte Rybak zu erklären, auf eigene Faust gehandelt zu haben.
Es kam anders. Ausgerechnet Walery Slawek wurde dem Evidenzbüro zum Verhängnis. Im Juni 1909 nämlich verhaftete ihn die Polizei in Krakau. In der Tasche, die man ihm abnahm, befanden sich eine Pistole, Dynamit und Propagandaschriften. Slawek hatte die Aufmerksamkeit der Ordnungshüter erregt, da sein Name in den Papieren eines enttarnten Agenten der russischen Geheimpolizei, der Ochrana, aufgetaucht war. Krakauer Sicherheitskräfte arbeiteten zwar mit dem Evidenzbüro zusammen, wussten aber nicht, dass sie mit Slawek einen Kontaktmann Rybaks aufgegriffen hatten. Letzterer intervenierte für seinen Schützling. Jetzt konnte die Arretierung des PPS-Mannes erst recht nicht vertuscht werden. Schlimm war nicht nur, dass verschiedene zivile Behörden in Wien davon Wind bekamen, nun mischten sich auch die Russen ein. Sie verlangten die Auslieferung Slaweks. Bei diesem, so die Begründung, handle es sich um einen gesuchten Mörder. Sein angebliches Opfer war ein Ochrana-Agent gewesen, der in Rom von PPS-Männern regelrecht hingerichtet worden war. Slawek allerdings war entgegen den Vorwürfen aus dem Zarenreich keiner der „Henker“ gewesen. Aber darum ging es auch gar nicht. Und konnte es bald auch nicht mehr, denn Slawek verschwand aus dem Gefängnis. Der Pilsudski-Vertraute, der es viele Jahre später zum polnischen Premierminister brachte, hatte sich bereits Richtung Frankreich abgesetzt.
Kein Wunder, dass Russland empört reagierte. Niemand konnte ernsthaft glauben, dass Slaweks Flucht ohne Zutun der Österreicher erfolgt war. Die Beschwerden, die ans Außenministerium in Wien adressiert waren, rissen nicht mehr ab. Sie wurden überdies auch im Zusammenhang mit der Terroristenschule in Krakau immer konkreter. Als schließlich die Wiener Zentralstellen in russischen Blättern nachlesen konnten, dass die k.u.k. Militärs mit sozialistischen Untergrundorganisationen der Polen kooperierten, musste sich der Generalstab notgedrungen dazu äußern. Dass Conrad nun ausführte, man könne in einem künftigen Krieg mit dem Romanowimperium nicht auf die anti-russischen Aktivitäten der Polen verzichten, war das eine; die Folgen der Risikopolitik der Militärs für die Situation innerhalb der eigenen Grenzen das andere. Wenn nationale Unabhängigkeitsbestrebungen von Polen und anderen Nationen unter der Herrschaft des russischen Vielvölkerreiches vom Vielvölkerreich Österreich-Ungarn unterstützt wurden, dann hatte eine um den Zusammenhalt der Doppelmonarchie bemühte Nationalitätenpolitik ein Glaubwürdigkeitsproblem. Nicht zuletzt dann, wenn man mit der Duldung bewaffneter Formationen den Polen etwas zugestand, was man beispielsweise den Ruthenen beziehungsweise Ukrainern in Österreich verweigerte. Darüber schienen die Militärs hinwegsehen zu können. An den dauerhaften Bestand der Grenzen, wie sie die europäische Landkarte damals verzeichnete, glaubten ohnehin schon viele nicht mehr. Die angespannte internationale Lage schien ihnen Recht zu geben. Rücksichtnahme auf die Integrität eines Staates, noch dazu wenn er ein feindlicher war, musste, so betrachtet, als Ausdruck einer Politik der Realitätsverweigerung aufgefasst werden. Außerdem unterstützte das Zarenreich russophile Strömungen in Österreich und Ungarn. Der Generalstab in Wien konnte also darauf verweisen, dass Russland seinerseits auf eine Destabilisierung des Nachbarn abzielte, indem es nationale Begehrlichkeiten unterstützte. Man tat also nur das, was andere auch taten. Da der ausgestreckte Zeigefinger für gewöhnlich reichte, um Diskussionen über die Zulässigkeit zweifelhafter Unternehmungen zu beenden, waren die Widerstände gegen die Tätigkeit des Generalstabs enden wollend.
Zu all dem kam aber noch etwas Erstaunliches hinzu: Die Russen waren in bestimmten Punkten offenbar besser unterrichtet über das, was in Galizien vor sich ging, als die österreichischen Zivilbehörden. Letztere bekamen keine Informationen oder wurden an der Nase herum geführt, weil Ronge und seine Mitarbeiter dafür sorgten. Der Leiter der Kundschaftsgruppe hatte in diesem Zusammenhang prominente Vorbilder. Evidenzbürochef Hordliczka und Generalstabschef Conrad gingen mit gutem beziehungsweise schlechtem Beispiel voran. Auch sie neigten zu Alleingängen, und auch sie konnten unter gewissen Voraussetzungen überaus einsilbig werden. Vor allem, wenn es um die Einbindung des Außenministeriums ging, stockte die Kommunikation. Selbst der Kriegsminister wurde dann und wann in die Lage versetzt, Informationen regelrecht erbitten zu müssen. Der Generalstab zog es offensichtlich vor, gewisse Dinge für sich zu behalten.169 Dieses Privileg beanspruchte erst recht der Geheimdienst und mit ihm Max Ronge.
Dass im Gegensatz zu den Behörden in Wien die Russen erstaunlich viele Detailkenntnisse über die Zusammenarbeit des österreichisch-ungarischen Generalstabs mit der PPS besaßen, konnte dem Geheimdienst aber nicht einerlei sein. Rybak beispielsweise vermutete später, dass Ronges Vorgesetzter, der berühmte „Superspion“ Alfred Redl, Material an die Ochrana weitergab. Viel wahrscheinlicher aber ist, dass sich das Evidenzbüro auf einen Konfidenten verließ, der gleichzeitig auch für die Russen arbeitete. Dieser, ein galizischer Finanzbeamter, verschwand 1912 spurlos. 1914 hielt er sich Gerüchten zufolge in Kiew auf.170 Außerdem waren die Ochrana-Agenten nicht untätig geblieben. Sie hatten die Terroristenschule in Krakau mit Spitzeln unterwandert. Petersburg erhielt seine Informationen also aus erster Hand.
Trotz aller Enthüllungen, die von den Russen an die große Glocke gehängt worden waren, setzte Ronge den eingeschlagenen Kurs fort. Der Aufstand in Polen verfestigte sich zur fixen Idee. Es wurde überlegt, wie man den polnischen Kampfverbänden Waffen zukommen lassen könnte. Auch die Größenordnung einer solchen Unterstützung war zu überdenken. Zu Jahreswechsel 1912/13 fand in Ronges Büro vor diesem Hintergrund eine Konferenz aller Hauptkundschaftsstellen statt. Auch Josef Rybak erschien. Er beantragte 3.000 Karabiner, 300 Kilo Sprengstoff und 20.000 Kronen für die polnischen Einheiten. Die „Wunschliste“ wurde akzeptiert, das Material geliefert.171
In seinen nach dem Zusammenbruch der Monarchie erschienen Publikationen schwieg sich Ronge über die diesbezüglichen Unternehmungen des Evidenzbüros, die in die Zeit vor 1914 datierten, bis auf wenige Andeutungen aus. Unter anderem wohl deshalb, weil die Polen im Weltkrieg letztlich einen anderen Weg einschlugen als der Generalstab für sie vorgesehen hatte. Die Militärs hatten sich – wie in vielen anderen Dingen auch – verkalkuliert. Im Nachhinein wirkte die so kläglich gescheiterte Instrumentalisierung des Nationalismus als Verzweiflungstat eines in die Enge getriebenen Habsburgerreiches.
Agentenjagd
Das im Tagebuch Ronges erwähnte Treffen mit Iszkowski ist der einzige konkrete Hinweis auf die ungewöhnliche Partnerschaft mit den Polen, der im Privatnachlass zu finden war. „Iszkowski bei uns“, heißt es da ganz konkret. „Bei uns“, also in der Wohnung der Ronges zu Gast, waren in den Jahren 1909 und 1910 aber auch noch viele andere Kollegen vom Fach, darunter ausländische Spionagespezialisten. Mit Oberstleutnant Karl Egli vom Schweizer Geheimdienst verband Ronge bald eine innige Freundschaft, und die Zusammenarbeit funktionierte blendend. Am Wissensstand und den Informationen der Schweizer hatte aber auch die Abteilung IIIb, in gewisser Weise das deutsche Pendant zum Evidenzbüro in Wien, Interesse gezeigt. Die Schweiz war immerhin eine weidlich genützte Operationsbasis für die vor allem gegen das Hohenzollernreich gerichtete französische und russische Spionage.172 Max Ronge wiederum stand mit Major Brose von der IIIb und mit dessen Nachfolger Wilhelm Heye in regem Kontakt. Die Kooperation von schweizerischem, deutschem und österreichisch-ungarischem Geheimdienst hätte besser nicht sein können. Freilich änderte die Zusammenarbeit zwischen Wien und Berlin nichts daran, dass im Evidenzbüro neben der Russischen, Französischen oder Italienischen auch eine „Deutsche Gruppe“ existierte. Dass die Spionage beziehungsweise Spionageabwehr mit Blick auf das Hohenzollernreich eine Nebenfront war, ist nicht anzuzweifeln. Bezeichnenderweise ging man aber bei aller Freundschaft nicht so weit, die Deutsche Gruppe in Frage zu stellen.
Im Vordergrund des Verhältnisses zu Berlin stand dennoch nicht das Gegen-, sondern das Miteinander. Ronge unterstützte die deutschen Kollegen und bekam umgekehrt, wenn es sich ergab, Hilfe aus Berlin. Diese erstreckte sich etwa auch auf die Auslieferung von Agenten. So konnten von der IIIb beispielsweise zwei österreichische Staatsbürger gestellt werden, die für Batjuschin gearbeitet hatten.173 Den beiden, Miodragović und Dyrcz, wurde im Juli 1909 in Wien der Prozess gemacht.174
Wenige Monate später ging Max Ronge allerdings ein sehr viel bedeutenderer Spion ins Netz. Dem Chef des Kundschaftsbüros war ein anonymes Schreiben zugegangen, in dem von der Spionagetätigkeit eines Österreichers zu Gunsten des italienischen Generalstabs die Rede war. Der unbekannte Verfasser war überaus zuvorkommend gewesen, denn er legte dem Brief sogar ein Foto bei, auf dem zwei Männer vor dem Goethedenkmal in Rom abgebildet waren. Ronge gelang es, die Identität eines der Verdächtigen zu klären. Es handelte sich um einen Beamten im Artilleriezeugdepot in Wien. Sein Name war Adolf Kretschmar von Kienbusch.175
Ronge ließ ihn samt seiner „Konkubine“ observieren. Kretschmar blieb ahnungslos. Er traf sich mit seinen Kontaktmännern, ohne irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Und einer dieser Kontaktmänner war alles andere als ein Unbekannter. Kretschmar verkehrte nicht mit „kleinen Fischen“. „Eines Tages kam er“, so Ronge, „auf einem unbeleuchteten Wege in die Gartenanlagen hinter der Wiener Großmarkthalle mit dem russischen Militärattaché Oberst Martschenko zusammen.“176 Polizeirat Edmund von Gayer, dessen Detektive sich an Kretschmars Fersen geheftet hatten, verständigte sofort das Evidenzbüro. Ronge drängte auf die umgehende Verhaftung des Spions. Gayer aber riet ab. Zu Recht wies er darauf hin, dass die Beteiligung des Obersten Mitrofan Martschenko an der Affäre ein gelinde gesagt skandalträchtiger Umstand war. Dass dieser diplomatische Immunität besaß, machte die Sache nicht eben leichter. Conrad wollte mit der ganzen Affäre nichts zu tun haben, und die Reaktion Aehrenthals konnte Ronge erahnen. Der Außenminister war tatsächlich nur dank des klugen Vorgehens von Evidenzbürochef Urbanski dazu zu bewegen, von den Russen die Abberufung ihres allzu neugierigen Attachés zu fordern. Um das gespannte Verhältnis zwischen dem Zarenreich und der Donaumonarchie nicht noch mehr zu strapazieren, wollte Aehrenthal dem russischen Militärattaché eigentlich seine „Spioniererei“ nachsehen. Doch Ronges Vorgesetzter trickste den Außenminister aus. Er konfrontierte Aehrenthal mit einem Dokument, aus dem hervorging, dass dieser bei anderer Gelegenheit die Entfernung eines spionierenden k.u.k. Militärattachés gefordert hatte. Aehrenthal konnte nicht den eigenen Spion nach Hause schicken und den gegnerischen in Wien behalten wollen. Wenn auch widerwillig wandte der Minister sich daraufhin an die Diplomaten des Zarenreiches und schlug ihnen vor, „dass der Oberst bald einen Urlaub nehmen und von diesem nicht mehr zurückkehren möge“.177
Im Januar 1910 wurde nicht nur bei Kretschmar, sondern auch bei seinem Schwiegersohn eine Hausdurchsuchung vorgenommen. Der Besuch der Polizeidetektive machte sich bezahlt. Am Abend des 15. Januar 1910 konnte sich davon auch der Geheimdienst überzeugen. „Die militärische Kommission, Hauptmann-Auditor Vorlicˇek und ich“, erinnerte sich Ronge später, „sichtete das vorgefundene Material und es war hellichter Tag, bis wir, reich bepackt, den Heimweg antraten.“178
Die Durchsicht der Unterlagen förderte Erstaunliches zu Tage. Kretschmar war Zuträger des russischen, französischen und italienischen Geheimdiensts gewiesen. Und das seit bereits zwanzig Jahren. Martschenko hatte sich also in Sachen Spionage nur des intakten Netzwerks seines Amtsvorgängers bedienen müssen, als er nach Wien kam. Seinem Nachfolger, Militärattaché Zankiewitsch, konnte Kretschmar allerdings nicht behilflich sein. Der k.u.k. Spion wanderte hinter Gitter. Als militärischer Sachverständiger beim Prozess gegen den allzu auskunftsfreudigen Beamten wurde Alfred Redl hinzugezogen.179 Er hatte sich nicht nur mit Kretschmar auseinanderzusetzen. Verhaftet worden waren nämlich auch Verwandte und Kollegen des Langzeitagenten, die sich nach Ronges Meinung durch „arge Vertrauensseligkeit“ an dem „Verrat“ des Beamten mitschuldig gemacht hatten.