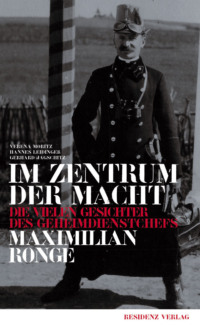Kitabı oku: «Im Zentrum der Macht», sayfa 7
Dass Kontrolle besser als Vertrauen war, davon musste man einen Maximilian Ronge nicht erst überzeugen. Vor allem, was den neuen russischen Militärattaché anging. Zankiewitsch nämlich stand Martschenko in nichts nach. Auch er hatte an Informationen Interesse, die auf offiziellem Wege schwer in Erfahrung zu bringen waren. Da aber eine polizeiliche Überwachung des Militärattachés nicht genehmigt wurde, trug die Lösung des Problems am Ende Ronges Handschrift: Er warb auf eigene Verantwortung Agenten an, die zur Beobachtung Zankiewitschs abgestellt wurden. Sie machten ihre Arbeit entweder schlecht oder der russische Attaché seine zu gut. Zankiewitsch bemerkte nämlich bald, dass er observiert wurde.
Als gewiefter Gegenspieler Ronges erwies sich aber auch Baron Alexander Murmann, der gleichfalls für Russland spionierte. Seit der ehemalige k.u.k. Kadett acht Monate abgesessen hatte, weil man ihn der Spionage überführt hatte, operierte er mit größerer Umsicht. Unterstützt wurde er dabei von seiner Mutter. Auf das Duo aufmerksam gemacht hatten Ronge bereits die Kollegen von der IIIb. Als die beiden blaublütigen „Verräter“ schließlich in der Donaumetropole auftauchten, ordnete der Geheimdienstmann eine lückenlose Überwachung an. „Nach einiger Zeit der Beobachtung“, so Ronge, „wurde die Mutter mit kurz geschnittenen Haaren und hinkendem Fuß samt dem eben in Wien anwesenden Sohn verhaftet.“180 Doch mussten sie bald darauf wieder freigelassen werden, da man ihnen nichts nachweisen konnte. Murmann arbeitete in der Folge für Batjuschin in Warschau ebenso wie für dessen Kollegen Michail Galkin, der von Kiew aus Teile der russischen Militärspionage steuerte. Da Murmann sich dem Zugriff der Behörden immer wieder erfolgreich entziehen konnte, wurde er eines Tages schließlich unvorsichtig. Im Februar 1912 kam er wieder nach Wien, und diesmal schnappte die Falle zu. Mittlerweile hatte sich genügend Beweismaterial angehäuft, um den Aristokraten der Spionage für Russland zu überführen. Ronge, der sich von Murmanns „menschlich abscheulichen“ Taten abgestoßen fühlte, trat als einer der militärischen Sachverständigen im Verfahren gegen den Spion in Erscheinung. Im Gerichtssaal erlebte der Geheimdienstmann etwas, was ihm im Zuge seiner Karriere regelmäßig widerfuhr: der Anwalt des Angeklagten lehnte ihn als Gutachter ab. Ohne Erfolg.181
Ronges Meinung als Fachmann wurde auch im Prozess gegen den ehemaligen k.u.k. Offizier Paul Bartmann eingeholt. Dieser war ebenso wie Murmann bereits wegen „Ausspähung“ verurteilt worden, aber genau wie sein „Kollege“ nach Verbüßung der Haftstrafe seinem Metier treu geblieben. Nachdem er bereits im Auftrag der Russen und Franzosen geschnüffelt hatte, wechselte Bartmann schließlich vom Spion zum Spionageschwindler und trug in unglaublicher Dreistigkeit seine Dienste dem k.u.k. Militärattaché in Rom an. Diesem wollte er dubiose Pläne ebenso dubioser Wehranlagen der Italiener verkaufen. Er flog auf. 1910 kam Bartmann vor Gericht. Den Prozess beobachtete offenbar auch Ronges Schweizer Kollege Karl Egli, der im Oktober in die österreichische Hauptstadt kam.182 Ronge gab sich vor dem aus Zürich angereisten Geheimdienstmann keine Blöße. Sein Gutachten als Sachverständiger war hieb- und stichfest. Es ließ keine Zweifel an der Schuld des Angeklagten aufkommen.
Die Verurteilung von Spionen war eine Genugtuung für den dienstbeflissenen Hauptmann. Oft genug hatte er das Gefühl, gegen Windmühlen zu kämpfen. Sowohl in Galizien als auch in Südtirol nahmen Spionageprozesse immer wieder einen überraschenden Ausgang. Die Urteile fielen seinem Dafürhalten nach meist viel zu milde aus. Ronge wusste warum. Die Verräter saßen, so der Geheimdienstler, auch in den Reihen der zuständigen Beamten. Ob Richter oder Beschuldigter – verdächtig waren sie ihm alle.183
Schicksalsschläge, Niederlagen
Die Probleme im Dienst stellte eine private Tragödie in den Schatten. Im April 1910 starb die kleine Tochter Elsa. Sie erkrankte, als sich Ronge gerade in Berlin aufhielt. Im Tagebuch vermerkte er damals eine Besprechung über eine Affäre, in der offenbar der Name Protivensky eine Rolle spielte.184 Leutnant Protivensky hatte für Frankreich spioniert und war von seiner Geliebten verraten worden.185 Max Ronge hatte die Reise nach Berlin auf sich genommen, um womöglich Näheres über die Angelegenheit in Erfahrung zu bringen. Außerdem beschäftigte ihn noch ein anderer Fall: die „Affäre Jeczes“.186 Letzterer, ein bereits mehrmals verurteilter Dieb, hatte in den Diensten des russischen Militärattachés Martschenko gestanden und war von Ronge entlarvt worden, als er sich gerade – nicht sehr talentiert – als Doppelspion versuchte. Der Kundschaftschef stellte Jeczes eine Falle. Er traf sich mit ihm in einem Café am Stephansplatz, im Zentrum Wiens, um Polizeibeamten, die er auch dorthin bestellt hatte, Gelegenheit zu geben, den Mann aus der Nähe zu betrachten. Wie erhofft, erkannten sie Ronges geheimnisvollen Gast und identifizierten ihn als Josef Jeczes, der wegen „Rockdiebstahls“ bereits aktenkundig war. Von seiner Karriere als Spion hatte bis zu diesem Zeitpunkt jedoch noch niemand eine Ahnung gehabt.187
Max Ronge durchlebte also beruflich eine recht aufregende Zeit, als mit dem Tod seiner jüngsten Tochter eine private Katastrophe über die Familie hereinbrach. Seine Frau kam über den Verlust nie ganz hinweg.
Seinen Tagebuchaufzeichnungen nach zu schließen, ließ Ronge nur wenig Zeit verstreichen, um nach dem Begräbnis die Routine des Alltags wieder aufzunehmen. Noch enger aber als in den vorangegangenen Jahren gestaltete sich der Kontakt mit dem Offizier Wilhelm Preissler, der den irreführenden Spitznamen „Putzi-Onkel“ trug. Ronge war keineswegs Preisslers Neffe und mit dessen Eintritt in das Evidenzbüro sogar sein Vorgesetzter. In regelmäßigen Abständen trafen sich die Ronges mit den „Putzis“, also mit Preissler und dessen Frau. Eintragungen wie „mit Putzis“, „bei Putzis“ oder „Putzis bei uns“ tauchen im Tagebuch noch häufiger auf als der Name „Filipek“. Bei diesem handelte sich um einen Schulkollegen Ronges, den er seit der Kindheit kannte und mit dem ihn eine Jahrzehnte dauernde, offenbar sehr enge und vitale Freundschaft verband.
Abseits der Intensivierung privater Kontakte halfen ihm vielleicht die vielen und langen Dienstreisen über den Tod der kleinen Elsa hinweg. Außerdem engagierte er sich sehr in einem „Photo-Club“, hielt dort Vorträge und beteiligte sich an diversen Aktivitäten des Vereins. Ablenkung konnte Ronge brauchen, denn im selben Jahr verlor er noch zwei weitere Menschen, die ihm sehr nahe gestanden waren. Es starben seine Großmutter und Dr. Franz Kopetzky, ein Freund der Familie, der ihm in all den Jahren seiner Ausbildungszeit auch finanziell unter die Arme gegriffen hatte.
Zeit zur Trauer blieb auch diesmal wenig. Im September 1910 nahm ihn die Vorbereitung für die so genannte „Erzengelprüfung“, die über seine Karriere als Generalstabsoffizier entschied, ganz und gar in Anspruch. Fast 30 Jahre später erinnerte er sich an diese Zeit als eine offenbar mit vielen Belastungen verbundene.188 Die mehrtägige Prüfung „zum Stabsoffiziere im Generalstabskorps“ verlief überdies nicht ganz so, wie Ronge sie sich vielleicht vorgestellt hatte.189 Conrad beurteilte seine Leistungen als „entsprechend“. Ein recht mageres Ergebnis für einen sonst so erfolgsverwöhnten Offizier wie Maximilian Ronge. Hatte er den Widerspruch des Generalstabschefs hervorgerufen? Andere, die zur Erzengelprüfung antraten, wussten, wie sie beispielsweise die Taktik-Aufgabe lösen würden, schon bevor sie die Ausgangsannahme überhaupt gelesen hatten. „Auf Angriff zu setzen, das konnte gar nicht falsch sein.“190 Hatte Ronge eine andere Wahl getroffen, defensives Vorgehen bevorzugt und sich dadurch in den Augen Conrads nicht als befehlshabender Offizier im Feld empfohlen? Die weitere Verwendung Max Ronges als Generalstabsoffizier wurde zwar nicht in Frage gestellt, das Ziel also erreicht. Doch die langersehnte Beförderung zum Major erfolgte erst im Mai 1912.
Ein schaler Nachgeschmack blieb auch in Zusammenhang mit der Verhaftung des für Italien spionierenden Bankbeamten Josef Colpi zurück. Auf die Schliche kam man diesem infolge eines ganz anderen Delikts. Nicht Colpis Aktivitäten als Spion brachten die Polizei auf seine Spur, sondern vielmehr der Einbruch just in jenes Geldinstitut, in dem er arbeitete. Colpi hatte die eigene Bank ausgeraubt. Keine sehr gute Idee, wie Ronge meinte. Noch dazu verhielt sich Colpi derart auffällig, dass er sofort in Verdacht geriet. Man nahm ihn fest. Bei der Hausdurchsuchung stellte die Polizei Material sicher, das ihn überdies als durchaus vielseitigen Spion überführte. Man fand Waffen, Sprengmittel und Fotos militärischer Objekte sowie Briefe, deren Absender Ronge nicht unbekannt waren. Es handelte sich um Deckadressen des italienischen Geheimdiensts. In Trient aber, wo der Prozess gegen Colpi stattfinden sollte, schenkte man dem Häftling so wenig Aufmerksamkeit, dass dieser von seiner Zelle aus Briefe an den italienischen Spionagechef schreiben konnte. Ronge war empört. Für ihn stand fest – die Nachlässigkeit der Behörden hatte Methode, Trient war in der Hand der Irredentisten. Der Geheimdienstler erreichte daraufhin, dass Colpi nach Wien gebracht wurde. In der ersten Dezemberhälfte 1910 beanspruchte ihn laut Tagebucheintragungen der Colpi-Prozess oft bis spät in die Nacht. Verurteilt wurde der Bankbeamte aber nur wegen „Kassenraubes“. Die Anklage wegen „Hochverrats“ wurde fallen gelassen, weil, räumte Ronge ein, von einem Misserfolg ausgegangen werden musste. Obwohl das Verfahren nun nicht in Trient, sondern in Wien stattfand, wurde auch hier in Zweifel gezogen, dass Ronges Spionagegutachten die Geschworenen für die Argumente der Ankläger eingenommen hätte – ein bitteres Eingeständnis, ja eine Niederlage für jemanden, dessen Aufgabe nicht zuletzt darin bestand, Männer wie Colpi aus dem Verkehr zu ziehen.191
Ronges Vertrauen in die Rechtssprechung war als Folge derartiger Erfahrungen mit Sicherheit schwer angeschlagen. Das galt auch für seinen Chef, August Urbanski. Die Strafen für Spione und Landesverräter seien viel zu niedrig angesetzt worden, um abschreckend zu wirken, meinte dieser. Nicht wenige waren schon nach ein paar Monaten wieder auf freiem Fuß. Ein Hinaufsetzen der Strafen „im Wege der Parlamente“ bezeichnete Urbanski aber als aussichtslos, „weil ja so mancher Abgeordneter damit sich selbst den Strick gedreht hätte“.192
„Wir hatten einen Verräter im Büro…“
Dennoch ließ Ronges Eifer nicht nach. Einfallsreich ging der Leiter der Kundschaftsgruppe vor, als er plante, einen Schlag gegen die Spionagezentrale in Kiew zu führen.
Die Gelegenheit dazu ergab sich offenbar rein zufällig. Laut Ronge hatte sich dem Evidenzbüro ein böhmischer Musiker angetragen, den Kontakt mit einem russischen Obersten namens Marinsko herzustellen. Der Musiker hatte sich bei einem Aufenthalt in Kiew damit gebrüstet, einen schwer verschuldeten Offizier des österreichischen Generalstabs zum Freund zu haben. Mit solchen Aussagen zog er sofort die Aufmerksamkeit der Kundschaftsmänner vor Ort auf sich. Diese wollten den in Geldnöten befindlichen Generalstabsoffizier kennen lernen. Er sollte zu einem lukrativen Spionagegeschäft überredet werden. Den Deal einfädeln, ließ man den Musiker wissen, wolle ein gewisser Oberst Marinsko. Die Russen brachten aber auch eine geheimnisvolle Dame mit ins Spiel, die offenbar das Vertrauen des Obersten besaß und als seine Kontaktperson im Ausland auftrat. Ronge trug nun dem böhmischen Musiker auf, dem Werben der Russen nachzugeben. Diesen signalisierte er also im Auftrag des Evidenzbüros die Bereitschaft des verschuldeten Generalstabsoffiziers, Marinsko zu treffen. Den Offizier mimte allerdings ein Mitarbeiter Ronges, Oberleutnant Milan Ulmansky. Das Treffen mit Marinsko kam nach Vermittlung zwischen dem Musiker und der geheimnisumwitterten Dame zustande. Der Oberleutnant war nicht wenig überrascht, als Marinsko sich ihm vorstellte. Ulmansky erkannte sein Gegenüber sofort. Vor ihm saß Michail Galkin, der Kiewer Spionagechef. Der schöpfte keinen Verdacht. Man traf sich noch einige Male, bis plötzlich der Kontakt abriss. Warum, wurde den österreichischen Geheimdienstlern erst viel später klar. „Wir hatten“, so Ronge, „einen Verräter im Büro, der den Russen den Hereinfall enthüllte!“193
Für Ulmansky stand fest, dass der Souschef des Evidenzbüros, Alfred Redl, der Verantwortliche gewesen war. Auch Ronge dachte nicht anders. Beide aber kamen erst Jahre nach dem Scheitern der Aktion zu diesem Schluss.
Es war wahrscheinlich der letzte Dienst, den der „Superspion“ Redl den Russen erwies, bevor er das Evidenzbüro verließ. Verdächtigt hatte man ihn, den so angesehenen Generalstabsoffizier, der 1912 zum Generalstabschef des 8. Korpskommandos in Prag avancierte, damals, als die „Operation Galkin“ durchgeführt wurde, noch keineswegs.194 Am allerwenigsten wahrscheinlich Maximilian Ronge. Redl hatte ihn, als er 1907 ins Evidenzbüro eintrat, gleichsam väterlich in die Geheimnisse des Kundschaftswesens eingeführt. Ronge vertraute seinem Lehrer, schätzte ihn und eiferte ihm nach.
Redl wiederum hielt seinen Schützling für einen hochqualifizierten, aber gleichzeitig sehr ehrgeizigen Offizier.195 Vielleicht erkannte und nützte der „Superspion“ diese Eigenschaft auch als Schwachstelle, die es ihm erlaubte, sein dreistes Spiel vor den Augen des Kundschaftsleiters zu treiben. Der nämlich brauchte trotz allen Selbstbewusstseins und aller Unabhängigkeit, die man seinem Wirkungskreis zugestand, eines gewiss: die Anerkennung seiner Vorgesetzten. 1909 wäre Redl um Haaresbreite Chef des Evidenzbüros geworden.196 Mit ihm in gutem Einvernehmen zu stehen, war der Karriere des ambitionierten Hauptmanns sicher förderlicher als womöglich durch misstrauische Fragen Spannungen herbeizuführen. Zum Beispiel über den aufwändigen Lebensstil des Vorgesetzten, den dieser aus den Zuwendungen ausländischer Geheimdienste für seine Spionagetätigkeit bestritt. Die Summen, um die es ging, konnten es immerhin mit dem Jahresbudget des Evidenzbüros aufnehmen. Ronge war gut genug mit Redl bekannt, um den Luxus, mit dem sich dieser umgab, zu bemerken.197 Später warf man Redls Umfeld vor, es hätte allzu naiv dessen Erzählungen von einer Erbschaft Glauben geschenkt. Außerdem waren durchaus Gerüchte darüber in Umlauf, dass ein k.u.k. Offizier in exponierter Stellung militärische Geheimnisse an das Zarenreich verkaufte.198 Kaum zu glauben, dass sie nicht bis ins Büro des Kundschaftsleiters drangen. Verschloss Max Ronge Augen und Ohren, weil nicht sein konnte, was nicht sein durfte: der Generalstabsoffizier Alfred Redl ein Verräter? Oder war es, wie er selbst vermutete, sein früherer Chef Eugen Hordliczka, der Hinweise in den Wind schlug, weil sie völlig abwegig, ja absurd erschienen? Warnungen missachtet hatte offenbar aber auch der von Ronge so verehrte Franz Conrad von Hötzendorf. Ihn wollte Max Ronge keinesfalls an den Pranger stellen.
Es mutet in jedem Fall wie purer Zynismus an, dass Redl den Hauptmann Ronge, der seinen Verrat so lange nicht bemerkte, mit Lob regelrecht überschüttete. „Ungewöhnlich gewandt“, „sehr geschickt“, „unermüdlich fleißig“ und „hervorragend befähigt“, sei er, der junge Ronge, urteilte Redl im Jahr 1908.199 Diesem unermüdlich fleißigen und hervorragend befähigten Offizier entging es, dass sein Vorgesetzter mit unglaublicher Kaltschnäuzigkeit auch den letzten brauchbaren Spion, der für Österreich arbeitete, an die Russen auslieferte. Häme ist andererseits kaum angebracht, denn Redl überbot wohl das Vorstellungsvermögen des misstrauischsten Kollegen. Um jeden Verdacht von sich abzuwenden, ließ er sich die Namen russischer Spione geben, die nach Meinung des zarischen Geheimdienstes von keinem großen Wert mehr waren. Dann „entlarvte“ er sie und trumpfte als erfolgreicher Spionejäger auf.200
Kleine Fische?
Welche Schlüsse 1911, als die so vielversprechend begonnene „Operation Galkin“ jäh scheiterte, der Kundschaftschef und seine Mitarbeiter aus der Angelegenheit zogen, bleibt uns Ronge in seinen Schriften schuldig. Keine Aufklärung gab er auch über die tatsächliche Identität des verschuldeten Generalstabsoffiziers, der angeblich zum Freundeskreis des nicht näher beschriebenen böhmischen Musikers gehörte. Kurioserweise passte die Beschreibung des Generalstäblers durchaus auf Alfred Redl, der trotz seiner finanziell lohnenden Spionagetätigkeit immer noch über seine Verhältnisse lebte. Verriet Redl den Russen Ronges Coup, weil er fürchtete, entdeckt zu werden? Spekulationen ganz anderer Art stellten offensichtlich Max Ronge und seine Kollegen vom Evidenzbüro an. Ihre Fantasie reichte aber nicht aus, um den Verräter im eigenen Haus zu suchen.
Mit Fantasie gesegnet war hingegen Hermann Hans Cords. Der „Spionagehochstapler“ und dessen Schwindeleien beschäftigten Ronge einmal mehr als Sachverständigen vor Gericht. Cords tischte dem Geheimdienst abenteuerliche Geschichten auf. Zum Beispiel behauptete er, dass der k.u.k. Offizier Adolf Hofrichter, der 1909 seinen Konkurrenten Giftpillen geschickt hatte, um den Aufstieg ins Generalstabskorps zu schaffen, für die Franzosen spioniert hatte.201 Auch der „Rockdieb“ und Spion Josef Jeczes, den Ronge bereits hinter Gitter gebracht hatte, machte von sich reden, als er gegenüber der Presse behauptete, vom Treiben Alfred Redls gewusst zu haben. Dass er damit an die Öffentlichkeit trat, nachdem der Generalstabsoffizier enttarnt worden war und die Affäre durch sämtliche Gazetten geisterte, machte diese Enthüllung nicht eben glaubwürdig. In den Augen Ronges war all das purer Unsinn.
Dennoch beanspruchten Gestalten wie Cords oder Jeczes nicht wenig von Ronges ohnehin knapp bemessener Zeit. In seinen beiden Büchern, die er nach dem Ersten Weltkrieg verfasste, präsentierte er all diese Namen samt ihren Geschichten gleichsam als Beweis für seine Erfolge als „ Jäger der Spione“. Aber hatte er nicht größtenteils „kleine Fische“ zur Strecke gebracht, zweit- und drittklassige Wichtigtuer, die vor allem den Zeitungen Stoff lieferten?
Aehrenthal und Conrad
Generalstabschef Conrad gehörte zu jenen, die sich schon berufsbedingt für die Leistungen Maximilian Ronges interessieren mussten. Dieser wiederum verfolgte die Karriere des Generals mit wachsender Sorge. Richtig eingeschätzt hat Ronge die Hintergründe für die im Dezember 1911 erfolgte Ablösung Conrads durch Blasius von Schemua dennoch nicht. Jedenfalls sprach er explizit vom Rücktritt seines Idols. Der Generalstabschef habe sich, so Ronge, des ewigen Bettelns um mehr Geld für den Kundschaftsdienst bei Außenminister Aehrenthal überdrüssig geworden, zurückgezogen.202 In Wirklichkeit lagen die Dinge anders. Conrad ging nicht freiwillig, sondern „wurde gegangen“. Die Auseinandersetzungen zwischen dem General und dem Außenminister, die bei weitem über die Frage der Dotierung des Evidenzbüros hinausging, hatten sich zugespitzt. Konkreter Anlass für die Verschärfung des Konflikts zwischen den beiden Männern war die Beurteilung des italienischtürkischen Krieges gewesen, der im September 1911 ausbrach und um Libyen ausgetragen wurde. Während Wien gerade schwere Hungerkrawalle erlebte und Ronge Truppendienst in Esztergom leistete, schlüpfte Conrad wieder einmal in die Rolle des Rufers in der Wüste. Mit ihm waren auch andere davon überzeugt, dass das militärisch in Nordafrika gebundene Italien nun leicht zu schlagen sei. Aehrenthal wollte davon nichts wissen. Die ständige Hintertreibung der Außenpolitik Österreich-Ungarns durch den Generalstab sei nicht länger hinnehmbar. Er forderte den Kopf des Generalstabschefs.
Egal, gegen wen Conrad gleichsam prophylaktisch Krieg führen wollte, ob gegen Italien oder vor allem Serbien, beim Außenministerium am Ballhausplatz stieß er auf taube Ohren. Aber auch Franz Joseph winkte ab. Für die einen ein Prophet, der im eigenen Land nichts galt, für die anderen ein Kriegstreiber, nahm Conrad den Hut, als der Kaiser ihn unmissverständlich dazu aufforderte. Das Tauziehen zwischen Außenminister und Generalstabschef hatte ein Ende, Aehrenthal sich durchgesetzt. Lange konnte er von diesem Sieg aber nicht zehren. Wenige Wochen, nachdem der charismatische Conrad durch den vergleichsweise blassen Schemua ersetzt worden war, starb der Minister an Blutkrebs. Ihm folgte Leopold Graf Berchtold nach. Wie es zu dessen Ernennung kam, skizziert der österreichische Historiker Manfried Rauchensteiner so: „Es sollte jemand sein, der Erfahrungen mit Russland hatte. Deren gab es mehrere. Zum anderen sollte aber gewährleistet sein, dass die Aehrenthalsche Politik fortgesetzt würde und dass der neue Minister des Äußern und des kaiserlichen Hauses, der er ja gleichzeitig zu sein hatte, in die schwierige Konstellation bei Hof und in die Machtkreise hineinpasste. Da gab es dann nur mehr wenige.“203
Komfortabel war der Ministersessel am Ballhausplatz nicht. Dass er zu keinem Schleudersitz wurde, glich fast einem Wunder. Der Graf harrte trotz umstrittener Amtsführung drei Jahre aus. Während Berchtold sich damit abmühte, die oft genug von einander abweichenden Meinungen Franz Josephs und Franz Ferdinands in Einklang zu bringen, änderte sich infolge der neuen Machtverhältnisse für Max Ronge nicht viel. Und das, was sich änderte, bewertete er durchaus positiv: Conrads Nachfolger sah keine Veranlassung, das Evidenzbüro umzugestalten und erreichte nach dem Tod Aehrenthals im Februar 1912 sogar eine Aufstockung des Budgets für Nachrichtendienst und Militärspionage.204 In seiner Notlage hatte das Evidenzbüro in der Vergangenheit Spielmaterial angefertigt und es über Mittelsmänner ins Ausland verkauft. Von nun an, hoffte man, müsse diese Art der Geldbeschaffung nicht mehr bemüht werden.205
„Generalprobe“
Angesichts der Aufgaben, die in den folgenden Monaten auf den Leiter des Kundschaftswesens und seine Mitarbeiter zukamen, war aber selbst die nunmehr auf offiziellem Wege erwirkte, dringend benötigte Finanzspritze nicht ausreichend. So stellte es zumindest Max Ronge dar. Tatsächlich verliefen die Jahre 1912 und 1913 turbulent. Zwei Kriege wiesen den Balkan einmal mehr als Krisenherd aus. Die Arbeit des Evidenzbüros verschlang mehr Mittel denn je. Wieder hieß es, mit dem Wenigen, was vorhanden war, zu jonglieren. Der Leiter der Kundschaftsgruppe hatte alle Hände voll zu tun und konnte sich keineswegs auf seinen eben erst erworbenen Lorbeeren ausruhen. Immerhin hatte, wie es in der betreffenden Urkunde hieß, sich Franz Joseph „bewogen gefunden“, ihm das „Militärverdienstkreuz huldreichst zu verleihen“, und auch aus Berlin traf Brustschmuck für die Uniform ein: man ehrte Maximilian Ronge mit dem „Roten Adlerorden dritter Klasse“.206
Die Freude über die Auszeichnungen währte nur kurz. Zu ernst war die Lage, der sich das Habsburgerreich angesichts der kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Balkan gegenübersah. Damals schon musste die Ausweitung des Konflikts zu wenigstens europäischer Dimension befürchtet werden, und auch damals schon erwies sich Russlands Eingreifen zu Gunsten der Serben als eine nicht auszuschließende Variante. Auch Deutschlands Haltung gegenüber dem österreichisch-ungarischen Bündnispartner wurde nicht erst am Vorabend des Ersten Weltkriegs als wesentliches Moment für die Entscheidungsprozesse in der Habsburgermonarchie rund um die Frage für oder wider den Krieg bewertet. In gewisser Weise wurde 1912/13 schon der Juli 1914 geprobt, als die europäische Diplomatie zwischen Eskalation und Deeskalation hin- und herschaukelte. Auch jetzt gab es Drohgebärden und Ultimaten, Unterstützungszusagen und Hinhaltetaktik. Die Ingredienzien der Julikrise 1914 hatten zwar ein explosiveres Mischungsverhältnis, aber weit weg vom Weltkrieg war man auch zu dieser Zeit nicht gewesen: Im Winter 1912/13 standen das Zarenreich und die Donaumonarchie am Rande eines bewaffneten Konflikts. Es hätte nicht viel gefehlt, und der Krieg wäre ausgebrochen. Max Ronge jedenfalls glaubte an keine diplomatische Lösung mehr, als er sich an den „emsig betriebenen Kriegsvorbereitungen“ beteiligte.207 Konfidenten meldeten Truppenverschiebungen und Mobilmachungen jenseits der Grenze. Einige Nachrichten erwiesen sich „als Produkt übersteigerter Agentenphantasie“, andere waren durchaus ernst zu nehmen.208 Doch zu einer bewaffneten Auseinandersetzung mit dem Zarenreich kam es dann noch nicht. Ronge reagierte vermutlich ebenso wie Conrad mit Unverständnis, als wieder einmal Entwarnung gegeben wurde. Schließlich war die abermalige Berufung Conrads auf den Posten des Generalstabschefs von vielen als Signal einer aggressiveren österreichisch-ungarischen Haltung gedeutet worden.
Die Zähne zeigte das Habsburgerreich dann kurze Zeit später den Montenegrinern. Im Mai 1913 beschloss der gemeinsame Ministerrat der österreichischen und der ungarischen Reichshälfte die Einleitung von Mobilmachungsmaßnahmen entlang der Grenze zu Montenegro. Doch das mit Serbien eng verbundene Königreich gab klein bei. Die „militant diplomacy“ der k.u.k. Monarchie reüssierte. Diejenigen aber, die an der damaligen Außenpolitik Österreich-Ungarns vor dem Hintergrund der Balkankriege Kritik übten, sahen als Ergebnis einer indifferenten, aber mit militärischen Maßnahmen drohenden Diplomatie folgendes Szenario vor Augen: man hatte sich zwischen alle Stühle gesetzt, keine Freunde gewonnen, sondern die Schar der Feinde vergrößert. Andererseits waren die k.u.k. Diplomaten ob des deprimierenden Schicksals des Osmanischen Reichs zu Recht verunsichert. Den Beutezügen der Balkanstaaten hatte das einstmals so mächtige Imperium offenbar wenig entgegenzusetzen. Würde es dem Habsburgerreich bald ähnlich ergehen? War es nicht besser, gegenüber Aggressoren rechtzeitig eine klare Sprache zu finden, bevor man am Ende von ihnen „heimgesucht“ und überrannt wurde?
Mit dem Weiterbestand der Monarchie unvereinbar schienen insbesondere die Pläne Belgrads. Serbien wollte expandieren. Auf Kosten der Türken war es schon gewachsen. Und nun? Als im Sommer 1913 der 2. Balkankrieg ausbrach, gab sich der alte neue Generalstabschef, Conrad von Hötzendorf, der nach einem Jahr wieder in Amt und Würden war, besorgter denn je. Er befürchtete, dass man „nach Versäumen der bisherigen günstigen Momente mit verschränkten Armen das Schicksal über sich hereinbrechen lassen“ werde.209 Bald, so meinte der General, würde das Habsburgerreich wohl zu schwach sein, um es mit seinen Gegnern aufnehmen zu können. Russland schien sich bis an die Zähne zu bewaffnen, der Expansionsdrang Serbiens noch lange nicht gestoppt und auch der misstrauisch beäugte Bündnispartner Italien nicht „gesättigt“. Und die Zeit, so Conrad, arbeitete gegen die Interessen der k.u.k. Monarchie.
Schwachstellen
Dass die Monarchie eine günstige Gelegenheit hatte verstreichen lassen, um sich der lästigen Serben zu entledigen, glaubte auch Max Ronge, seit 1. Mai 1912 im Rang eines Majors. Er musste allerdings zugeben, dass der Kundschaftsdienst nicht optimal auf einen Krieg vorbereitet war. Trotz der Dossiers der Militärattachés und der Berichte von Konfidenten war man vom Ausbruch des Krieges 1912 völlig überrascht gewesen. Truppenverlegungen und andere Maßnahmen, die mit der Mobilisierung eines Heeres in Zusammenhang standen, waren von all den Zuträgern, die das Evidenzbüro in Bulgarien, Serbien, Montenegro oder Griechenland sitzen hatte, nicht nach Wien gemeldet worden. Trost spendete vielleicht die Tatsache, dass auch die Geheimdienste anderer Staaten in dieser Hinsicht nicht besser bilanzierten.
Nichtsdestoweniger herrschte Hochbetrieb im Evidenzbüro. Urbanskis Mitarbeiter arbeiteten bis in die späten Nachtstunden. Der Bericht für den Monarchen hatte schon um vier Uhr morgens bereit zu sein. Der kaiserliche Frühaufsteher erwartete, dass „die militärische Berichterstattung hinter jener der Tagesblätter nicht zurückstehen werde.“210
Das war nicht immer der Fall. Die vorhandenen Defizite im Betrieb des Evidenzbüros verwiesen vor allem auf das Zarenreich. Hier machten sich, so Ronge, die Mängel des „Kundschaftsapparates sehr unangenehm fühlbar. Weder wir noch Deutschland hatten stabile Konfidenten in militärischen Kreisen. Die Anwerbung von Konfidenten und ihre Ansiedelung in Russland ging langsam vor sich und verschlang das geringe, zur Verfügung stehende Geld.“211 Außerdem waren die rekrutierten Vertrauensleute nicht ausreichend militärisch geschult und lieferten daher selten jene Informationen, die der Generalstab in Wien benötigte. So kam es auch, dass die russischen Mobilisierungsmaßnehmen entweder gar nicht erfasst oder aber nicht richtig eingeschätzt wurden. Überdies hatte man es mit sich widersprechenden Nachrichten zu tun. Das Evidenzbüro empfahl sich so gesehen damals nicht gerade als Entscheidungshilfe für Generäle, die gerade an einem Krieg bastelten.
Während aber die auf das Romanowimperium gerichteten Waffen kalt blieben, wurden sie im Innern der Monarchie abgefeuert. 1912 wieder einmal in Ungarn. In Budapest brachen Unruhen aus. Das aktuelle Geschehen im Parlament lieferte den Anlass. Sechs Demonstranten wurden getötet, 182 verwundet. Die Hemmschwelle, gewaltsame Lösungen diplomatischen Kompromissen vorzuziehen, drohte nicht zuletzt angesichts immer wieder aufflammender Tumulte innerhalb der eigenen Grenzen zu sinken.212
Unterdessen sorgten einmal mehr die Russen mit ihrer, wie Ronge meinte, „großartigen Spionageorganisation“ dafür, dass die Abwehr nicht zur Ruhe kam.
Ein heikler Fall
In den Verdacht, militärische Geheimnisse ans Ausland verraten zu haben, gerieten die Brüder Jandrić Anfang 1913. Vor allem der Kriegsschulfrequentant Oberleutnant ˇedomil Jandrić, zog die Aufmerksamkeit der Polizeidirektion Wien und der Kundschaftsgruppe im Evidenzbüro auf sich. Ermittelt wurde aber auch gegen andere Offiziere. Der Kreis der Verdächtigen wurde immer größer. Neben den Jandrić-Brüdern wurden unter anderem auch ein Polizeiagent und ein pensionierter Feldwebel arretiert. Anfang April bestand kein Zweifel mehr, dass sie alle einen Auftraggeber hatten: den russischen Militärattaché Oberst Zankiewitsch. Ronge musste den Ballhausplatz informieren. Er wurde beim Außenminister persönlich vorstellig. Der Major schilderte die Begegnung wie folgt: „Wie zur Salzsäule erstarrt, blieb Graf Berchtold stehen und lange Zeit stumm, nachdem ich meinen Bericht vollendet hatte, bis ich endlich meine Frage, was er zu tun gedenke, wiederholte.“213 Der Außenminister gewann schließlich seine Fassung wieder und forderte die Abberufung des Militärattachés. Petersburg leistete keinen Widerstand. Aufsehen sollte vermieden werden. Zankiewitsch musste gehen. In aller Stille. „Als Trophäen“, so Ronge bitter, „nahm er die Spionageberichte der beiden Jandrić“ sowie der übrigen „Verräter“ nach Russland mit.214
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.