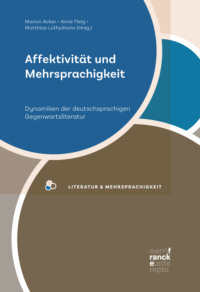Kitabı oku: «Affektivität und Mehrsprachigkeit», sayfa 3
3 Zu den Beiträgen
Die Beiträge des Bandes nähern sich diesem Verhältnis aus unterschiedlichen Perspektiven, die ihnen zugrundeliegenden Texte umfassen verschiedene Genres, die von Lyrik über poetologische Essays und Sprachbiographien bis hin zu Romanen und Romanexperimenten reichen. Die Wahl der Gattung bedingt maßgeblich die jeweilige Gestaltung von literarischer Mehrsprachigkeit und Vielstimmigkeit. Es haben sich drei Schwerpunkte herauskristallisiert, die mit den skizzierten theoretischen Fragen korrespondieren, und die dem Band seine Struktur geben: Affekt und Sprachkritik, Mehrsprachigkeit und Zugehörigkeit sowie der Zusammenhang von Emotion und Erinnerung.
Den Auftakt bildet ein am 2. November 2017 geführtes Gespräch mit der Autorin und Büchner-Preisträgerin Terézia MoraMora, Terézia, das sich auf Grundlage ihrer Salzburger Poetik-Vorlesung Der geheime Text (2016) und ihrem Roman Das Ungeheuer (2013) mit der Rolle der Mehrsprachigkeit für ihr eigenes Schreiben und dem Schreiben ihrer Protagonistin Flora auseinandersetzt. Wie der Strich in Das Ungeheuer deutlich markiert, führt ein ‚Mehr‘ an Sprachigkeit keineswegs zu mehr Verständnis; außerdem macht er sichtbar, dass mehrsprachiges Schreiben an gesellschaftliche Hierarchien gebunden ist.
Die Beiträge der ersten Sektion beschäftigen sich mit der Frage, wie und auf welche Weise mehrsprachige Literatur selbst Sprache verhandelt. Sprachreflexion und Sprachkritik können nicht nur generell als prominente Merkmale moderner Literatur gelten, sie spielen insbesondere in mehrsprachigen Texten eine zentrale Rolle. Ob und wie sprachkritische Verfahren dabei von mehrsprachigen Verfahren abzugrenzen sind oder ob mehrsprachige Literatur per se sprachreflexiv oder gar sprachkritisch verfährt, wird in diesem Abschnitt diskutiert. Mit Blick auf die Einsprachigkeitsnorm und die Muttersprachensemantik im Diskurs moderner Autorschaft geht es darüber hinaus um die Frage, ob es spezifische Sprachpolitiken der Mehrsprachigkeit gibt und wie diese gegenüber dem affektiv hochbesetzten Monolingualismus positioniert sind. Diese nicht zuletzt politische Dimension literarischer Arbeit an der Sprache analysiert Till Dembeck am Beispiel des Zürcher Dada. In historischer Perspektive stellt er die künstlerische Auseinandersetzung mit der Muttersprachensemantik in den Gedichten von Richard HuelsenbeckHuelsenbeck, Richard, Marcel JancoJanco, Marcel und Tristan TzaraTzara, Tristan sowie Hugo BallBall, Hugo in Beziehung zu den epochemachenden linguistischen Theoremen Ferdinand de SaussuresSaussure, Ferdinand de. Dembeck arbeitet minutiös heraus, dass zwischen den Sprachpolitiken der Dadaisten ebenso zu unterscheiden ist wie zwischen Saussures originalen Überlegungen und der späteren, monolingual ausgerichteten langue-Linguistik. Er weist damit nicht nur auf unbekannte und unerwartete Berührungspunkte zwischen diesen beiden wirkmächtigen Sprachexperimenten hin, sondern zeigt auch, was eine Kulturpolitik des Affekts auszeichnen könnte.
Anhand lyrischer Texte der sogenannten Bukowiner Literatur untersucht Jürgen Brokoff die Bedeutung historisch-politischer und kultureller Konstellationen für eine Poetik der Mehrsprachigkeit. Im Zentrum seines Beitrags stehen Gedichte von Paul CelanCelan, Paul und Rose AusländerAusländer, Rose, deren affektive Dimensionen angesichts der Erfahrung der Shoah im Spannungsfeld von Verständigung und Entzweiung, Zweisprachigkeit und Einmaligkeit der Dichtung verortet werden. Mit vergleichenden Seitenblicken auf den Sprachkritiker Fritz MauthnerMauthner, Fritz, den Lyriker Oskar PastiorPastior, Oskar und die Autorin Herta MüllerMüller, Herta zeigt Brokoff, dass Überlagerungen, Konkurrenzen und Verflechtungen mehrerer Sprachen ein ebenso konflikthaftes wie produktives Potential zu entfalten vermögen. Die Ambivalenzen der Mehrsprachigkeit im Werk Herta Müllers arbeitet Marion Acker heraus. Die Sprachkritik und das fundamentale Misstrauen gegenüber der Repräsentationsfunktion der Sprache, das sich in Müllers Texten artikuliert, verbindet sie mit den Ansätzen der affect studies. Ausgehend von der Beobachtung, dass bei Müller spezifische autofiktionale Versatzstücke, Szenen und dicht beschriebene zeit-räumliche Arrangements textübergreifend ihr gesamtes Werk charakterisieren, untersucht Ackers Beitrag die affektive Wirkung dieser sich wiederholenden Re-Präsentation und die Rolle, die sie in MüllersMüller, Herta literarischer Verhandlung von Zugehörigkeit und insbesondere Nicht-Zugehörigkeit spielt. Demgegenüber setzt Claudia Hillebrandt mit ihrer emotionswissenschaftlichen Analyse eines Loop-Gedichts Rike SchefflersScheffler, Rike, dessen Performance die elektronische Bearbeitung der Stimme involviert, einen anderen Akzent: Zwischen Sprache und Emotionen analytisch zu trennen, sei für die emotionswissenschaftliche Erforschung von Literatur unerlässlich. Entsprechend schlüsselt Hillebrandt Schefflers Gedicht in ihrer Interpretation exemplarisch nach verschiedenen Verfahren der literarischen Präsentation von Emotionen auf. Damit formuliert sie nicht nur wichtige Rückfragen an die Mehrsprachigkeitsphilologie, sondern schlägt auch ein differenziertes Modell für die emotionswissenschaftliche Untersuchung von Lyrik vor.
Wenn gerade anhand literarischer Mehrsprachigkeit besonders deutlich wird, dass Affekt und Sprache nicht voneinander getrennt werden können, dass sie sich vielmehr auf komplexe Weise bedingen und ineinandergreifen, wie die Beiträge der ersten Sektion unter Beweis stellen, hat das wichtige Implikationen für die Theoretisierung von Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit. Ob sich die literarische Artikulation von Zugehörigkeit dabei über kulturelle Schreibpraktiken oder Schriftbildtraditionen, in der literarischen Gestaltung urbaner Räume oder in der Verwendung einer um Drastik bemühten Sprache ausdrückt – die literarische Artikulation von Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit vollzieht sich notwendigerweise in der Verbindung von Affekt und Sprache.
Den auf diese Dynamiken der Zugehörigkeit bezogenen, zweiten Themenschwerpunkt unseres Bandes eröffnet Robert Walter-Jochum. Sein Beitrag analysiert eine markante affektive Form des Sprechens, nämlich die Hassrede. In Feridun ZaimoglusZaimoglu, Feridun frühen Texten erkennt Walter-Jochum nicht nur eine produktive Form der Aneignung von fremdenfeindlichem und rassistischem hate speech, sondern auch eine Form der Subjektbildung, für die der Affekt des Hasses geradezu konstitutiv ist. Indem er Zaimoglus Texte in den Kontext der Debatten um den Begriff der ‚postmigrantischen Gesellschaft‘ rückt, leistet er auch einen theoretischen Beitrag zur sozialen Dimension der Affektivität der Literatur.
Sandra Vlasta untersucht in ihrem Beitrag über Tomer GardisGardi, Tomer Roman broken german, der jüngsten Publikation, die in diesem Band behandelt wird, eine Form der literarischen Mehrsprachigkeit, die in ihrem bereits titelgebenden Bruch mit dem Standarddeutsch einige Ähnlichkeiten zu ZaimoglusZaimoglu, Feridun frühen Texten aufweist. Vlasta zeigt, wie die auf mehreren Ebenen thematisierte Mehrsprachigkeit in Gardis Text emotionale Verbindungen schafft. Sie arbeitet damit einen Aspekt des Romans heraus, der Zaimoglus’ Sprachexperimenten durchaus entgegensteht: Denn bei Gardi werden urbane Nicht-Orte, wie Call Shops oder Internetcafés, in ihrer Mehrsprachigkeit zu Orten empathischer Begegnung. Im Unterschied zu individualistischen Ansätzen der Emotionsforschung hält Vlasta fest, dass broken german damit die Möglichkeit eröffnet, Gefühle der Zugehörigkeit über kulturelle und sprachliche Differenzen hinweg zu teilen.
Am Beispiel von Emine Sevgi ÖzdamarÖzdamar, Emine Sevgi, Rafik SchamiSchami, Rafik und Yoko TawadaTawada, Yoko geht Monika Schmitz-Emans der Frage nach dem Zusammenhang von Affektivität und (Fremd-)Schriftlichkeit nach und rückt somit eine spezifische Dimension von Sprache in den Blick, der mehrsprachige Literatur auffällig viel Aufmerksamkeit widmet: ihre sinnliche Materialität. Diese kann – wie schon die Doppeldeutigkeit des titelgebenden Terminus der „Schrift-Passionen“ hervorhebt – sowohl innerfiktional als auch hinsichtlich ihrer rezeptionsästhetischen Wirkung widersprüchliche, zwischen Faszination, Irritation oder auch Aversion changierende Gefühle hervorrufen. Schmitz-Emans führt verschiedene direkte und indirekte „Formen des literarischen Kalküls mit fremder Schrift“ vor Augen und erörtert deren affektiv-emotionale Potenziale im Zusammenhang mit dem Leit-/Leid-Thema der Texte, Liebe und Passion. Als „eine Art Liebeserklärung an die Möglichkeiten der deutschen Sprache“ bezeichnet die Autorin Marica BodrožićBodrožić, Marica ihren Essay „Sterne erben, Sterbe färben. Meine Ankunft in Wörtern“, welcher im Zentrum von Monika Behraveshs Beitrag steht. In ihrer Textanalyse kann sie, hierin an Schmitz-Emans anschließend, die Verortung affektiver Wirkungspotenziale in der Materialität von Sprache nachweisen. Einen wichtigen Aspekt bildet dabei die Verschränkung von autobiographischer Rückschau und poetologischer Reflexion in Bodrožićs Auseinandersetzung mit ihrem Erwerb der deutschen Sprache. In diesem Zusammenhang gelingt es Behravesh, linguistische Ansätze wie das Konzept der linguaculture oder den Begriff des Spracherlebens, insbesondere die ihm inhärente affektiv-emotionale Komponente, für die Analyse literarischer Mehrsprachigkeit produktiv zu machen.
Mit BodrožićsBodrožić, Marica Prosa befasst sich auch der Beitrag von Esther Kilchmann, nun jedoch in einer anderen, den dritten Themenkomplex eröffnenden Blickrichtung. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Bedeutung von Mehrsprachigkeit und Sprachwechsel im Kontext von Erinnerungsprozessen, die zunächst unter theoretischem Gesichtspunkt erörtert wird. Der Beitrag zeichnet erstmalig die Geschichte dieser Frage in der Psychoanalyse des 20. Jahrhunderts nach. Auf dieser Grundlage analysiert er die mehrsprachige Erinnerungspoetik im Werk von BodrožićBodrožić, Marica und zeigt dabei auf, dass Sprachwechsel einerseits als Medium der Verdrängung fungiert, andererseits aber auch therapeutische Funktion besitzt, die zugleich zum produktiven Antrieb des Schreibens wird.
Annette Bühler-Dietrich beschäftigt sich ebenfalls mit psychoanalytischen Ansätzen; der theoretische Ertrag ihres Beitrags resultiert aus der gewinnbringenden Verknüpfung von Affektkonzeptionen unterschiedlicher Provenienz. An den Affektbegriffen der Psychoanalyse und der an SpinozaSpinoza, Baruch de und DeleuzeDeleuze, Gilles/GuattariGuattari, Félix anschließenden Traditionslinie der affect studies interessiert Bühler-Dietrich weniger ihr spezifisches Spannungsverhältnis, vielmehr stellt sie über den Schmerz als tertium comparationis ihr verbindendes Element heraus. Am Beispiel von Katja PetrowskajasPetrowskaja, Katja Vielleicht Esther (2014) analysiert sie den engen Zusammenhang von Sprache, Affekt und Erinnerung. Mehrsprachigkeit deutet sie als einen Weg, Verlustschmerz zu artikulieren und zu balancieren. Der Beitrag von Lena Wetenkamp schließlich untersucht den polyphonen Raum der Mehrsprachigkeit bei Ilma RakusaRakusa, Ilma. Entlang der Sprachbiographie der Autorin analysiert Wetenkamp den Zusammenhang von Sprach-, Affekt- und Erinnerungsräumen. Gleichzeitig reflektiert sie den literaturwissenschaftlichen Umgang mit poetologischen, an der Schnittstelle von Autobiographie, Sprachreflexion und Produktionsästhetik angesiedelten Texten, die sie als eine von verschiedenen möglichen Formen der Diskursivierung von Mehrsprachigkeit begreift. Während Wetenkamps Beitrag die Subjektivität affektiver Besetzungen verdeutlicht, fokussiert Susanne Zepp auch die überindividuelle Dimension autobiographischer Geschichtserfahrung. Am Beispiel von Georges-Arthur GoldschmidtGoldschmidt, Georges-Arthur und Hélène CixousCixous, Hélène geht sie der These nach, dass das Nachdenken über die Wahl der Sprache zum Modus der jeweiligen sprachlichen Reflexion von historischer Erfahrung wird. Beiden Beiträgen ist ein zentraler Befund gemeinsam: Die Affektivität von Sprache kann sich auf verschiedenen Ebenen manifestieren, sie reicht bis in das einzelne Wort in all seine Schichten hinein. Spricht RakusaRakusa, Ilma von „aufgeladenen Teilchen“, die mit Erinnerungen und Assoziationen verknüpft sind, so stellt die Reflexion des einzelnen Wortes als „Trägermaterial von Affekten“ den zentralen Berührungspunkt zwischen Hélène CixousCixous, Hélène und George-Arthur Goldschmidt essayistischen Texten dar. Insgesamt verdeutlicht Zepps Beitrag eine Annahme, die für den gesamten Band leitend ist: nämlich die der Relationalität von Affektivität, „die im Kontext von Sprache und Geschichte wirksam wird“.
Danksagung
Der vorliegende Sammelband geht auf eine Tagung zurück, die vom 2. bis 4. November 2017 an der Freien Universität Berlin stattgefunden hat und vom Teilprojekt „Geteilte Gefühle. Zugehörigkeit in der transkulturellen deutschsprachigen Gegenwartsliteratur“ des Sonderforschungsbereichs 1171 Affective Societies veranstaltet wurde. Wir möchten uns bei allen herzlich bedanken, die uns eine Diskussion unserer Arbeit und diesen Band ermöglicht haben: An erster Stelle danken wir den Beiträgerinnen und Beiträgern für ihre Bereitschaft, sich auf die hier umrissenen Herausforderungen so engagiert eingelassen zu haben. Dem Sonderforschungsbereich gilt unser doppelter Dank: Zum einen für die organisatorische Hilfe, zum anderen für den intensiven interdisziplinären Austausch, dem wir viele theoretische Impulse verdanken. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) sei für die Ermöglichung unserer Forschungsarbeit sowie die Finanzierung der Tagung und Publikation gedankt. Dem Francke-Verlag und insbesondere Tillmann Bub danken wir für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Dass wir mit diesem Band die neue Reihe „Literarische Mehrsprachigkeit“ eröffnen dürfen, ist uns eine besondere Freude. Unser Dank gilt daher auch Till Dembeck und Rolf Parr als Initiatoren und Herausgebern dieser Reihe. Schließlich möchten wir uns bei Larissa Hesse für ihre Hilfe und Sorgfalt beim Redigieren der Beiträge bedanken.
„Der geheime Text“ – Terézia Mora im Gespräch mit Anne Fleig
In ihrer Poetik-Vorlesung Der geheime Text (2016) reflektiert die zweisprachig aufgewachsene Autorin Terézia Mora ihren Weg von einer Sprache in die andere.1 Dieser Weg bildet nicht nur die Grundlage ihrer Autorschaft, sondern hat auch sichtbare und unsichtbare Spuren in ihren Texten hinterlassen. Anhand dieser Spuren verfolgt Der geheime Text verschiedene Formen und Funktionen der literarischen Mehrsprachigkeit, die Verfahren der Intertextualität und der Übersetzung einschließen. Das gegenwärtige Interesse der Literaturwissenschaften am Thema der Mehrsprachigkeit hat die Autorin in ihrer an der Universität Salzburg gehaltenen Vorlesung explizit begrüßt, da es die Möglichkeit biete, mit anderen Sprachen auch andere Geschichten in den hegemonialen Diskurs einzuspeisen und unbekannte Sätze ‚weiterzuverteilen‘.2
In Moras Roman Das Ungeheuer (2013) ist es Flora, die in ihren tagebuchähnlichen Aufzeichnungen, ihrem ‚geheimen Text‘, die Sprache wechselt und Sätze weiterverteilt. Dabei wird deutlich, inwiefern verschiedene Sprachen Erinnerungen und Gefühle, aber auch literarische Formen prägen. Dass ‚teilen‘ immer auch ‚trennen‘ bedeutet, wird im Text durch den horizontalen Strich kenntlich, der jede Seite durchzieht. Er markiert die sichtbaren und unsichtbaren Spuren von Mehrsprachigkeit, die nicht nur Darius Kopp als Leser von Floras Dateien, sondern auch die Leser und Leserinnen von Moras Roman vor erhebliche Herausforderungen stellen.
Zur Eröffnung der Tagung haben wir diskutiert, welche Rolle der Sprachwechsel für das Schreiben von Terézia Mora spielt, worin der ‚geheime Text‘ besteht und wer oder was das ‚Ungeheuer‘ ist? Im Folgenden dokumentieren wir Auszüge aus dem Gespräch, das am 2. November 2017 an der Freien Universität Berlin stattfand.
Anne Fleig: In ihrer Salzburger Poetik-Vorlesung sagen Sie: Schreiben beginnt mit der Beobachtung der Sprache. Ich denke, diese Beobachtung setzt einen bestimmten Abstand voraus. Wie hängt dieser Abstand mit Ihrer Zweisprachigkeit zusammen? Inwiefern entsteht daraus der ‚geheime Text‘?
Terézia Mora: Ich mache das nicht rituell: Ich bin Autorin und jetzt beobachte ich mal meine Sprache. Es ist vielmehr immer schon mein Hobby gewesen, auch, als ich noch keine Schriftstellerin war. Insofern entwickeln Sie dann eine gewisse Routine, bevor Sie anfangen zu schreiben.
Welche Rolle spielt die Zweisprachigkeit beim Schreiben?
Die Anwesenheit einer zweiten Sprache war insbesondere bei meinem ersten Buch Seltsame Materie (1999) für mich sehr spürbar. Das sind Erzählungen in einem einsprachig deutschsprachigen Buch, die ihren Ursprung aber in Ungarn haben, sie nähren sich aus Material, das ich aus Ungarn mitgebracht habe, und entweder deswegen, oder weil es mein erstes Buch war, haben sich beim Schreiben immer ungarische Wörter aufgedrängt. Und da musste ich zum Beispiel wahnsinnig aufmerksam sein, was ich da mache und das ist mir auch nicht überall gelungen, muss ich sagen. Manchmal habe ich auch danebengegriffen. Ich musste mich für ein deutsches Wort entscheiden und heute würde ich mich für ein anderes entscheiden. Aber beim zweiten Buch war das bereits, wie ich finde, überwunden, da konnte ich schon mehr so machen, wie ich es wollte.
Aber das ist eher eine Frage der Erfahrung als Autorin – oder würden Sie sagen, das ist eine Frage des Sprachwechsels oder der zwei Sprachen?
Ich würde durchaus sagen, das hat etwas mit der Erfahrung als Autorin zu tun. Bevor ich mein erstes Buch schrieb, habe ich schon ein wenig deutsche Literatur auf Deutsch gelesen, aber mitgebracht hatte ich hauptsächlich Literatur, die entweder Ungarisch im Original oder ins Ungarische übersetzt war. Ich kann mich deutlich an Momente des Sprachwechsels erinnern. Ganz einfaches Beispiel: Den „Panther“ von RilkeRilke, Rainer Maria habe ich zuerst auf Ungarisch übersetzt gelesen, und ich fand das ganz toll. Und dann habe ich das Original kennengelernt und das Interessanteste war, dass das Original jede Übersetzung, so schön sie auch war, sofort weggefegt hat. Und seitdem weiß ich nicht mehr, wie es auf Ungarisch war, ich weiß nur noch das Original.
Zwischen meinem ersten und dem zweiten Buch habe ich bewusst vieles, was ich vorher in der Übersetzung kannte, im deutschen Original nachgelesen oder ich habe deutsche Übersetzungen von durch mich hoch geschätzter internationaler Literatur, z.B. den Ulysses gelesen, um zu wissen, wie sich Literatur auf Deutsch überhaupt liest. Offenbar war ich der Meinung, dass das notwendig war, bevor ich selbst weiter deutschsprachige Literatur schrieb. In Wahrheit ist das natürlich überhaupt nicht notwendig. Aber ich fühlte mich so besser vorbereitet.
Ich fand Ihre Formulierung mit dem Sehen, dass Sie gesagt haben, „man beobachtet die Sprache“, auch deswegen interessant, weil Sehen dabei auf spezifische Weise eine Rolle spielt. Es gibt von Herta Müller Müller, Herta eine berühmte Formulierung, dass in jeder Sprache andere Augen sitzen. Und ich dachte …
Interessant, dass es Augen sind und nicht Ohren, ja.
Genau darauf zielt meine Frage.
Das ist spontan jetzt schwierig – „andere Augen“ … nicht unbedingt, ich würde eher auf die Ohren gehen …
Herta MüllerMüller, Herta hat damit ja zum Ausdruck bringen wollen, dass man durch jede Sprache seine Umwelt mit anderen Augen wahrnimmt.
Und vom Sehen ist sie zurückgegangen auf Augen und schon haben wir ein außergewöhnliches Bild. Das ist etwas, was Zweisprachige häufig machen! Du untersuchst das einzelne Verb, gehst dann zurück auf das Hauptwort, vergleichst es wieder mit anderen Sprachen und dann sagst du, ah interessant.
Aber ich bin tatsächlich bei Ihnen auf das Hören gekommen, denn Sie bringen immer wieder Lyrik als Beispiel. Auch jetzt in dieser Situation haben Sie als Beispiel Rilke Rilke, Rainer Maria s „Panther“ gewählt. Würden Sie mir nicht zustimmen, dass Sie immer wieder auf Lyrik zu sprechen kommen?
Es ist so, wenn man in Ungarn zur Schule gegangen ist, zumindest bis zum Ende der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts, denn nur darüber kann ich mich verbindlich äußern, hat man gelernt, dass die Lyrik alles ist. Man lernt wahnsinnig viele Gedichte von ‚unseren Dichtern‘ in ungarischen Schulen, das ist ganz wichtig. Und sie werden tatsächlich damit sozialisiert, weniger mit Prosa. Die Prosa, die wir zu meiner Zeit in der Schule lesen mussten, war unglaublich öde. Historische Romane. Und nicht aus literarischen, sondern aus historischen Gründen. Solange ich in die Schule ging, haben wir es nicht bis zur Gegenwartsliteratur geschafft, also zu den spannenden Sachen. Dabei ist in den siebziger Jahren mit der ungarischen Prosa etwas Phänomenales passiert. Man nennt das auch das Péter-Paradigma, weil recht viele Autoren Péter mit Vornamen hießen: Péter EsterházyEsterházy, Péter, Péter NádasNádas, Péter, Péter LengyelLengyel, Péter, Péter HajnóczyHajnóczy, Péter. Die ganzen Péters, und noch andere, die nicht Péter hießen, haben da was Tolles gemacht, was es bis dahin nicht gab. Ich musste mir es dann selber erlesen, in der Schule gab es dazu keinen Zugang. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass ich, wenn ich beim Schreiben auf eine Schicht zugreife, was ganz spontan passiert, ich meist bei den länger und tiefer verankerten Dingen lande, also bei der Lyrik. Die später verinnerlichte Prosa liegt darüber, auf einer neueren, einer bewussteren, weniger spontanen Ebene.
Ich hatte für mich die Lyrik mit dem Hören und dem Klang verbunden. Und da stellt sich natürlich die Frage: Inwiefern geht es Ihnen um diesen Klang, diese Materialität der Sprache?
Ich muss sagen, die Prosa, die ich mag, ist auch sehr rhythmisch. Einen EsterházyEsterházy, Péter-Satz können sie gar nicht monoton vor sich hinsagen, weil der ganze Satz sehr musikalisch ist.
Eine Frage, die uns sehr beschäftigt, und die auch mit Klang und Materialität zu tun hat, ist, inwiefern Sprache das Vermögen hat, Dinge oder Welt fremd zu machen? Das hat auch mit Affekten zu tun und Empfindung. Was heißt es für Sie, eine Sprache zu spüren?
Wichtig ist vor allem: welche Art von Literatur spricht mich an. Ich würde das tatsächlich als sinnliches Erlebnis beschreiben. Es ist so, dass ich auf Sachen, die ich gut oder schlecht finde, körperlich reagiere. Es kann buchstäblich passieren, dass man einen Text zum Kotzen findet. Das ist kein Zufall, uns allen geht das so.
Ich kann mich erinnern, wie ich einmal versucht habe, einen Text auf Ungarisch zu machen. Mein allererster literarischer Text war eine Erzählung mit dem Titel Durst, ich war 26 Jahre alt, und er war auf Deutsch. Wenn man mehrsprachig ist, taucht ja immer wieder die Frage nach diesem Moment auf, wo man sich entschieden hat, in einer der beiden Sprachen zu schreiben. Und abgesehen davon, dass ich in Deutschland lebte, und dass es widersinnig gewesen wäre, für einen deutschen Literaturwettbewerb auf Ungarisch zu schreiben, stellt sich die Frage: Was passiert mit dem Material, wenn du anfängst auf Deutsch zu schreiben und hättest du es auch auf Ungarisch machen können? 15 Jahre später habe ich die Probe aufs Exempel gemacht und versucht, Durst auf Ungarisch zu schreiben, es wenigstens anzufangen. Wobei das natürlich keine gute experimentelle Situation war, denn 15 Jahre später ist man ja nicht mehr an demselben Punkt. Man kann also nicht mehr herausfinden, was wirklich passiert wäre, hätte man es damals auf Ungarisch geschrieben. Tatsache ist, dass es jetzt, später, überhaupt nicht ging. Schon beim zweiten Satz auf Ungarisch hatte ich das Gefühl, ganz unsicher zu sein, obwohl ich mittlerweile schon einige Erfahrungen als Autorin gesammelt hatte. Während ich damals, als blutige Anfängerin, mit dem Deutschen ein ganz anderes, ganz sicheres Gefühl hatte. Da dachte ich schon nach dem ersten Satz, „Großvater trinkt“, ja, das ist es, von hier aus sehe ich die ganze Erzählung vor mir. Während das Ungarische ebenso deutlich nirgendwo hinführte.
Wenn Sie jetzt am Schreibtisch sitzen oder wo immer Sie auch schreiben, klingt dann noch die ungarische Sprache im deutschen Schreiben mit?
Durchaus an manchen Stellen, also dort, wo das Deutsche sehr dünn wird.
Was heißt das?
Wo mein Deutsch dünn wird, kommt das Ungarische herein. Mitunter tut sich beim Schreiben eine Lücke im Satz auf, weil mir nur das ungarische Wort einfällt. Warum ist das eine Lücke? Weil an dieser Stelle das Deutsche fadenscheinig ist oder das Ungarische sehr stark ist. Warum ist es stark, kommt dann die Frage. Warum kommt an dieser Stelle das ungarische Wort herein? Überprüfe: Inwiefern unterscheidet es sich von dem nächstmöglichen deutschen Wort? Kannst du das dann nehmen, ja oder nein? Du musst natürlich ein deutsches Wort nehmen, aber welches nimmst du? Das Ungarische ist im Grunde genommen eine Störung, aber auch eine Hilfe, denn offensichtlich befindest du dich im Satz an einem Punkt, wo für dich eine Frage entsteht. Du kannst sie nicht spontan beantworten, du musst darüber nachdenken. Also mache ich das. Das Ungarische ist auch jedes Mal präsent, wenn es inhaltlich evoziert wird, wenn zum Beispiel die Figur Ungarin ist oder die Behauptung aufgestellt wird, sie würde auf Ungarisch scheiben.
Mein Roman Das Ungeheuer enthält beispielsweise zwei Texte: Einmal den Text eines trauernden Ehemannes, der Deutscher ist, und einmal die nachgelassenen Aufzeichnungen seiner verstorbenen ungarischen Ehefrau Flora, die diese Aufzeichnungen auf Ungarisch verfasst hat. Wir wissen nicht genau, weshalb, aber wir können es uns denken: Weil das ihre geheime Sprache ist. Für mich als Autorin stellte sich daraufhin die Frage: In welcher Sprache schreibst du jetzt Floras Texte? Es wird am Ende zwar ein deutschsprachiges Buch sein, aber es wäre schlau, die Texte zuerst auf Ungarisch zu schreiben. Das ist ein sehr spannender Moment, weil ich ein paar Monate vorher die Erfahrung gemacht habe, dass ich immer noch nicht auf Ungarisch schreiben kann.
Das hat mich dann dazu veranlasst, einen halben Roman auf Ungarisch zu schreiben. Ich wusste, dass Das Ungeheuer schwierig werden würde, aber ich wollte, dass sich die beiden Texte radikal voneinander unterscheiden. Floras Text sollte tatsächlich etwas komplett anderes sein und dazu habe ich meine nicht mehr so gut beherrschte Muttersprache benutzt. Es kostete mich Blut, Schweiß und Tränen. Häufig fing ich an, auf Ungarisch zu schreiben, merkte jedoch: Das ist nicht Ungarisch, du übersetzt gerade! Ich habe das Schreiben in solchen Momenten dann immer radikal unterbrochen. Es war furchtbar! Schließlich habe ich mich aber mit Floras Text durchgequält und das hat tatsächlich dazu geführt, dass der Text weniger literarisch wurde oder besser gesagt, dass der Text privater und inoffizieller wirkt. Als ich damit fertig war, kam die nächste Herausforderung: Der Text sollte einsprachig deutsch sein und das heißt, dass der ungarische Text ins Deutsche gebracht werden musste, darauf achtend, dass ich ihn nicht verbessere. Das war ein wahnsinnig spannender Prozess. Das Ungeheuer ist das Buch, in dem ich das Ungarische ganz bewusst und ganz massiv eingesetzt habe, um einen speziellen deutschen Text zu erhalten.
Sie haben jetzt schon viel von Ihrem Verfahren erklärt, das auf Zweisprachigkeit beruht. Wie verhält sich das zur Frage des Originals, die wir vorhin am Beispiel Rilke Rilke, Rainer Maria diskutiert haben? Und inwiefern ist die Frage des Originals an Einsprachigkeit gebunden?
Ich schätze, für Sie als Germanistin ist die Frage wichtig, was das Original ist. Ich als Autorin kann sagen: Ich bestimme jetzt einfach mal, was das Original ist, nämlich das einsprachige Buch, das hier erschienen ist, und das Ungarische ist das, was als Hilfstext benötigt worden ist, um das Original zu erstellen. Die Frage wird dann nochmal kompliziert, wenn man bedenkt, dass es eine ungarische Übersetzung von diesem Buch gibt. Ich sagte dem ungarischen Verlag und der Übersetzerin, ich möchte, dass sie das deutsche Original nimmt und ins Ungarische übersetzt. Das heißt, es hätte dann sozusagen zwei ungarische Versionen gegeben. Das hat man aus verschiedenen Gründen abgelehnt. Erstens sicherlich aus Geldgründen. Und zweitens wollte sich die Übersetzerin vermutlich nicht in die Lage bringen lassen, in der ihre ungarische Version mit meiner hätte verglichen werden können. Deswegen ist die ungarische Ausgabe jetzt so, dass oben die Version der Übersetzerin ist und unten meine ursprüngliche. Ich weiß nicht, wie das wirkt, ich schaue mir das nicht an. Obwohl ich die Gründe des Verlags und der Übersetzerin verstehe, bin ich mit dieser Lösung nicht sehr glücklich. In der ungarischen Ausgabe steht jetzt das Ungarisch zweier Personen.
Mich interessiert diese Frage auch, weil die ungarischen Dateien auf Ihrer Homepage zu lesen sind und wir den Flora-Text in „Das Ungeheuer“ in Dateien haben. Ihr Ehemann trauert um sie und setzt sich mit ihrem Nachlass, das heißt ihren Tagebuchdateien auf einem Laptop, auseinander. Und was heißt das für uns? Halten wir das Original in den Händen oder gehören dazu auch die Dateien auf der Homepage?
Ich habe die Form der Datei deswegen gewählt, weil es sehr fragmentarisch sein sollte. Und wenn es im Text heißt, das steht in der Datei so und so, dann unterbricht es erstens den Lesefluss noch einmal, und zweitens hat der Ehemann keine andere Möglichkeit als die Reihenfolge danach festzulegen, wann die Datei zuletzt geändert wurde. Deshalb ist das garantiert nicht die Reihenfolge, in der sie ursprünglich geschrieben worden sind. Außerdem gibt es eine ganz lange Datei, in der Flora Träume gesammelt hat, die über mehrere Jahre gehen. Das heißt, unter dem Strich ist die Chronologie ganz anders, weil natürlich auf einem Rechner einzelne Dateien ganz anders liegen, als wenn ein langer Text als eine Datei da liegt.