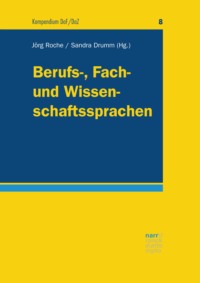Kitabı oku: «Berufs-, Fach- und Wissenschaftssprachen», sayfa 6
1.3.3 Wissenschaftskulturen
Wie wir gesehen haben, enthalten Fachsprachen „Hinweise auf die Subjekte […], die da fachlich sich miteinander zu verständigen suchen“ (Hess-Lüttich 1999: 212). Dieser Aspekt wird durch die Registertheorie hervorgehoben, die die sozialen Rollen der Subjekte in die Definition von Kommunikation einbezieht. Register sind sprachliche Variationen sozialer Gruppen, in deren Kommunikation die das Fach kennzeichnenden Erfahrungen und Orientierungen weitergetragen werden und „deren Kollektivität Fachlichkeit zuallererst begründet“ (Hess-Lüttich 1999: 212). Wissenschaft und Fachlichkeit können in diesem Zusammenhang als Kulturen begriffen werden, weshalb sich die Bedeutung der fachlichen Ausrichtung für die Sprache gut mit Überlegungen zu interkulturellen Unterschieden fassen lässt. Aber was ist im Hinblick auf Fachsprachen unter Kulturen zu verstehen?
In Lerneinheit 1.2 haben wir uns damit befasst, dass Fachsprache, Bildungssprache und Alltagssprache auf einem Kontinuum der Abstraktion miteinander verbunden sind (vergleiche Roelcke 2010: 34ff). Gegenstände, die also wissenschaftlich erarbeitet wurden, werden zum Beispiel in schulische Materialien eingebunden und damit vermittelt. Zwar sind die hier produzierten Texte nicht an der Erarbeitung und Aushandlung der Gegenstände beteiligt, sie sind aber Teil der (in diesem Fall vermittelnden) Fachkommunikation (vergleiche Roelcke 2010: 38f). Da Gegenstand und Versprachlichung des Gegenstandes untrennbar zusammenhängen, lassen sich fachliche Sachverhalte nur in fachsprachlicher Form begreifen, weshalb sich auf allen Abstraktionsstufen fachsprachliche Mittel nachweisen lassen. Diese Mittel sind Ausdruck des fachlichen Diskurses. Diskurse können charakterisiert werden als Auseinandersetzungen mit einem Thema im Rahmen unterschiedlicher Texte und Äußerungen, innerhalb mehr oder weniger großer gesellschaftlicher Gruppen. Der Diskurs ist jedoch nicht nur zu verstehen als der Austausch und die Aushandlung von Informationen, sondern ebenso als kulturelles Deutungsmusterkulturelles Deutungsmuster, auf dessen Hintergrund die Welt begriffen und kontextualisiert wird (vergleiche Gardt 2007: 26). Diese Vorstellung kann verglichen werden mit einer Art Denkstil, der umfasst, was in einem Fach als Fragestellung, als Problem, als Methode und als zulässiges Ergebnis gelten kann. Denken wir beispielsweise an die Frage, ob es einen Weltgeist gibt. Diese Frage ist für die Biologie nicht zulässig, da sie mit biologischen Methoden nicht erforscht werden kann. In der Philosophie hingegen kann man sich dieser Frage durchaus nähern. In bestimmten Gruppen beziehungsweise fachlichen Kulturen sind also unterschiedliche Fragestellungen gültig. Fachdiskurs und Fachkultur hängen ebenso zusammen wie Sache und sprachlicher Ausdruck. Im Diskurs tauschen sich Kulturen über die sie betreffenden Gegenstände aus und definieren gleichzeitig ihre Sicht auf Welt durch die Aushandlung der Gegenstände. Fächer zeichnen sich in diesem Sinne durch spezifische kulturelle Deutungsmuster aus, wie eben am Beispiel von Biologie und Philosophie verdeutlicht wurde.
Denken wir nochmals an die wissenschaftlichen Fächer. Wissenschaft nimmt für sich in Anspruch, die Welt neutral und objektiv zu beschreiben. Der Diskurs basiert auf Strukturen und Ausdrucksweisen, die dieser Objektivität verpflichtet sind. Auf der sprachlichen Ebene wird die Objektivität und Neutralität in jedem Text wieder neu hergestellt, indem Passivkonstruktionen und Substantivierungen verwendet werden. Die Denkmuster einer Fachkultur sind in der Regel implizit und werden von einer Gemeinschaft unreflektiert verwendet, sie können aber auch zum Gegenstand der Reflexion gemacht werden.
Im deutschen Wissenschaftsdiskurs ist der fachwissenschaftliche Text in der Regel prozesshaft und jeder Schritt wird nacheinander beschrieben. Dies beginnt mit der Problemstellung, dem Erkenntnisinteresse und der Fragestellung. Dem folgen in der Regel die Theorie und der Forschungsstand. Wenn es sich um empirische Arbeit handelt, werden dann die Methoden vorgestellt und gegebenenfalls diskutiert. Die Ergebnisse werden anschließen zuerst dargestellt und dann diskutiert. Abgeschlossen werden Arbeiten in vielen Fächern durch ein Fazit und einen Forschungsausblick, in dem Fragen besprochen werden, die im Rahmen der Ergebnisse aufgetaucht sind. Damit wird die Arbeit mehrfach im eigenen fachlichen Feld verortet: Theorie, Forschungsstand und weiterführende Fragen binden sie in das Feld ein, in dem sie entstanden ist.
Selbstverständlich finden sich hier von Fach zu Fach Unterschiede, doch die Tendenz zur Nachzeichnung des Forschungsprozesses bleibt erhalten. Dabei sorgen einerseits die fachspezifischen Unterschiede im Konzeptualisieren der Welt für unterschiedliche Arbeits- und Forschungsmethoden. Andererseits sind kulturspezifische Präferenzen für die eine oder andere Darstellungsweise bedeutsam (vergleiche Roche 2012: 43). Zum Beispiel werden in Arbeiten, die im deutschen Wissenschaftssystem geschrieben werden, häufig auch zusätzliche Informationen gegeben, die für einen umfassenden Blick auf das Thema dienlich sind. Dies können beispielsweise Informationen zu grundlegenden methodischen Entscheidungen und Alternativen sein, die im Vorfeld des Experiments getroffen worden sind oder alternative theoretische Positionen. Ein anglo-amerikanisch geprägter Wissenschaftstext setzt diese Inhalte voraus, und bietet sie daher nicht an. Auch methodische Entscheidungen können ausgelassen werden, sofern verständlich bleibt, wie die Studie durchgeführt wurde. Der anglo-amerikanische Text wirkt damit aber aus deutscher Sicht unvollständig. Umgekehrt erscheint der deutsche Text als umständlich und lang. An diesen Beispielen sehen wir, dass sich einerseits in der Sprache die Sicht auf Wissenschaft spiegelt und andererseits Sprache und Kultur die Wissenschaft abbilden, sie strukturieren und Maßstäbe setzen. Daher sind Diskurse und die Interpretation von Genres und Textmustern nicht nur fachbezogen, sondern auch interkulturell geprägt und müssen von Lernern als solche verstanden werden: „Die Interpretation der Kategorien sagt […] mehr über den [fachkulturellen Hintergrund des] Interpreten als über den Produzenten aus“ (Roche 2012: 34).
Lerner sollten sich, besonders im Kontext des fremdsprachlichen Fachunterrichts, darüber klar werden, dass sie Texte, Äußerungen, Abbildungen und andere Kommunikationsmittel aus der Sicht der Fachlichen und kulturellen Prägung, die sie bis dato erfahren haben, betrachten. Irritationen und Verwirrungen wie an den gezeigten Märchenbeispielen auffällig geworden, können die Folge sein. Daher müssen fachliche Varietäten, Register und Genres im Unterricht ebenso thematisiert werden wie fachsprachliche Mittel und Strukturen. Dabei besteht die Hauptaufgabe des fachsprachlichen Unterrichts in der Sensibilisierung für solche Unterschiede und Denkmuster. Die Lerner sollen zur eigenständigen Erarbeitung der betreffenden Phänomene und Besonderheiten angeleitet werden. Ziel ist es, dieses Wissen als Instrument der selbstgesteuerten Aneignung neuen fachlichen Wissens zu betrachten (vergleiche Thielmann 2010: 1056). Bedeutsam ist, dass Lerner im Umgang mit Wissen unterschiedlich sozialisiert sind und Selbständigkeit im Lernprozess interkulturell unterschiedlich bewertet wird.
Sprachliche Variation in der Fachsprache ist Teil der realen Sprachverwendung im Fachkontext. Es kann besonders mit erwachsenen Lernern zielführend sein, aus authentischen Genres Regeln konstruktiv abzuleiten und zu erproben. Die authentischen Varietäten bilden zudem die Bedingungen der Kommunikation realistisch ab. Dies gilt beispielsweise für das Verhältnis zwischen Akteuren und Gegenständen, Situation und Adressaten. Die Behandlung konkreter Äußerungsformen im Unterricht erhöht unter Umständen auch das Interesse an der Sprache und Kultur insgesamt (vergleiche Roche 2008a: 160).
1.3.4 Zusammenfassung
Die Funktion der fachsprachlichen Texte und Äußerungen beinhaltet die zwei Dimensionen Zweck und Darstellungsverfahren.
Fachsprachliche Varietäten und Register müssen beherrscht werden, um angemessen im Fach kommunizieren zu können.
Fachliche Genres stellen festgelegte Muster für fachsprachliche Kommunikationssituationen dar, die beachtet werden müssen.
Varietäten, Register und Genres sind Ausdruck spezifischer fachlicher Diskurse und Kulturen, die Lerner als solche wahrnehmen lernen müssen.
1.3.5 Aufgaben zur Wissenskontrolle
1 Ein Register ist eigentlich eine Form der Sortierung in Dokumenten. Warum hat man diesen Begriff in der Sprachwissenschaft gewählt? Fassen Sie hier nochmal zusammen, was Sie bisher über Varietäten und Register gelernt haben. Notieren Sie, was die beiden Begriffe mit der Funktion von Fachsprachen zu tun haben könnten.
2 Notieren Sie die Charakteristika von Genres links in die Tabellenspalte. Ergänzen Sie dann die Lücken für die genannten Genres.
| Bezeichnung | Predigt | Anekdote | Wissenschaftlicher Vortrag |
| Soziale Situation | |||
| Spezifische Charakteristika | |||
| Medium |
1 Vergleichen Sie die beiden Rotkäppchen-Texte im Abschnitt 1.3.2. Beide sind fachspezifisch formuliert und aufgebaut. Notieren Sie: Welche Genre-Unterschiede können Sie feststellen? Welchem Fach würden Sie den jeweiligen Text zuordnen? Warum? Beziehen Sie sich dabei auf das, was Sie über Genres gelernt haben. Welchen Eindruck vermitteln die Texte auf Sie als Leser?
2 Wie wir gesehen haben, kommen die Lerner mit fachlichen Vorkenntnissen und Interessen in den fachbezogenen Fremdsprachenunterricht. Dies umfasst auch eine gewisse Fachkultur. Was ist unter Kultur zu verstehen und was hat dieser mit Fachsprachen und Fachsprachenunterricht zu tun? Notieren Sie Ihre Überlegungen.
2 Linguistische Aspekte von Fachsprachen
Dieses Kapitel befasst sich mit linguistischen Aspekten von Fachsprache (n) und konzentriert sich dabei auf drei Hauptaspekte: Wortschatz der Fachsprachen, Grammatik der Fachsprachen und Übersetzung von Fachsprachen. Bei der Behandlung dieser Schwerpunkte ist es hilfreich, sich zunächst zu überlegen, wie sich Fachsprachen von der „normalen“ Alltagssprache in linguistischer Hinsicht, das heißt lexikalisch und grammatikalisch, unterscheiden, und daraus abzuleiten, wie sich diese fachsprachlichen Merkmale auf das Unterrichten beziehungsweise Übersetzungen von Fachsprache auswirken. Wie viele und welche Fachsprachen gibt es eigentlich? Sind die einzelnen Fachsprachen einander sehr ähnlich, oder unterscheiden sie sich so deutlich, dass sich nicht so viel verallgemeinern lässt? In welchen Aspekten unterscheidet sich der Wortschatz einer Fachsprache, der sogenannte Fachjargon, vom alltäglichen Wortschatz und warum ist das so? Welche grammatikalischen und textuellen Strukturen sind für Fachtexte typisch? Und welche Konsequenzen haben diese Eigenschaften, wenn man einen fachsprachlichen Text in eine andere Sprache übersetzt oder wenn man Fachvokabular unterrichtet?
2.1 Lexikalische Eigenschaften von Fachsprachen
Susanne Borgwaldt & Magdalena Sieradz
Die vorliegende Lerneinheit befasst sich mit linguistischen Charakteristika der Fachsprache beziehungsweise einzelner Fachsprachen in Bezug auf den Wortschatz. Nachdem zunächst auf die Unterschiede zwischen Fachsprache, Gemeinsprache und Gesamtsprache eingegangen wird, befassen wir uns eingehender mit dem Fachwortschatz: In welche Klassen lassen sich die Wörter eines Fachtextes einteilen? Aus welchen Wortarten besteht der Fachwortschatz und was sind charakteristische Eigenschaften eines Fachworts? Aus welchen Sprachen werden Fachbegriffe entlehnt und was sind typische Wortbildungsmuster? Und was ist beim Wortschatzunterricht in einem Fachsprachenkurs zu beachten?
Diese Lerneinheit bildet zusammen mit den Lerneinheiten Grammatikalische Eigenschaften von Fachsprachen und Übersetzung und Dolmetschen von Fachsprache(n) eine Einführung in die linguistischen Aspekte von Fachsprachen. Kenntnisse aus dieser Lerneinheit bilden die Grundlagen für die nachfolgenden Kapitel.
Lernziele
In dieser Lerneinheit möchten wir erreichen, dass Sie
den Zusammenhang zwischen Gesamt-, Gemein- und Fachsprache beschreiben können;
lexikalische Eigenschaften des Fachvokabulars erkennen und analysieren können;
Aspekte der Wortschatzvermittlung beim Unterrichten von Fachsprache beschreiben können.
2.1.1 Wortschatz der Fach- und Wissenschaftssprache
Bevor wir uns mit dem Wortschatz der Fachsprache befassen, sollten wir zunächst kurz wiederholen, was Fachsprache eigentlich ist und wie sie sich von anderen Sprachvarietäten abgrenzen lässt.
Fachsprache kann als Teil der GesamtspracheGesamtsprache aufgefasst werden (vergleiche Hahn 1980: 395). Die Gesamtsprache besteht aus der GemeinspracheGemeinsprache (beziehungsweise Alltagssprache), der FachspracheFachsprache (das heißt, der Gesamtmenge der einzelnen Fachsprachen, zum Beispiel der Fachsprache der Musik, der juristischen Fachsprache oder der Medizinersprache) und aus weiteren Sprachvarietäten (zum Beispiel aus Dialekten, Soziolekten oder Ethnolekten).
Nach Abstraktionsgrad beziehungsweise Kommunikationsraum können Fachsprachen in drei Ebenen eingeteilt werden (siehe auch Kapitel 1); für die Fachsprache der Heilerziehungspflege finden sich beispielsweise illustrierende Beispiele bei Nicklas-Faust & Scharringhausen (2011: 617):
Zur TheoriespracheTheoriesprache in diesem Bereich gehört beispielsweise ein abstrakt formulierter Text wie Die Feststellung des Anspruchs auf Eingliederungshilfe erfolgt nach kriteriengeleiteter Diagnostik auf Grundlage des Klassifikationssystems ICD-10 oder ICF.
Die fachliche Umgangssprachefachliche Umgangssprache zwischen Heilerziehungspflegern und ihren Arbeitskollegen enthält für Außenstehende schwer verständliche Abkürzungen wie Mach du den Metzler bei Frau Bloch, ich fang die Mobi bei Herrn Falkner an.
Die VerteilerspracheVerteilersprache wird für die Kommunikation mit Laien, das heißt, den betreuten Personen oder ihren Angehörigen verwendet; sie steht in lexikalischer Hinsicht der Alltagssprache recht nahe, zum Beispiel: Hier, diese stehenden Hautfalten zeigen an, dass der Körper zu wenig Flüssigkeit hat.
Wie sich erkennen lässt, bauen Fachsprachen auf den alltäglichen Sprachstrukturen auf, enthalten jedoch bestimmte Merkmale, die nur für sie (und nicht für die Alltagssprache oder andere Sprachvarietäten) typisch sind und die sich nach Abstraktionsgrad beziehungsweise Kommunikationssituation unterscheiden.
2.1.2 Fachbegriffe und Termini
Fachsprachliche Besonderheiten sind vorwiegend auf der Wortschatzebene festzustellen (siehe zum Beispiel Fraas 1998: 428). Nach Buhlman & Fearns (2000: 44) macht das Fachvokabular der betreffenden Fachsprache in Fachtexten zwischen 15 % und 50 % des Wortschatzes aus.
Experiment
Was fällt Ihnen am Wortschatz dieses Auszugs des Bundesausbildungsförderungsgesetzes auf? Welche Wörter tauchen auch in der Gemeinsprache auf, welche nur in der Fachsprache? Gibt es Wörter, die in der Gemeinsprache eine andere Bedeutung besitzen als im Fachtext?
§ 1 Grundsatz
Auf individuelle Ausbildungsförderung besteht für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung ein Rechtsanspruch nach Maßgabe dieses Gesetzes, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
§ 2 Ausbildungsstätten
(1) Ausbildungsförderung wird geleistet für den Besuch von 1. weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und Berufsfachschulen, einschließlich der Klassen aller Formen der beruflichen Grundbildung, ab Klasse 10 sowie von Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt, wenn der Auszubildende die Voraussetzungen des Absatzes 1a erfüllt, […]
Ein spezifischer Fachbegriff hat eine eingeschränktere Bedeutung als ein Wort in der Gemeinsprache. Beispielsweise wird im obigen Auszug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes unter Besuch ‚die regelmäßige Teilnahme am Schulunterricht‘ verstanden, während die zeitliche Dimension von Besuch in der Alltagssprache weniger eingeschränkt ist: Ein Besuch kann fünf Minuten oder mehrere Wochen andauern, er kann tagsüber oder in der Nacht stattfinden und man kann jemanden häufiger oder auch nur ein einziges Mal besuchen.
Ein Sonderfall von Fachbegriffen sind Termini (oder auch termini technici): Ein Terminus bezeichnet einen im jeweiligen Fach genau definierten Begriff eindeutig und besitzt damit in einer bestimmten Fachsprache eine exakte Bedeutung. Die Menge der Termini einer Fachsprache bezeichnet man als Terminologie.
Ein Terminus aus der Fachsprache der Anatomie ist beispielsweise musculus flexor digitorum superficialis als Bezeichnung für einen bestimmten Muskel am Unterarm. Dass es sich dabei um einen Fachbegriff handelt, leuchtet wahrscheinlich intuitiv sofort ein, da musculus flexor digitorum superficialis wohl fast allen Nicht-Medizinern unbekannt ist. Es handelt sich hier also um eine Wortgruppe, die nicht im Wortschatz der Gemeinsprache existiert, da sie eine ausschließlich fachspezifische Bedeutung hat.
Bei manchen Fachbegriffen ist das Wort beziehungsweise die Wortform auch in der Gemeinsprache vorhanden, aber die Bedeutung in der Alltagssprache unterscheidet sich von der fachsprachlichen Bedeutung des Wortes: Zum Beispiel lässt sich signifikant im alltäglichen Sprachgebrauch mit ,bedeutsam‘ oder ,wichtig‘ umschreiben, in der Statistik ist die Bedeutung von signifikant jedoch präzise festgelegt: Hier wird durch statistische Tests geprüft, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein bestimmtes Resultat zufällig zustande gekommen ist. Wird bei dem Test ein zuvor festgelegter Wert nicht überschritten, gilt das Ergebnis als signifikant, das heißt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht auf Zufall beruhend. Die Umwandlung eines alltagssprachlichen Wortes (signifikant in der Bedeutung ,wichtig‘) in einen terminus technicus einer Fachsprache mit einem exakt definierten Bedeutungsumfang (signifikant in der Bedeutung ,überzufällig‘) heißt Terminologisierung.
In einigen Disziplinen sind Teile der Terminologie durch Regeln verbindlich festgelegt, dies nennt man NomenklaturNomenklatur. Dazu zählen beispielweise in der Biologie Richtlinien, die vorschreiben, nach welchen Konventionen die wissenschaftlichen Namen der Lebewesen gebildet werden (zum Beispiel coccinella septempunctata – ,Marienkäfer‘, crocus sativus – ,Safran‘). Auch in der Chemie ist die Namensgebung für chemische Stoffe vorgeschrieben, um eine systematische Beziehung zwischen der Strukturformel und dem daraus abgeleiteten Namen der Verbindung herzustellen (SO3 – Schwefeltrioxid, CH2Cl2 – Dichlormethan). In manchen Fachgebieten sind die Terminologien durch die DIN-Normen des Deutschen Instituts für Normung festgelegt: DIN 199 definiert die Terminologie der technischen Produktinformation (CAD-Modelle, Zeichnungen und Stücklisten), DIN 1320 definiert Begriffe der Akustik und DIN 77001 legt Kurzzeichen von Ausstattungsmerkmalen in Reisekatalogen fest, bezieht sich also auf den Bereich Tourismus.
Wenn auch teilweise gefordert wird, dass ein Terminus idealerweise eineindeutig sein sollte, das heißt, dass zur Benennung eines bestimmten Objekts oder Konzepts nur ein einziger Terminus existieren sollte, ist das in der Praxis nicht immer der Fall: Oft haben Fachbegriffe Synonyme, meist mit unterschiedlicher Herkunft. So wird zum Beispiel in der medizinischen Fachsprache die Bindegewebskrankheit Sarkoidose alternativ als Morbus Boeck oder auch als Morbus Schaumann-Besnier bezeichnet, in der Chemie existiert Glaubersalz neben Natriumsulfat-Decahydrat als Name für Na2SO4 und in der Fachsprache der Musik wird eine aufwärtsführende musikalische Linie Anabasis oder Ascensus genannt.
Fachtexte bestehen nicht ausschließlich aus Fachbegriffen, auch wenn beim Lesen eines Textes wahrscheinlich vor allem das fachwissenschaftliche Vokabular auffällt. Neben den spezifischen wissenschaftlichen Fachbegriffen der jeweiligen Fachrichtung (zum Beispiel akteurzentriert, Institutionalismus in der Fachsprache der Politik) enthalten fachwissenschaftliche Texte auch Wörter der Gemeinsprache, die bedeutungsgleich auch in der Alltagssprache vorkommen (zum Beispiel in, sondern, wichtig).
Neben dem Wortschatz einer bestimmten Fachsprache einerseits und Wörtern der Alltagssprache andererseits kann man aber auch noch eine dritte Gruppe Wörter ansetzen, die in Fachtexten zu finden sind, nämlich Fachbegriffe, die in mehreren wissenschaftlichen Disziplinen vorkommen (zum Beispiel Problem, Theorie, relativ). Diese Wörter gehören zur sogenannten alltäglichen Wissenschaftssprache (vergleiche Ehlich 1993). Sie bilden die Grundlage für die Wissenschaftskommunikation und sind infolge dessen auch sehr relevant für das Lernen beziehungsweise Unterrichten des fachsprachlichen Wortschatzes einer Sprache (siehe auch den Abschnitt unten Wortschatz im Fachsprachenunterricht und Kapitel 5 Fach- und Berufssprachenvermittlung). So postulieren Ehlich & Graefen (2001: 373):
Die Alltägliche Wissenschaftssprache ist Bestandteil, Resultat und zugleich Voraussetzung der Wissenschaftskommunikation, also unabdingbar für jeden, der sich am deutschen Wissenschaftsbetrieb beteiligen will.